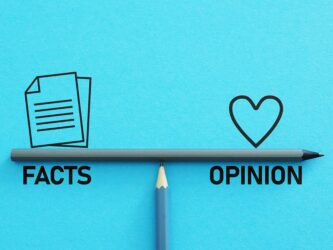Es gibt Alternativen. Das ist eine Grundbedingung heutiger Existenz. Julia Knop beobachtet im adventlichen Geschehen das Nebeneinander und die Gleichzeitigkeit verschiedener Welten und Lebensweisen.
Die letzte Woche des Kirchenjahres ist angebrochen. Wir sind mitten in Deutschland, mitten in Thüringen, mitten in Erfurt, oben auf dem Domberg. Gerade erst haben die Katholiken Christkönig gefeiert und die Protestanten den Totensonntag begangen – manche sagen hier: den Totensonntag überstanden, denn der Tod wirft böse Schatten, die kein Mensch sehen möchte. Die Texte und die Symbolik der letzten Tage im liturgischen Jahr sind düster. Sie tragen apokalyptische Züge und rufen Bilder auf, die man lieber nicht in seinem Kopf hätte.
Zwei Welten: Keine Spur von Idylle?
Der liturgische Advent startet ganz ähnlich. Keine Spur von Idylle. In immer neuen Varianten heißt es: Das Ende ist nah – Christ, sei wachsam! Jederzeit – nein: jetzt im Augenblick – kann der Herr wiederkommen. Wir kennen nicht den Tag noch die Stunde, wir hören nur: Es wird zur Unzeit sein. Die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden, die Völker der Erde werden jammern und klagen (Mt 24,29f). Von zwei Frauen, die mit derselben Mühle mahlen, wird eine mitgenommen und eine zurückgelassen (Mt 24,41). Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt (Mt 3,10). Wann auch immer der Herr kommt, wann auch immer Gottes Jetzt in unser Leben einbricht: Wir werden schlecht, wahrscheinlich gar nicht vorbereitet sein. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht (Mt 24,43): unerwartet, unvermutet und ganz anders als gedacht. Wohl dem, der wachsam war.
Oder: Endlich wieder Weihnachten?
Entsprechend gestimmt klettert der Werktagsmessbesucher aus der Domkrypta – und findet sich in einer anderen Welt. Vom Fuße des Domes schallt ihm aus mannshohen Lautsprechern „O Tannebaum“ und „Jingle Bells“ entgegen; ein Posaunenchor bläst das weihnachtliche Gloria. Bei Anbruch der Dunkelheit am Montag nach Christkönig war – weder unerwartet noch unvermutet, vielmehr programmatisch eingeführt und angekündigt – der Nikolaus erschienen. Er stieg publikumswirksam die Domstufen herab und verkündete große Freude: Es ist endlich wieder Weihnachten! Ein Meer von Lichtern hieß ihn willkommen, Düfte und Klänge erfüllen nun die Nacht. Zwei Engel kehrten im Rathaus ein und geleiteten den Oberbürgermeister im weihnachtlichen Vierergespann zur Festivität. Feuerwerk und Märchenspiel, Gospelchor und Orchester gestalteten einen fulminanten Eröffnungsabend. Seither sind die Straßen schwarz vor Menschen, durchweg gut gelaunt und kauflustig. Von nah und fern kommen sie und ziehen – nein, nicht zum Berg des Herrn –, sie ziehen zum Fuße des (Dom-) Berges, zum Weihnachtsmarkt. Zwei Welten, zwei Weisen, den kalendarischen Advent zu begehen.
Charles Taylor hat in seiner viel beachteten Studie „Ein säkulares Zeitalter“ drei Typen von Säkularisierung unterschieden. Säkularisierung meine nicht nur das, womit sie begann: die institutionelle Trennung politischer und religiöser Sphären, staatlicher und kirchlicher Macht, die nach Leid und Kriegen zur Geburt des weltanschaulich neutralen Staates westlicher Prägung führte. Sie ist auch noch nicht erschöpfend erfasst, indem man den radikalen Bedeutungsverlust des Religiösen im privaten und öffentlichen Leben beschreibt, den wir in westlichen Gesellschaften seit langem beobachten und dessen Tendenz eindeutig ist. Säkularisierung bedeute darüber hinaus, so Taylor, dass sich die Bedingungen von Religion gravierend verändern.
Das Bedingungsfeld religiöser Praxis und transzendenzbezogener Lebensdeutung hat sich verändert.
Eine in diesem dritten Sinn säkulare Gesellschaft ist beileibe keine gottfreie Zone – man schaue nur in die USA –, aber eine Welt, in der Gott vorkommen kann – oder nicht, in der man sich auf (einen) Gott beziehen kann – oder nicht. Ob das eine „Wiederkehr des Religiösen“ ist, die das Rad der Säkularisierung der zweiten Form zurückdreht, erscheint mehr als fraglich. Wesentlich interessanter dürfte sein, sich anzuschauen, was eigentlich passiert (ist) und wie sich das Bedingungsfeld religiöser Praxis und transzendenzbezogener Lebensdeutung verändert. Diesen Prozess beschreibt Taylor als einen
„Wandel, der von einer Gesellschaft, in der es praktisch unmöglich war, nicht an Gott zu glauben, zu einer Gesellschaft führt, in der dieser Glaube auch für religiöse Menschen nur eine Möglichkeit neben anderen ist. Es mag mir zwar undenkbar vorkommen, den eigenen Glauben fallen zu lassen, doch es gibt andere Menschen, zu denen vielleicht auch solche gehören, die mir überaus nahestehen… [Es zeigt sich:] Der Glaube an Gott ist heute keine unabdingbare Voraussetzung mehr. Es gibt Alternativen.“
(Ch. Taylor, Ein säkulares Zeitalter, Frankfurt/M. 2012, 15)
Ob mit oder ohne Gott, in welchen Koordinaten auch immer ein Menschenleben spielt, besser: ein Mensch das Spiel seines Lebens verortet, immer strebt er danach, gut zu leben, erfüllt zu leben, Fülle zu erleben. Menschen streben nach Wohlfahrt und Glück, jeder und jede auf seine oder ihre Weise.
Das gleiche Streben nach einem Leben in Fülle. Mit oder ohne Gott.
Wo dies gelingt, stimmt alles, wenigstens für einen Moment. Man fühlt sich stark, selbstwirksam und lebendig. Neben solchen Sternstunden bleibt ein alltagstaugliches Maß – Taylor sagt: ein mittlerer Zustand – erstrebenswert: das kleine Glück des Alltags, das Gefühl, in der richtigen Rolle zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und privat und beruflich etwas Sinnvolles zu tun, in welcher Größenordnung und Sichtbarkeit auch immer. Wo auch das fehlt, entgleitet oder auch nur in zähen Überdruss gerinnt, kann eine Welt zusammenbrechen. Das erträgt kein Mensch, egal, ob er oder sie an (einen) Gott glaubt oder nicht.
Religiöse und nicht religiöse Menschen unterscheiden sich, so Taylor, nicht darin, dass sie nach einem Leben in Fülle streben, sondern darin, wie sie das tun, worin sie Fülle erleben und wo bzw. wann und wodurch sie sie erwarten. Vereinfacht gesagt gilt auch hier, was wohl die Grunddifferenz zwischen einer religiösen und einer nichtreligiösen Lebensweise ausmacht: ob jemand sein Leben, seine Welt und deren Geschichte in die Koordinaten (eines) Gottes stellt, ob er Selbstverständnis, Welt- und Geschichtsdeutung angesichts Gottes vornimmt und sein Wohl und Wehe seinem Gott anheimstellt – oder nicht.
In dieser Gegend rund um den Dom zu Erfurt ist es eher üblich, all das ohne einen wie immer gearteten Transzendenzbezug zu tun. Leben in Fülle gibt es natürlich trotzdem. Leben in Fülle geschieht hier und jetzt, mit intensivem Erlebniswert, wenigstens da und dort.
Der Advent als Lehrstück für verschiedene Optionen, ein Menschenleben zu führen.
Der Advent und die Weise, wie er begangen werden kann, ist ein einziges Lehrstück für solcherart verschiedene Optionen, sein Menschenleben zu führen. Und der Erfurter Weihnachtsmarkt und seine 2016 neu erfundene kleine Schwester, der mittelalterliche Adventsmarkt am Fuße der anderen Seite des Dombergs, sind Anschauungsobjekte, wie sie schöner, gleichzeitiger und wählbarer kaum sein könnten. Eindeutig: „Es gibt Alternativen“, sie sind am Erfurter Dom nur wenige Meter oder 70 Stufen voneinander entfernt. Hier kann man sie studieren.
Die Adventsgestalten im Westen, Johannes Baptist, der Engel und Maria in der Erwartung, mahnen, künden, verheißen. Sie stellen in Aussicht, was noch kein Auge geschaut hat, und besingen, was alles Menschenmögliche überschreitet und dennoch vieler Menschen Herz ersehnt. Stadtseitig treten Weihnachtsmann und Christkind, vereint mit den drei Königen (sie werden einige Wochen später, wenn sie hier nicht mehr gebraucht werden, in den Dom ziehen) und ganzen Heerscharen von Engeln auf. Die Engel im Osten kündigen, anders als ihre Kollegen auf der Westseite des Doms, nichts an, was noch ausstünde. Sie besingen, was und v.a. dass es schon da ist. Sie singen nicht vom Weg, sondern vom Ziel, nicht von Verheißung, sondern von Fülle. Carpe diem!
Unterwegssein? – Oder: Zupacken!
Verheißung? – Oder: Carpe diem!
Wo der Christenmensch, zumindest die adventliche Liturgie, das Unterwegssein, die Unbehaustheit und Ungeborgenheit des Menschen, seine Bedürftigkeit und Gebrochenheit, verbalisiert und den Heiland anfleht, dass er – endlich! – die Himmel aufreiße, dass er – endlich! – komme (maranatha – komm, Herr Jesus!) und tröste und heile, auf dass Frieden werde den Menschen auf Erden, da bietet der Weihnachtsmarkt und bieten die weihnachtlich verlängerten Geschäftsöffnungszeiten Fülle pur. Man muss nur zugreifen. Es liegt an jedem und jeder Einzelnen, ob er oder sie zupackt oder nicht, ob er seine und sie ihre Möglichkeiten nutzt oder nicht, ob er oder sie sich zum seligen Glühweinplausch verabredet oder nicht.
Demgegenüber bleibt der Christenmensch vergleichsweise miesepetrig, zumindest nüchterner, zurück. Seine Aussichten, hier und jetzt Leben in Fülle zu erleben oder vorsichtiger: Leben in Fülle zu erwarten und zu ergreifen, stehen, zumindest theoretisch, schlecht. Selbst das Weihnachtsfest, auf das er zugeht, bleibt symbolisch und er selbst auf dem Weg – bis Er, Jesus, wiederkommt in Herrlichkeit. So steht es eben um den Menschen, sagt der Christenmensch. Fülle – Gottes Fülle – bleibt Verheißung. Sie lässt auf sich warten, viele Menschenleben lang. Sie kommt uns entgegen, ist aber kein Werk unserer Hände. Noch der mittlere Zustand alltagstauglicher Zufriedenheit ist nicht im eigentlichen Sinne erstrebenswert, eher – zumindest auch – eine Gefährdung der Wachsamkeit, eine Decke, die den Ernst der Situation verharmlost.
Vom Segen adventlicher Existenz.
Alfred Delp, der große Adventsprediger, der, weil er Christ war und Jesuit blieb, am Lichtmesstag 1945 durch das nationalsozialistische Unrechtsregime hingerichtet wurde, schreibt wenige Wochen zuvor in seiner Zelle vom Ernst und Realismus, freilich auch vom Segen solcherart adventlicher Existenz. Er ist überzeugt,
„… dass die Grundverfassung des Lebens immer adventlich ist: Grenze und Hunger und Durst und Unerfülltheit und Verheißung und Bewegung aufeinander zu. Das heißt aber, im Grunde bleibt der Mensch ungeborgen und unterwegs und offen bis zur letzten Begegnung. … Es gibt also das Endgültige vorläufig nicht, und der Versuch, Endgültigkeiten zu schaffen, ist eine alte Versuchung des Menschen. Hungern und Dürsten und Wüstenfahrt und Notseilgemeinschaft gehören zur Wahrheit des Menschen. … Das ist das eigentliche Thema des Lebens.“
(A. Delp, Adventssonntage, in: Schriften IV, Frankfurt/M. ²1985, 156)
Der Advent spricht von Anbruch und Beginn, von Not und Bedürftigkeit. Er spielt in Kälte und Dunkelheit, in der Nacht und im Morgengrauen, erleuchtet nur von Kerzen, die kaum das Dunkel vertreiben, so sehr man auch singt: „Rorate Coeli!“ Die Stunde des Weihnachtsmarktes ist der Nachmittag und der Abend. Die Mühsal des Tagewerks ist geschafft, die verdiente Belohnung steht an und bereit: Leben in Fülle, hier und jetzt, worauf sollen wir warten? So verschieden ist die Welt.
Julia Knop ist habilitierte Dogmatikerin und vertritt gegenwärtig den Lehrstuhl für Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Fakultät an der Universität Erfurt.
(Bild: Marco Barnebeck/pixelio.de)