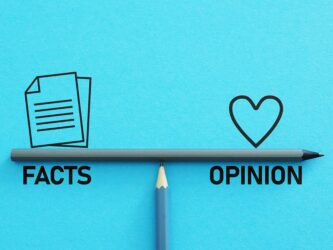In der Nacht vom 9. auf den 10. November vor dreißig Jahren fiel die Berliner Mauer. Seitdem gibt es Ost-West-Debatten, in denen munter deutsch-deutsche Identitäten zitiert werden. Hinter diesen kann man sich verschanzen – oder sie kreativ durchbrechen. Das schlägt der Kommunikationswissenschaftler Wolfgang Reißmann vor.
Ganz ehrlich, als der SPIEGEL vor einigen Wochen „So isser, der Ossi“ titelte, habe ich das Heft bewusst ausgelassen. Sehr wahrscheinlich war die Titelgeschichte komplexer als die Überschrift, die uns bei unseren Stereotypen abholen sollte. Wahrscheinlich wurde das ganze Panorama, Für und Wider, entfaltet. Von A wie AfD, B wie Biografieentwertung, über J wie Jammerossi, N wie NSU bis T wie Treuhand und W wie Wutbürger. Ich weiß es nicht. Ich habe das Heft nicht gelesen. Auch in der Vorbereitung dieses Textes habe ich mich nicht damit beschäftigt. Reflektierte Diskursvermeidung nenne ich das.
Ich bin 1981 in der DDR geboren. Beim Mauerfall war ich acht Jahre alt. Eigentlich sollte mir die Ost-West-Geschichte – eben – als Geschichte gegenübertreten. Ich bin ein Kind der BRD, ein Westkind, das irgendwo hinter Wittenberg in Sachsen-Anhalt aufgewachsen ist. Bis ich 18 war, lief das mit der Geschichte ganz gut. Natürlich war Ost/West ein Thema, vor allem der Elterngeneration, auch in der Schule. Wir hatten, wie zeitgleich die Jugendlichen drüben, im Hier und Jetzt andere ‚Sorgen’. Liebe, Party, „links vs. rechts“. Solche Sachen.
Schleichende Symptomentfaltung
Das änderte sich schlagartig mit meinem Studienbeginn Ende der 1990er Jahre in Leipzig. Auf dem Land groß geworden, haben mich die ersten Semester an der anonymen Massenuni beeindruckt, um es mal so zu formulieren. Zu allem Überdruss waren da diese westdeutschen Kommilitonen (vor allem die männlichen Studenten fielen mir auf), die scheinbar alles waren, was mir abging: laut, diskussionserfahren, positionsstark, mit natürlichem Selbstbewusstsein gesegnet. Ich verglich mich mit diesen Anderen, in deren Spiegel ich mich selbst als ein Anderer betrachtete. Eine Freundin von damals nannte das nonchalant, aber treffend: „mind-fucking“. Hat nichts mit Sex zu tun. Sie meinte damit das ewige Hin- und Herwenden von Selbst- und Fremdwahrnehmungen, ohne dass es dabei ein Ergebnis, eine Lösung, ein Vorwärtskommen gibt. Wie dem auch sei: Ohne es zu merken, ist er ausgebrochen: Ost-West-Diskurs-Juckreiz. Bis heute kann ich das Kratzen nur unter Kraftanstrengung unterdrücken.
Von vielen Einzelfällen zur Epidemie
Zugegeben, mein Fall ist speziell. Aber dass wir kollektiv und bundeslandübergreifend an ausgeprägtem Ost-West-Diskurs-Juckreiz leiden, davon bin ich überzeugt. Es gibt vermutlich tausend Möglichkeiten, sich anzustecken. Und um das deutlich zu sagen: Diskurs ist selbstverständlich notwendig. Nicht jedes Leiden ist gleich ein Übel. Wenn wir nicht mehr mit- und übereinander sprechen, verlieren wir fast alles von dem, wofür Demokratie steht. Ostdeutsches Wahlverhalten, westdeutsche Ignoranz, Mentalitäten, Aufbau und Abbau Ost… – natürlich muss all das besprochen werden. Auch heute. Auch 30 Jahre nach dem Mauerfall. Auch von den Spätergeborenen. Wenn Unterschiede nicht benannt werden, gibt es keine Grundlage, um z. B. gegen Ungleichheiten aktiv zu werden, in welche Himmelsrichtung auch immer. Aber: Es gibt einen Punkt, da geht es analytisch nicht weiter. Dann beginnen Diskurse sich zu wiederholen und selbst zu bestätigen. Sie füttern sich selbst, ohne dass erkennbar wäre, wem sie helfen und was sie ändern.
Negative Krankheitsverläufe durch stupide Diskurswiederholung
Der Ost-West-Diskurs ist seit langem festgefahren. Ich erlebe ihn nicht als kreativen Diskurs, bei dem ich ständig Aha-Erlebnisse hätte. Öffentlich-massenmedial nicht. Privat selten. Wenn ich mit west- und ostdeutschen Freund/-innen und Kolleg/-innen abends zusammensitze und wir uns wieder einmal kratzen, mobilisieren wir die immer gleichen Narrative: von Treuhand und West-Eliten in Ostdeutschland, über Entwurzelungserfahrungen, Massenarbeitslosigkeit und Bevölkerungsabwanderung, bis hin zur Sanierung der Innenstädte, dem Aufschwung in Leuchtturmregionen wie Jena und Leipzig, den ‚abgehängten’ Regionen, die es im Westen genauso gibt und-so-weiter-und-sofort. Dann gehen wir nach Hause. In zwei Wochen treffen wir uns wieder und beginnen von vorn.
Die Pointe an Diskursen ist, dass ihre Stränge oft komplementär angelegt sind. „Besserwessi/Jammerossi“ bilden einen Zusammenhang, „weltoffener Westen/provinzieller Osten“ einen anderen, „Treuhand-Ausverkauf/Solidaritätszuschlags-Milliarden“ einen weiteren. Das eine gibt es als Projektionsfläche, weil es das andere gibt. Selbstverständlich ist jeder für sein Handeln verantwortlich und niemand darauf festgelegt, die sich ihm bietenden Rollen ein- und anzunehmen. Das Spektrum der zu vergebenden Diskurspositionen – und das sind potenzielle Identitätspositionen – erzeugen wir jedoch gemeinsam.
Dem Juckreiz nicht ständig nachgeben: Zum Menschen gehört schließlich, dass Reiz und Reaktion nicht starr gekoppelt sind.
Schenken wir der kognitionslinguistischen Framing-Forschung Glauben, ist es nachrangig, ob wir einen bestimmten „Rahmen“ (Frame) positiv oder negativ bewerten. Verfestigt werde bei seiner Thematisierung in erster Linie der Rahmen selbst. So z. B. die Metapher der „Flüchtlingsflut“, die sich als bedrohliches Bild in den Köpfen festsetzt, unabhängig von der politischen Bewertung, die sich im Diskurs naturgemäß unterscheidet.
Als Medien- und Kommunikationswissenschaftler ist mir die Macht der Bilder bewusst. „Diskurs-Juckreiz“ hat ebenfalls Frame-Potenzial und bedient sich einer essentialistischen Metaphorik. Sprechen, Dialog, Diskussion – eine Krankheit? Gefährliches Fahrwasser. Rassist/-innen und Fundamentalist/-innen nutzen solche Bilder. Aber das Bild funktioniert eben nicht wie z. B. „Der große Austausch“, ein von der Identitären Bewegung verbreitetes dystopisches Hirngespinst. Zur anthropologischen Ausstattung des Menschen gehört, dass Reiz und Reaktion nicht starr gekoppelt sind. Wir können uns entscheiden, es auch mal jucken zu lassen.
Etablierte Heilungsmethoden sind Teil des Problems
Ich selbst habe Jahre gebraucht, um jene Westdeutschen zu sehen, die eher unsicher und introvertiert sind. Die gibt es natürlich auch, nur habe ich sie nicht als „westdeutsch“ identifiziert. Sie sind mir genauso durchs Raster gefallen, wie vermutlich Westlern jene Ostler, die nicht durch „Befindlichkeiten“ und „Jammern“ auffallen. In den letzten Jahren musste ich in den (a)sozialen Netzwerken dann mit Schmerzen zur Kenntnis nehmen, dass nicht jede/r aus dem Osten mit jener Ruhe, Bescheidenheit und Selbstironie auftritt, die von Westlern früher gern als Attribute genannt wurden, wenn es um positive Eigenschaften der Ostdeutschen ging. Also: Wer ist er denn nun, der Ostler? Und der Westler? Wann machen wir uns als „Ost“ und „West“ sichtbar? Und warum?
Für mich persönlich gilt, dass der real existierende Ost-West-Diskurs oft hinderlich zwischen mir und meinem Gegenüber stand und manchmal noch heute steht. Er war selten hilfreich, um dieses Gegenüber als individuellen Menschen wahr- und anzunehmen. Mein bester Freund, gebürtiger Hesse, kann ein Lied davon singen. Er war übrigens einer dieser Kommilitonen von damals. Mittlerweile ist er, zusammen mit seinen Eltern, im ostdeutschen Speckgürtel von Berlin beheimatet, mit Kindern, die in Ost(west)deutschland zur Schule gehen.
Nach 30 Jahren erfolgloser Paartherapie sollte man mal die Therapieform wechseln!
Früher habe ich gedacht, das sei der Weg: im Gespräch Wissen und Verständnis schaffen, differenzieren, Unbehagen artikulieren. Gesprächstherapie gewissermaßen. Und es soll ja bis heute Westdeutsche geben, die ihren Lebtag lang keinen Fuß in den Osten gesetzt haben. Hier kann Bildung, Aufklärung und Diskussion krampflösend sein, auf beiden Seiten freilich. Im größeren Maßstab bin ich skeptisch geworden. Wenn man seit 30 Jahren in Paartherapie ist und merkt, dass der Ansatz nicht fruchtet, dass eben nicht zusammenwächst, was zusammengehört, sollte man vielleicht die Therapieform wechseln? Vielleicht von der Gesprächstherapie wechseln zur Verhaltenstherapie? Oder Tanz- und Bewegungstherapie? Miteinander kochen statt immer nur (übereinander) reden?
Alternativen: Hoffnung durch reflektierte Diskursvermeidung?
Neuere soziologische Ansätze analysieren die Entwicklung des Ostens ab 1989 mit den Konzepten der Migrationssoziologie. Diese ungewohnte Sichtweise erzeugt Pointen, die hier nicht das Thema sind. Man stelle sich etwa ostdeutsche Migranten vor, deren gescheiterte Integration zu Frustration führt, die sie an anderen Migrantengruppen abreagieren (anstatt sich mit diesen zu solidarisieren). Wenn das schon historischer Sarkasmus ist, lasst uns die Denkschraube weiterdrehen: Ist dann nicht eigentlich der Westen mitschuldig am „rechten Osten“? Hätte er den Osten auf Augenhöhe integriert, mit welch großer Geste könnte dieser das erfahrene Glück nun weitergeben!
Lassen wir das mit der Migration. Der Vergleich hinkt natürlich mit mehr als einem Bein. Von der interkulturellen Pädagogik aber können wir schon lernen. Die hat sich seit geraumer Zeit vom Ahaerlebnis-Modell der interkulturellen Begegnung – „Die sind so ursprünglich und ungezwungen, diese Afrikaner!“; „Die nehmen sich nicht so ernst, diese Ostdeutschen!“ – als Königsweg entfernt. Begegnung, Austausch und Empathie sind wichtig. Es kommt aber vor allem darauf an, dabei weder andere noch sich selbst auf kulturelle Identitäten festzulegen, sie nicht bei jeder Gelegenheit zu thematisieren und sie immer wieder als einfach zu habende Begründung für stets konkretes und situationsgebundenes Handeln abzurufen. In dieser Disziplin mentaler Disziplinierung und Zurückhaltung sind leider weder Ost- noch Westdeutsche besonders gut.
Sich hinter kulturellen Identitäten verschanzen – das sollten wir alle vermeiden, ob Ost oder West.
Aber es gibt Hoffnung: Meine Nichte, 1992 geboren und in der Nähe von Dresden groß geworden, hat mich einmal gefragt, ob Braunschweig in Sachsen liege. Da war sie zwölf und wir waren mit dem Auto unterwegs. Ich habe herzlich über diese geografische Orientierungslosigkeit gelacht. Zugleich empfand ich Entspannung. Ost? West? Wen interessiert das? Sag’ mir lieber, welche Musik Du hörst. Heute ist meine Nichte Mitte 20. Vielleicht haben sie und ihr westdeutscher Partner schon besser gelernt, sich nur dann zu kratzen, wenn es wirklich nötig ist und sich ansonsten nicht hinter Ost-West-Diskursen zu verstecken. Mit Mitte 20 weiß natürlich auch meine Nichte, wo sie herkommt und dass sie nicht aus Braunschweig stammt. Sondern aus der Gegend, die seit 2015 ständig mit Negativschlagzeilen in der Presse ist. Für die schämt sie sich genauso fremd wie ich. Nur wollen wir niemandem den Gefallen tun, sich hinter einer irgendwie hergeleiteten ostdeutschen Identität und Biografie verschanzen zu können. Und Westdeutsche sollten das auch nicht tun, nicht in Bezug auf Ostdeutsche, und nicht in Bezug auf sich selbst in Form einer westdeutschen Identität, die nur vermeintlich das kosmopolitische Gegenstück bildet.
Also, lasst uns in den nächsten 30 Jahren die reflektierte Diskursvermeidung versuchen: Erst einmal jucken lassen und wenn es dann notwendig erscheint – oft ist es das ja – können wir immer noch loslegen, wir haben ja Übung.
—
Dr. Wolfgang Reißmann ist Medien- und Kommunikationswissenschaftler an der Universität Siegen. Wissenschaftlich arbeitet er nicht über Ost-West-Diskurse, hat aber schon sehr oft welche geführt.
Bild: Helga / pixelio.de