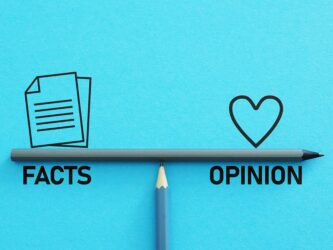Zwar wird in öffentlichen Debatten häufig von christlich-jüdischen Traditionen gesprochen. Doch werden jüdische Traditionen, Symbole und Praktiken in der Öffentlichkeit immer noch als störend gesehen. Julia Bernstein und Stefan Müller rücken sie deshalb ins Blickfeld und fragen überzogene Formen von Säkularität kritisch an.
Religion und religiöse Symbole fordern heraus. Sie treffen auf eine Gesellschaft, die sich im Selbstverständnis als säkular versteht. Religiöse Symbole scheinen dem entgegenzustehen, da sie die säkulare Gesellschaft befragen und befragbar halten. Max Horkheimer hat das religiöse Versprechen als die ‚Sehnsucht nach dem ganz Anderen‘ bezeichnet (Horkheimer 1970). Verbunden damit ist die grundlegende Annahme, dass das, was ist, nicht alles sein kann und soll.
Religion – überholt, rückständig, überflüssig.
Die Fragen nach dem besseren Leben bilden bis heute erheblichen Anstoß, auch Unruhe und Unbehagen. Die säkulare Gesellschaft will von der ‚Sehnsucht nach dem ganz Anderen‘ kaum mehr etwas hören oder darüber auf religiöser Grundlage in den Austausch treten. Die moderne Orientierung an Verwertung und Nutzen rückt ein Verständnis von Rationalität, das dem Ringen um das bessere Leben ebenfalls innewohnt, mehr und mehr in den Hintergrund. Eine dichotome Gegenüberstellung von Aufklärung und Religion greift daher auf eine grobe Verzerrung zurück (Müller/Sander 2018; Bernstein/Beck 2022, 332). Im säkularisierten Selbstverständnis erscheint Religion als überholt, rückständig, überflüssig und einschränkend. Dies betrifft in besonderen Hinsichten jüdisches Leben in Deutschland, wenn ein verkürzt verstandenes Verständnis von Gleichberechtigung den Ausschluss von Juden und Jüdinnen legitimiert.
Ein säkulares Missverständnis
von Gleichberechtigung
Bildungsinstitutionen heute, sei es die Schule oder die Hochschule, sind weitaus stärker damit beschäftigt, die Auseinandersetzungen um religiöse Symbole zu ordnen und zu verwalten, oft auch kleinzuhalten, anstatt einen Raum für religiöse Identitäten zu bieten und darüber zu informieren. Dies gilt in besonderem Maße für sichtbares jüdisches Leben in den Bildungsinstitutionen. Jüdische Schüler/-innen verstecken oft ihre religiöse oder kulturell jüdische Identität, weil sie ansonsten Gefahr laufen, exotisiert bzw. angefeindet zu werden. Jüdische Lehrer/-innen, die Schabbat halten und deshalb nicht an Konferenzen am Freitagnachmittag teilnehmen, gelten als zu fromm, nicht angepasst, störend oder mindestens befremdlich. Jüdischen Studierenden, die an jüdischen Feier- und Ruhetagen keine Klausuren schreiben möchten oder können, werden strukturelle Hürden auferlegt, die im Blick der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft gar nicht als Problem erscheinen. Legitimiert werden solche Benachteiligungen damit, dass nicht alle Religionen berücksichtigt werden können, denn dann würde man gar keine Termine finden. Hier verdeutlicht sich ein säkulares Missverständnis von Gleichberechtigung: Die Gesellschaft versteht sich als ‚aufgeklärt‘ und wehrt darüber Gleichberechtigung und Teilhabe ab – von Juden und Jüdinnen.
Anerkennung gerät zur leeren Geste
Die jahrtausendealte Geschichte des Judenhasses wirkt darin nach. Jüdische Identitäten gelten immer noch nicht als selbstverständlich oder scheinen gar bedrohlich. Die viel beschworene Bereicherung durch jüdisches Leben in Deutschland endet am Punkt sichtbar gelebten Judentums in öffentlichen und institutionellen Räumen. Abstrakt wird die Bedeutung des jüdischen Lebens in Deutschland zwar betont, die Akzeptanz und Normalität jüdischer Identitäten sowie gelebter Religiosität im Alltag versagt jedoch. Die Anerkennung gerät zur leeren Geste, wo Jüdinnen und Juden nicht als selbstverständlicher Teil der Gesellschaft gesehen bzw. wegen ihrer Religion benachteiligt werden. Sichtbare und selbstbewusste Juden und Jüdinnen, die eine Opferrolle verweigern, werden zudem oft als unbequem wahrgenommen und das Einhalten von jüdischen Feiertagen als besondere Privilegierung abgelehnt (Bernstein/Beck 2022).
Jüdinnen und Juden mit traditioneller Praxis
gelten als rückständig
Dabei müssen die Formen der Delegitimierung jüdischen Lebens im Alltagsbewusstsein gar nicht als solche erscheinen, subjektiv sind sie möglicherweise sogar ungewollt und unbeabsichtigt; zuweilen werden sie aber auch gerechtfertigt aus einem verkürzt verstandenen Gleichheits- und Aufklärungsanspruch, der spezifisch gelebtes Judentum einschränkt.
Hinzu kommen derzeit in der Öffentlichkeit der Intellektuellen, in den Feuilletons, an Hochschulen und im Kunst- und Kulturbetrieb diejenigen, denen es ein ganz besonderes Anliegen zu sein scheint, Israel zu dämonisieren. Diese gehören häufig genau den gebildeten Kreisen an, die sich als aufgeklärt, tolerant oder an der Geschichte geläutert begreifen. Spiegelbildlich zu solchen Selbstbildern gelten Jüdinnen und Juden dort, wo sie ihre Identität oder Praxis traditionell oder religiös ausleben, als rückständig oder fanatisch. Jean-Paul Sartre hat dies auf den Punkt gebracht: „Der Antisemit wirft dem Juden vor, Jude zu sein; der Demokrat würde ihm am liebsten vorwerfen, sich als Juden zu betrachten.“ (Sartre 1994 [1946]; Hervor. im Orig.)
Vermeidungsverhalten im Blick auf das
sichtbare Tragen jüdischer Symbole
Seit geraumer Zeit sind die Folgen solcher Haltungen in der Forschung nachgezeichnet. In der Studie „Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus in Deutschland“ (Zick/Hövermann/Jensen/Bernstein 2017) antworteten auf die Frage ‚Wie häufig vermeiden Sie es, bestimmte Stadtteile oder Orte in Ihrer Wohnumgebung aufzusuchen, weil Sie sich dort als Jüdin/Jude nicht sicher fühlen?‘ 39 % mit manchmal bzw. häufig, 19 % mit selten und weniger als die Hälfe (42 %) antworten mit ‚nie‘. Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang die Differenzierung, die bei der Frage ‚Wie häufig vermeiden Sie es, äußerlich erkennbare jüdische Symbole zu tragen?‘ sichtbar wird. Bei dieser Frage antworteten 19 % der befragten Jüdinnen und Juden, dass dies auf sie nicht zutreffe. Die Heterogenität jüdischer Identitäten in Deutschland wird hier ebenso sichtbar wie ein Vermeidungsverhalten im Blick auf das sichtbare Tragen jüdischer Symbole: 59 % der Befragten gaben an, dass sie manchmal oder häufig das äußerlich erkennbare Tragen jüdischer Symbole vermeiden. Hinzu kommen 11%, die mit ‚selten‘ antworteten. Dies sind mit 70 % seit geraumer Zeit beunruhigende Hinweise darauf, dass das Zeigen und Tragen jüdischer Symbole von einem erheblichen Teil von Juden und Jüdinnen in Deutschland vermieden wird – in einer Gesellschaft, die sich selbst als aufgeklärt beschreibt.
Religiöse Zeichen als identitätsstiftende
Manifestationen der Persönlichkeit
Das Grundgesetz schützt vor Benachteiligungen durch Religion und Religionsausübung. Real sind in Institutionen jüdische religiöse Praxis wie das Tragen jüdischer Symbole wie Kippa, Kopftuch oder Davidstern, das Einhalten jüdischer Feiertage, Schabbat oder Trauertage bislang kaum berücksichtigt. Sie werden als störend oder provokativ ausgelegt bzw. auf die private Sphäre verwiesen. Religiöse Zeichen und Symbole stellen allerdings eine identitätsstiftende Manifestation der Persönlichkeit dar, die zur Vielfalt beiträgt und eine Ressource ist. Juden und Jüdinnen haben „nicht dank anderer Völker, sondern trotz der Verfolgung durch andere Völker überlebt. Und dies auch dank ihrer Treue zur Torah als Lebensanweisung“ (Bernstein/Beck 2022, 332).
Verstecken jüdischer Symbole als Indikator
Religionssensibilität in der aufgeklärten Gesellschaft, im öffentlichen Raum sowie in Institutionen der Bildung wäre erst dort erfüllt, wo jüdische Lernende und Lehrende frei wären, so zu handeln, wie es ihrem Selbstverständnis entspricht. Das Verstecken jüdischer Symbole ist ein Indikator für den Grad der Freiheit in der aufgeklärten Gesellschaft – und für die konkrete und reale Bedrohung jüdischen Lebens in dieser.
___


Titelbild: Levi Meir Clancy / unsplash.com
Literatur
- Bernstein, Julia. 2020. Antisemitismus an Schulen in Deutschland. Befunde – Analysen – Handlungsoptionen. Weinheim: Beltz-Juventa.
- Bernstein, Julia und Volker Beck. 2022: Jüdische Perspektiven auf das religionssensible Schulsystem. In: J. Bernstein, M. Grimm, S. Müller (Hg.): Schule als Spiegel der Gesellschaft. Antisemitismen erkennen und handeln. Frankfurt am Main: Wochenschau-Verlag, S. 331-359.
- Horkheimer, Max. 1970. Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen. Ein Interview mit Kommentar von Hellmut Gumnior. Hamburg: Furche-Verlag.
- Müller, Stefan und Wolfgang Sander. 2018. Einleitung: Religion als Bildungsaufgabe in Schule und Gesellschaft. In Bildung in der postsäkularen Gesellschaft. In: S. Müller und W. Sander (Hg.):Religion als Bildungsaufgabe in Schule und Gesellschaft. In Bildung in der postsäkularen Gesellschaft. Weinheim: Beltz-Juventa, S. 7–17.
- Sartre, Jean-Paul. 1994 [1946]: Überlegungen zur Judenfrage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Zick, Andreas, Andreas Hövermann, Silke Jensen, und Julia Bernstein. 2017. Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus in Deutschland. Ein Studienbericht für den Expertenrat Antisemitismus. https://archive.jpr.org.uk/download?id=4592