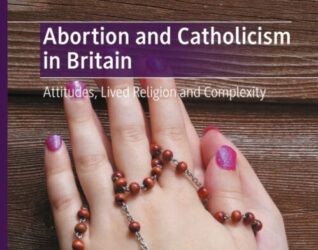Johannes Krug hat eine Vision für Gemeindehäuser, die sich immer schwerer als Orte für die Gemeinde unterhalten lassen.
Gemeindehäusern stehen schwere Zeiten bevor: Erstens muss ihre Bauunterhaltung von immer weniger Gemeindegliedern finanziert werden. Weniger Menschen im gleichen Bestand – das kann auf Dauer nicht gut gehen. Zweitens drohen z.T. erheblichen Bauinvestitionen, die nötig werden, um der Verantwortung für die Schöpfung gerecht zu werden und die gesetzlich festgelegten Klimaziele zu erreichen. Und drittens verschärfen sich die ersten beiden Punkte, wenn eintritt, was seit langem prognostiziert wird: dass mit den Mitgliederzahlen auch die Kirchensteuereinnahmen drastisch sinken werden. Mehr noch als Kirchgebäude, die oft noch einen gewissen symbolischen Schutz genießen und mancherorts auch Unterstützung von außerhalb der Kirche erfahren, werden es Gemeindehäuser in Zukunft schwer haben.
Mehr noch als Kirchgebäude werden es Gemeindehäuser in Zukunft schwer haben.
Auf der anderen Seite sind sie vielerorts aber auch ein Schatz und eine strategische Chance: Bleiben sie doch nicht nur für die kleiner werdende Gemeinde wichtig, sondern auch gesellschafts- und kulturdiakonisch bedeutsam. Gemeindehäuser aus Kostengründen aufzugeben, würde bedeuteten, sich von der kirchlichen Verantwortung für den Sozialraum weiter zu verabschieden.[1]
Hier wird die These vertreten, dass Gemeindehäuser mit einer neuen Idee gedacht werden sollten und betrieben werden könnten: Als Eigenheim hatten sie ihre Zeit – als Gastwirtschaft haben sie Zukunft.
Als Eigenheim hatten sie ihre Zeit – als Gastwirtschaft haben sie Zukunft.
Gemeindehäuser als Eigenheim
Sie schossen nicht zufällig im späten 19. Jahrhundert wie Pilze aus dem Boden. Infolge der Industrialisierung und Urbanisierung waren nicht nur die Städte, sondern auch die städtischen Gemeinden rasant gewachsen: In Berlins Mitte zählte die Thomasgemeinde z.B. gegen Ende des 19. Jahrhunderts ca. 100.000 Seelen (als in Zehlendorf das Paulus-Gemeindehaus 1929/30 errichtet wurde, plante man es auch für immerhin rd. 50.000 Gemeindeglieder). Verständlich ist, dass unter diesen Bedingungen (teilweise war ein Pfarrer für 30.000 Seelen zuständig) Seelsorge und Unterricht kaum mehr leistbar waren, die Taufquote sank rapide.
Folgerichtig entwickelte sich eine lebhafte Diskussion über zeitgemäße kirchliche Strukturen. Letztlich durchgesetzt hat sich ein auf Emil Sulze und seine „Gemeindebewegung“ zurückgehender Reformansatz: Die Großgemeinden wurden in überschaubare Größen geteilt. Dies ermöglichte nicht nur dem Pfarrer einen persönlichen Kontakt zu vielen Gemeindegliedern, sondern zielte auch auf ein – bis dahin eher unbekanntes – sog. „Gemeindeleben“: In Gruppen und Kreisen sollten sich die Gemeindeglieder untereinander persönlich kennenlernen, sich austauschen, stärken und bei Bedarf auch auffangen. Dafür wurden Gemeindehäuser gebaut – als soziale Treffpunkte, als sichere Orte – als Eigenheim für die Gemeindeglieder. Es ist kaum zu übersehen, dass dieses implizite Leitbild bis heute prägend geblieben ist, nur dass heute nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung zur Gemeinde gehört und damit selbst die intendierte Zielgruppe viel kleiner geworden ist.
Gemeindehäuser wurden als soziale Treffpunkte, als sichere Orte, als Eigenheim für die Gemeindeglieder gebaut.
Natürlich konnten sie als offene Häuser Gäste willkommen heißen: Bis heute proben z.B. Laien-Orchester oder auch professionelle Ensemble in Gemeindesälen – wo sonst fänden sie Raum, wenn Turnhallen belegt oder andere Veranstaltungsräume zu teuer sind? Gelegentlich finden auch die Anonymen Alkoholiker Quartier oder andere zivilgesellschaftliche Gruppen wie eine Bürgerinitiative, PEKiP – die Liste der möglichen Gäste ist lang. So nehmen die als Eigenheim gebauten Gemeindehäuser seit dem 19. Jahrhundert bis heute eine wichtige kultur- und gesellschaftsdiakonische Rolle wahr. Tatsächlich war das Programm von Gemeindehäusern anfangs hellsichtig inklusiv angelegt, allerdings ist ehrlich einzugestehen, dass die Wirklichkeit vielerorts anders aussieht. Das ist vor allem am Angebot abzulesen, das sich mehr auf das Bedürfnis der eigenen Gemeinde konzentriert als an dem Bedarf derer, die nicht dazugehören.[2]
Bis heute spielen sie eine wichtige kultur- und gesellschaftsdiakonische Rolle.
Die eingangs beschriebene Finanzierungslücke ist mit den sporadischen Gästen allerdings nicht zu schließen, ihr Beitrag deckt oft kaum die Reinigung und Betriebskosten, geschweige denn den nötigen Anteil an Bauunterhaltung. Dieser lastet auf den Schultern von immer weniger Gemeindegliedern, wie auch die interne Raumorganisation und die Koordinierung notwendigster Reparaturarbeiten von immer weniger beruflichen oder ehrenamtlichen Mitarbeitenden geleistet werden müssen. Auch ein Gästebetrieb will betrieben sein. Wie im privaten Bereich, wenn Kinder das Haus verlassen, wird es auch für Gemeindeleitungen immer beschwerlicher, den ursprünglich für Viele gebauten Bestand zu halten. In die Jahre gekommen sind nicht nur viele Gemeindehäuser als Gebäude, sondern auch ihre Idee, mit der sie seinerzeit errichtet wurden. Als Eigenheim haben sie keine Zukunft mehr.
Es wird immer beschwerlicher, den ursprünglich für Viele gebauten Bestand zu halten.
Gemeindehäuser als Gastwirtschaft
Das hier vorgeschlagene neue Leitbild setzt bei den offenen Türen der Gemeindehäuser an, an ihre ursprüngliche inklusive Idee. Tatsächlich gehört die Gastfreundschaft zum biblischen Grundbestand: Die Geschichte von Rebekka und dem Reisenden (1 Mose 24,15ff) erzählt von ihr nicht als kulturgeschichtliches Ideal, sondern greift tiefer: theologisch. Im gastfreundlichen Handeln wird Gottes Freundlichkeit erkennbar. In der Tischgemeinschaft Jesu setzt sich das fort, sie war eine offene, Fremde und Fremdes integrierende Runde (z.B. Markus 9,9ff). Und daran knüpft auch der Heilige Geist nach Apostelgeschichte 2 an: Er wirkt als Grenzen überwindende, Verstehen ermöglichende, gemeinschaftsbildend-integrative Kraft.
Es kann nur auf einer wirtschaftlich nachhaltigen Grundlage gelingen.
Wenn Gemeindehäuser weiterhin für die kleiner gewordenen Gemeinden erhalten werden und ihre kultur- und gesellschaftsdiakonischen Funktionen fortführen sollen, kann das nur auf einer wirtschaftlich nachhaltigen Grundlage gelingen. Das öffentlich zugängliche, offene Haus, das Gastfreundlichkeit auf einer wirtschaftlichen Grundlage bietet, nennt man Gastwirtschaft.[3]
Attraktiv ist das Leitbild für die kleiner werdenden Gemeinden, weil ihre spezifische Rolle hier klar zu erkennen ist. Als Gastwirte
- bleiben sie weiterhin im Haus präsent und können Räume für den eigenen Bedarf nutzen. Im außerkirchlichen Bereich hat sich herumgesprochen: Familiengeführte Gastwirtschaften genießen höhere Wertschätzung als seelenlose Ketten.
- pflegen sie die christliche Tradition des Hauses. Dafür braucht es nicht viele Menschen – schon zwei bis drei können als „spirituelle Trägergruppe“ den guten Geist eines Hauses prägen. In der weltlichen Gastwirtschaftsbranche weiß man: „Tradition ist hier keinesfalls ein Wettbewerbshindernis, sondern im Gegenteil ein klarer Vorteil, der auch selbstbewusst herausgestellt wird.“[4]
- bestimmen sie die angebotene Küche. Die Gemeinde vor Ort weiß am besten, was vor Ort gebraucht und gesucht wird: eine Beratungsstelle für Alleinerziehende? Der Pflegestützpunkt oder das Familienzentrum?
- richten sie ihr Angebot an Stammgäste und durchreisende Gäste, die nur kurz verweilen.
- achten sie auf die Zahlen – dafür braucht es nicht viele, sondern zwei oder drei, die wirtschaftlich denken können. Gibt es ausreichend zahlende Gäste (etwa die Beratungsstelle, den Pflegestützpunkt oder das Familienzentrum), um das Gebäude zu unterhalten und ggf. auch den ein oder anderen nicht zahlenden Gast (etwa das Orchester) durchzufüttern?
Die evangelischen Gemeindehäuser, als Gastwirtschaften betrieben, werden nach wie vor dem Wohl der Menschen verpflichtet sein. Stadt und Land brauchen solche öffentlichen Räume. Und mit den zahlreichen diakonischen Einrichtungen und weiteren evangelischen (oder gemeinwohlorientierten) Partnern gibt es zahlreiche Gäste, die sich ansprechen ließen. Gemeinsam mit ihnen ließen sich sicherlich nicht alle, aber doch eine ganze Reihe von Gemeindehäusern halten und, mehr noch: weiterentwickeln zu ausstrahlungsstarken evangelischen Orten.
Gemeindehäuser weiterentwickeln zu ausstrahlungsstarken evangelischen Orten.
Es ist im kirchlichen Interesse und entspricht auch der gesellschaftlichen Verantwortung, den alten Gebäuden mit einer neuen Idee Zukunft zu ermöglichen. Wirklich neu ist sie allerdings nicht, diese Idee, hat sie doch im Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lukas 10,25ff) ein biblisches Vorbild: Hier bringt der Samariter den Verletzten in eine Herberge und gibt dem Gastgeber etwas Geld, damit er den Gast bis zu seiner Genesung versorgen kann. Diese Dienst-Leistung erlaubt dem Gastgeber, seine Gastwirtschaft zu betreiben und für den Gast da zu sein. Für den Verletzten war sie die Rettung.
—

Dr. Johannes Krug, Superintendent im Evangelischen Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf, Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz.
Bild: kaboompics / pixabay
[1] So zu Recht Kerstin Menzel: Zeugnis und Dienst im Sozialraum. Sakralraumtransformationen in ländlichen Räumen (Ost-)Deutschlands, S. 42-64, hier: S. 59f.
[2] Jan Hermelink: Programm und Praxis kirchlicher Inklusion, in: Kerstin Menzel / Alexander Deeg (Hg.), Diakonische Kirchen(um)nutzung (Sakralraumtransformationen 2), Münster 2023, S. 95-111, hier S. 99ff.
[3] Das Bundesgesetzbuch (§ 701 I BGB) spricht von Gastwirtschaft, wo Gäste gewerbsmäßig zur Beherbergung aufgenommen werden. Anregungen zum folgenden verdanke ich Johann Pock: Das Gasthaus – ein Ort der Seelsorge und ein Lernort für die Kirche, in: Diakonia 44/1 (2013), S. 2-7.
[4] Birgit Hoyer: Kirche als Gasthaus, in: Diakonia 44/1 (2013), S. 14-21, hier: S. 14.