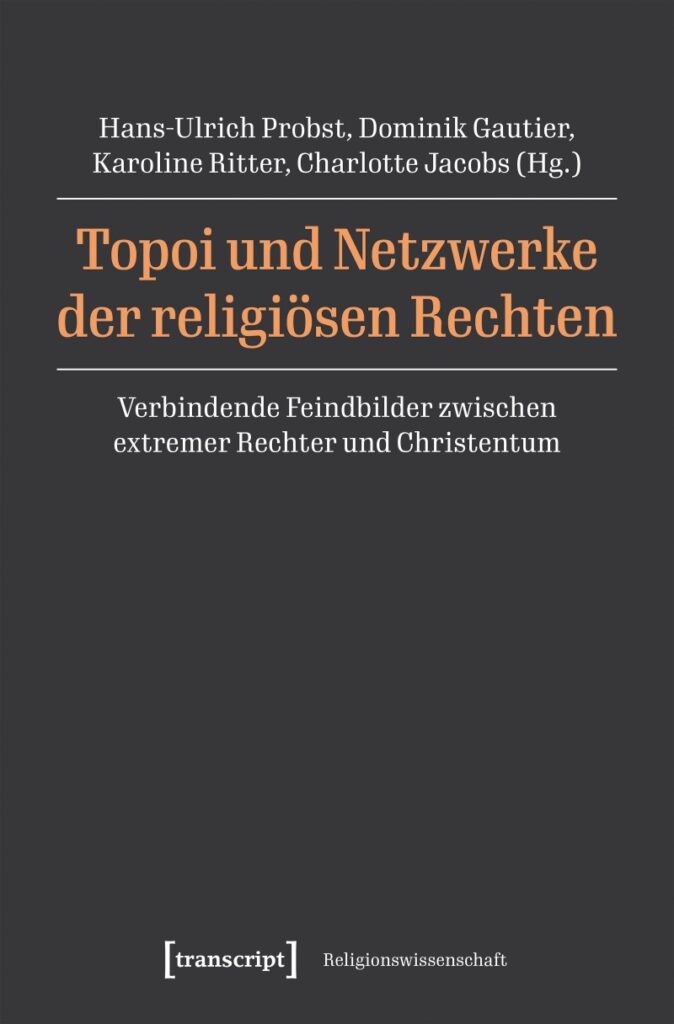Der Instrumentalisierung des Christentums in extrem rechten Gruppierungen geht Matthis Glatzel mit einer Betrachtung des Sammelbandes „Topoi und Netzwerke der religiösen Rechten“ nach.
Nationalismus ist Sünde. Das meinte vor einigen Jahren Heinrich Bedford-Strohm.[1] Flankiert wurde diese Einschätzung durch den Münchner Kardinal Marx, der einen Widerspruch zwischen einer AfD-Anhängerschaft und einer Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche postulierte.[2] Längst müssen sich beide Großkirchen fragen, wie sie sich zur zunehmenden gesellschaftlichen Polarisierung und dem Erfolg der extremen Rechten verhalten sollen. Tatsächlich wird von Vertreter:innen der AfD und der sogenannten Neuen Rechten dezidiert versucht auf theologische Themen auszugreifen, um ein potenzielles Wähler:innenmilieu anzusprechen. Ein prominentes Beispiel der jüngsten Vergangenheit ist Alice Weidels Rede am 23.12.2024 anlässlich des schrecklichen Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Explizit spricht sie ihre Zuhörer:innen als „Christen“[3] an, um im Sinne des Freund-Feind-Schemas eine Wir-Gruppe gegen ein feindliches Außen zu konstruieren. Die Bestimmung dessen, was christlich ist, scheint doch wesentlich ein Interessensgegenstand der Theologie zu sein. Um die These zu verteidigen, das Christentum befinde sich vornehmlich auf der rechten Seite des politischen Spektrums, versuchen sich Vertreter:innen der extremen Rechten mitunter an eigenen ‚theologischen‘ Gehversuchen. In zwei programmatischen Sammelbänden aus den Jahr 2018 und 2019, die unter anderem durch Volker Münz, Mitglied der AfD und des Deutschen Bundestages herausgegeben wurden, wird eine Klärung dessen beansprucht, was unter einem ‚Rechten Christentum‘ verstanden werden kann. Durch Fußnotenapparat suggerieren die Bände dabei die Gestalt einer akademischen Auseinandersetzung. Gerade weil empirische Erhebungen zeigen, dass die AfD unter Kirchenmitgliedern durchaus ein Wählerpotenzial hat und es sich mit der Verschränkung von Christentum und extremer Rechter demnach keineswegs um ein Randphänomen handelt, braucht es zwingend eine inhaltliche Auseinandersetzung. Erst auf Basis eines Verständnisses von Strukturen und Codes wird eine reflektierte Auseinandersetzung möglich.
Bislang wurde die beschriebene Gemengelage nur anfänglich untersucht. Für den Bereich der katholischen Theologie sind hier vor allem die Arbeiten Sonja Angelika Strubes hervorzuheben.[4] Für die evangelische Konfession sind vor allem der Band der EKD[5] als auch zwei durch unter anderem Torsten Meireis[6] und Johann Hinrich Claussen[7] herausgegebene Bände einschlägig. Deutlich wird, dass dieses noch recht junge Phänomen längst nicht hinreichend untersucht ist. Der dieses Jahr im transcript-Verlag frisch erschiene Band Topoi und Netzwerke der religiösen Rechten, der auf eine Initiative von Hans-Ulrich Probst, Dominik Gautier, Karoline Ritter und Charlotte Jacobs zurückgeht, weist damit völlig zu Recht auf ein Forschungsdesiderat. Eine Stärke des Bandes ist dabei zweifellos, dass er auch internationale Perspektiven einbezieht. Regina Elsner und Oleg Morozov nehmen etwa die russisch-orthodoxe Kirche in den Blick und zeigen, wie durch die theologische Legitimation des russischen Angriffskrieges der autoritäre Staat auf ein Bündnis mit der Kirche zurückgreifen kann. Laut Oleg Morozov habe die Ablehnung von LGBTQ+-Personen hier eine Art Brückenfunktion, indem diese mit dem westlichen Liberalismus unmittelbar identifiziert werden, und damit die traditionellen Werte eines christlichen Russlands bedrohen und korrumpieren. Dabei werden schließlich auch Symbole zur Zielscheibe, die nichts mehr mit LGBTQ+ zu tun haben.
Soziale Ordnungen als Schöpfungsordnungen Gottes.
Tatsächlich kann der Themenkomplex geschlechtlicher Identität als ein stetig wiederkehrendes Motiv des Bandes bezeichnet werden. So wird er regelmäßig als zentrales Bindeglied zwischen der extremen Rechten und dem Christentum aufgeführt. Astrid Edel und Hans-Ulrich Probst etwa die Zeitschriften Idea und Junge Freiheit und zeigen wie hier die Ideologie des Anti-Genderismus mit einem Kulturpessimismus gegenüber Liberalisierungsschüben vermengt wird. Karoline Ritter und Charlotte Jacobs zeichnen in ihrem Beitrag nach, wie die Bibel in gerechter Sprache und die EKD-Orientierungshilfe zur Familie bereits auf akademischer Ebene für Kontroversen sorgten, die dann im extrem rechten Spektrum Anklang fanden. Der Beitrag zeigt eindrücklich, dass es sich in den theologischen Argumentationen der extremen Rechten nicht ausschließlich um randständige Positionen handelt, sondern sie ihren Ursprung in der akademischen Theologie haben. Auf ähnliche Diskursverflechtungen machen dabei Sarah Jäger und Cynthia Freund-Möller aufmerksam. In Auseinandersetzung mit rechtschristlichen Youtube-Accounts, arbeiten sie heraus, wie hier eine Figur aktualisiert wird, die bereits für die Ordnungstheologie eines Paul Althaus tragend ist: Soziale Ordnungen erhalten ihr biologistisches Fundament, in dem sie als Schöpfungsordnungen Gottes verstanden werden. Diese Figur scheint dem christlich motivierten Anti-Genderismus grundsätzlich Pate zu stehen. Die internationale Perspektive kann weiterführend auf vielfältige Vernetzungen aufmerksam machen. Maria Hinsenkamp verdeutlicht dies zum Beispiel an der engen Verstrickung rechtspopulistischer und evangelikaler Akteure in den USA und Fatih Bahadir Kayas macht deutlich, wie stark der Kontakt zwischen dem Hanau-Attentäter mit den Knights Templar aus den USA war, die unter anderem auf Justin Bieber als ihre Gallionsfigur verweisen können. Ausgehend von dieser ‚Kreuzzugsmentalität‘ werde ein überhistorisches weißes Christentum konstruiert, dass sich im apokalyptischen Endkampf mit dem Islam befinde. Dies führt schließlich zu einem weiteren Themenkomplex des Bandes: Das Christentum als rechter Identitätsmarker. Auf die gleiche Weise greift auch Alice Weidel in der bereits angesprochenen Rede auf das Christentum zurück.
Kulturpessimistische Kritik
an einem Beichtriutal gegenüber Pflanzen
Die Stärke des Bandes erweist sich in seiner empirischen Analyse der vielfältigen Vernetzungen der extremen Rechten und eines vornehmlich konservativen bis evangelikalen Christentums. Im Zuge der Dominanz der empirischen Perspektive, kommt die theologische Auseinandersetzung jedoch stellenweise zu kurz. Dies wird besonders im Beitrag Dominik Gautiers deutlich, der sich mit der ablehnenden Haltung evangelikaler Christ:innen gegenüber ökologischen Fragen in den USA auseinandersetzt. Konkret fand im September 2019 am Union Theological Seminary in New York ein Gottesdienst statt, in dem ein Beichtritual gegenüber Pflanzen im Mittelpunkt stand. Dieses Ritual wurde vor allem von evangelikaler Seite scharf kritisiert. Gautier asssoziiert nun den Vorwurf des Paganismus, Pantheismus und Animismus mit einer „kolonialen Konnotation“ (S. 89). Im Hintergrund steht nach Gautier ein aufklärerischer Dualismus, der Mensch und Natur in ein Herrschaftsverhältnis stellt. Dagegen veranschlagt er ein inklusives Mensch-Natur-Verhältnis wie es etwa von Donna Haraway und Rosi Braidotti entwickelte wurde. Tatsächlich blieb diese scharfe Gegenüberstellung von Mensch und Natur jedoch bereits innerhalb der westlichen Philosophie keineswegs unwidersprochen. Gleichzeitig gibt es begründete Einwände für die gedankliche Trennung von Mensch und Natur, etwa um den Menschen als handelndes Subjekt ernst zu nehmen, das nur so seiner Verantwortung für die Klimakatastrophe gerecht werden kann. Damit soll Gautiers These, dass die Kritik am Beichtritual kulturpessimistisch motiviert ist, keineswegs widersprochen werden, allerdings braucht es in der Beschäftigung mit der christlichen extremen Rechten auch eine konzise theoretische Auseinandersetzung, die dualistische Weltbilder nicht pauschal als kolonialistisch und rassistisch aburteilt.
Inklusives Mensch-Natur-Verständnis
Inhalt der theoretischen Auseinandersetzung müsste weitergehend auch der hermeneutische Umgang mit den biblischen Schriften sein. Gautier bezieht sich auf den Alttestamentler Bernd Janowski, der die Auffassung vertritt, dass ein inklusives Mensch-Natur-Verhältnis gerade in Kontinuität zum biblischen Schöpfungsglauben steht. Gautier hält damit die extrem rechte Kritik am Ritual für widerlegt. Ähnlich verweist auch Jan-Hendrik Herbst in Auseinandersetzung mit der Bibelrezeption der christlichen Rechten auf einem exegetischen Befund. In einem exegetisch hochinformierten Beitrag setzt er sich insbesondere mit Thomas Wawerkas und Beatrix von Storchs Rezeption des barmherzigen Samariters auseinander. Auf Basis der exegetischen Forschung hält auch er die rechtschristliche Bibelrezeption für widerlegt. Gleichzeitig verweist Herbst auf das Problem einer „bibelhermeneutische Grenze“ (S. 385) und geht der Frage nach, wie sich Reserven gegenüber einer Position begründen lassen, die auf Basis einer verbalinspirierten Hermeneutik homophobe Argumentationen durch die Bibel begründet sieht. Dabei zeigt Karoline Ritters und Charlotte Jacobs Beitrag, dass die exegetische Forschung erhebliche Widerstände gegen feministische und emanzipatorische Projekte formierte. Der schlichte Verweis auf die akademische Theologie kann daher nicht die alleinige Lösung sein, denn das was sich heutzutage als ‚extrem rechtes Christentum‘ bezeichnen ließe, war mindestens in der Vergangenheit selbst Teil der akademischen Theologie.
Aufgabe der Selbstvergewisserung des Christentums
Der berühmte und intensiv rezipierte evangelische Theologe Wolfhart Pannenberg gab 1997 sein Bundesverdienstkreuz zurück, nachdem Herta Leistner, Vorkämpferin für die Rechte von Frauen und Lesben, dasselbige ein Jahr vorher erhalten hatte.[8] Der katholische Philosoph Robert Spaemann verfasste sogar einen Artikel für das extreme Rechte Publikationsorgan Sezession, das damals durch den rechtsintellektuellen Karlheinz Weißmann herausgegeben wurde.[9] Ein Umgang mit der extremen Rechten muss demnach auch eine Aufgabe der Selbstvergewisserung des Christentums sein. Es braucht eine Klärung der Frage, wie weit religiöse und politische Pluralität gehen darf. Weiterführend benötigt es eine Klärung der roten Linien und – vor allem – eine Klärung ihrer Begründung. Die Entwicklung von Argumentationsstrategien stellt damit eine bedeutsame der gegenwärtigen akademischen Theologie dar. Eine solche Arbeit kommt nicht ohne eine dezidierte Kenntnis des Gegenstands aus. Zur Aufarbeitung dieses Feldes hat der besprochene Sammelband, so sei abschließend würdigend hervorgehoben, einen wichtigen Beitrag geleistet.
___

Matthis Glatzel, Studium der Philosophie und Theologie in Mainz, Frankfurt und Leipzig, von Oktober 2021 – März 2025 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Graduiertenkolleg „Modell Romantik“ und ab April 2025 Assistent am Lehrstuhl für Praktische Theologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Titelbild: Etienne Giradet / unsplash.com
[1] Bedford-Strohm, Heinrich: „Warum Nationalismus Sünde ist“ (https://www.ekd.de/Heinrich-Bedford-Strohm-Rechtspopulismus-19449.htm, Zugriff am 06.01.2025)
[2] Kaiser, Markus: „Münchner Kardinal Marx: Keine Kirchenämter für AfD-Anhänger“ In: BR 24. (https://www.br.de/nachrichten/bayern/muenchner-kardinal-marx-keine-kirchenaemter-fuer-afd-anhaenger,Tx7IYxN, Zugriff am 06.01.2025)
[3] AfD TV (2024): „Gänsehaut pur bei dieser Rede! – AfD – Livemitschnitt Alice Weidel Magdeburg.“ (https://www.youtube.com/watch?v=ZjzXYnb1Qdg, Zugriff am 03.01.2025)
[4] Strube, Sonja Angelika (Hrsg.): „Rechtsextremismus als Herausforderung für die Theologie“, Freiburg/Basel/Wien 2015; Dies.: „Rechte Versuchung. Bekenntnisfall für das Christentum“, Freiburg/Basel/Wien 2024.
[5] EKD: „Zwischen Nächstenliebe und Abgrenzung. Eine interdisziplinäre Studie zu Kirche und politischer Kultur“, Leipzig 2022.
[6] Höhne, Florian/Meireis Torsten: Religion and neo-nationalism in Europe, Baden-Baden 2020.
[7] Claussen, Johann Hinrich/Fritz, Martin/Kubik, Andreas/Leonhardt, Rochus/Scheliha, Arnulf von: „Christentum von Rechts“, Tübingen 2021.
[8] Vgl. Bundesministerium des Inneren (1997): BT-Drucksache 13/7221. (https://dip.bundestag.de/vorgang/bundesverdienstkreuzverleihung-an-frau-dr-herta-leistner-g-sig-13012327/125444?f.deskriptor=Verdienstorden%20der%20Bundesrepublik%20Deutschland&rows=25&pos=3&ctx=a, Zugriff am 03.01.2025)
[9] Vgl. Spaemann, Robert (2006): „Wer ist ein gebildeter Mensch?“ In: Sezession 15. (https://sezession.de/4751/wer-ist-ein-gebildeter-mensch, Zugriff am 03.01.2025)