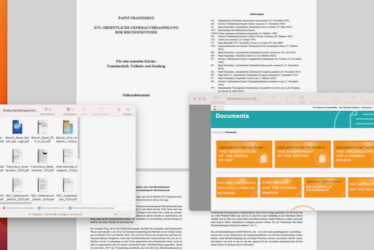Der 11. Februar ist der „Tag der Frauen in der Wissenschaft“. Anlässlich dieses Tages reflektieren Julia Enxing und Martina Bär darüber, was es heißt „Frau in der Wissenschaft“ – genauer „in der theologischen Wissenschaft“ – zu sein.
Bereits die Schlange vor der Toilette irritiert. Nicht, weil sie nicht lang wäre und nervig, nicht, weil die Menschen, die darin stehen, sich etwas unbeholfen im Smalltalk üben, von einem Bein aufs andere steigen, nicht, weil sie nicht das Bild einer typischen Warteschlange vor einer Toilette abgeben würden. Nein. Sondern, weil sie nicht vor der Frauen-, sondern vor der Männertoilette ist, diese Schlange.
Wir befinden uns auf einer theologischen Fachkonferenz im klassischen Setting eines katholischen Bildungshauses. Nebenbei: Von All Gender-Toiletten ist nur zu träumen. Vermutlich glaubt man dort noch, dass sich das eh nicht durchsetzen wird, das mit der Gesellschaft und der Kritik an einer binären Heteronormativität. So, wie man bis in die 2000er noch katholische Bildungshäuser ohne WLAN eröffnete, weil: das mit dem Internet, das setzt sich eh nicht durch. In Cafés, in Theatern, bei Kleinkunstbühnen, Museen, an der Uni und in Bars sind sie bereits – die All Gender-Toiletten. Nicht jedoch dort, wo der Standard männlich ist. Und das ist er in solchen Locations, an denen theologische Fachkonferenzen oft stattfinden.
Kritik an einer binären Heteronormativität
Neben der WC-Schlangen-Phänomenologie gibt es noch einen zweiten unverkennbaren Marker für Tagungen der wissenschaftlichen Theologie: es sind anthrazitfarbene Tagungen. Wer aus der Masse hervorstechen will, der trägt Dunkelblau. Die ganz Verwegenen Royalblau. Krass. Ein Statement. Ansonsten gibt es einen unausgesprochenen Dresscode und der lautet: Assimilieren. Nicht auffallen. Anpassen. Und das macht es ja auch irgendwie leicht – weißes Hemd, dunkler Anzug. Die Modernen tragen die in jedem Herrenbekleidungsgeschäft seit ein paar Jahren durch die Schaufenster geisternden weißen Hemden mit den farbig (einfarbig! dunkel!) abgesetzten Knopfleisten. Dazwischen erspäht man – immer seltener – ein paar Collarhemden.
Wir Frauen, die ausnahmsweise mal nicht in der WC-Schlange-Anstehenden, wir sind hier vor allem eins: wenige. Noch immer die Ausnahme. Noch immer beäugt, kommentiert, hinterfragt.
Noch immer die Ausnahme. Noch immer beäugt, kommentiert, hinterfragt.
Mit den 19% Professorinnen (jede 5. Professur ist mit einer Frau besetzt) – im Jahr 2021, bei der letzten Erhebung – steht die katholische Theologie schlechter dar als der Durchschnitt der Universitätsdisziplinen, bei denen im selben Jahr 27% aller Professuren (also jede vierte) mit einer Frau besetzt waren. Damit gilt: „An deutschen Hochschulen allgemein ist der Anteil der Frauen an der Professor*innenschaft mit 25% deutlich höher. In der Gruppe der Geisteswissenschaften liegt der Frauenanteil mit 38% sogar doppelt so hoch wie in der Katholischen Theologie.“[1]
nur 17% Frauen an staatlichen Fakultäten
Weiterhin gilt es hier zu differenzieren: Es ist nämlich nicht so, dass die 19% gleichmäßig auf alle theologischen Wissenschaftsstandorte verteilt wären. Von allen 59 Professorinnen sind lediglich 17% an staatlichen Fakultäten, 8% an kirchlichen und 31% an nichtfakultären Einrichtungen (sprich: i. d. R. katholisch-theologischen Instituten, die sich auf die Ausbildung katholischer Religionslehrer:innen und damit jener Berufsgruppe spezialisiert haben, die ihre Zukunft nur in den allerwenigsten Fällen in der Wissenschaft und Forschung sehen).[2] Interessant wäre dabei auch noch die Verteilung hinsichtlich der W2- zu den höher dotierten und besser ausgestatteten, ressourcenstärkeren W3-Lehrstühlen. Ob W2 oder W3: Wir wissen um den Gender Pay Gap – auch in der Wissenschaft.[3] „Auffällig deutlich hingegen ist der Gender Pay Gap in W3. Dort liegt er immerhin im Monat bei durchschnittlich 660 Euro brutto. Auch wenn man hier die unterschiedliche Verteilung von Familienzuschlägen auf die Geschlechter und Fachspezifika ins Kalkül einbezieht, spricht immer noch einiges dafür, dass ein Teil dieser Differenz am Geschlecht der Professorin bzw. des Professors festzumachen ist.“[4]
Gender Pay Gap – auch in der Wissenschaft.
Warum aber gibt es weniger Professorinnen in der Katholischer Theologie? Eine Antwort kennt die oben bereits zitierte Studie von Emunds über den wissenschaftlichen Nachwuchs in der Theologie aus dem Jahr 2021. Sie redet von einem ausgeprägten Gender Graduation Gap in der Katholischen Theologie. Viele Katholische Theologinnen schließen ihre Promotion gar nicht oder erst nach besonders langer Zeit ab. Nur 26% der angestrebten Promotionen von Frauen erreichen ihr Ziel, das entspricht etwa einem Viertel der Gesamtzahl (von 505 Promovierten waren 132 Personen weiblich).[5] Dieses „Frauen-Viertel“ ist allerdings im Vergleich mit dem Anteil der frisch promovierten Frauen in allen Fächern Deutschlands (45%) und vor allem in den Geisteswissenschaften (56%) sehr niedrig. Anders gesagt: Die Wahrscheinlichkeit, eine Promotion erfolgreich abzuschließen, ist bei Doktoranden um gut zwei Drittel höher (56%) als bei Doktorandinnen (31%).
Gender Graduation Gap in der Katholischen Theologie
Auch die Abbruchs- oder Aufschubquote ist bei Habilitandinnen eklatant hoch: 17 der 27 Theologinnen (das sind 63%), die 2016 eine Habilitation anzielten, haben das Projekt abgebrochen oder den Abschluss aufgeschoben.[6] So liegt der Anteil bei den Habilitationen von Frauen nur noch bei 13%; zwischen 2006 und 2016 haben noch zwischen 20% und 29% der Habilitandinnen diese Qualifikationsstufe absolviert. „Von einem Aufholprozess der Katholischen Theologie in Richtung Gendergerechtigkeit kann bei den Habilitationen also nicht die Rede sein. (…) Der unerwartet starke Rückgang bei den frisch habilitierten katholischen Theologinnen wird zweifellos die aktuellen bzw. bevorstehenden Berufungsverfahren beeinflussen.“[7]
Dieser Gender Graduation Gap wird folglich wiederum in dem „besonders niedrigen Frauenanteil in den Professorien (19%)“ sichtbar. Der Verfasser der Studie, Bernhard Emunds, mutmaßt, dass es in der Katholischen Theologie fachspezifische Probleme geben könnte, die dafür verantwortlich sind, dass das Promotionsstudium nicht zügig und erfolgreich beendet werden kann.[8] Er vermutet, dass sowohl die Säkularisierungsprozesse als auch die massive Kirchenkrise der letzten Jahre Gründe dafür sein könnte. Viele Frauen sind enttäuscht von der mangelnden Reformwilligkeit der Katholischen Kirche, insbesondere in punkto Gleichstellung auf allen hierarchischen Ebenen der Kirche, und sehen keinen Sinn mehr darin, als Frau einen Karriereweg in der Katholischen Theologie einzuschlagen. Eine neue, derzeit online aufrufbare empirische Umfrage der Deutschen Bischofskonferenz soll nun die Ursachen für die Abbruchszahlen und langen Bearbeitungszeiten für Qualifikationsarbeiten klären.[9]
Gender Citation Gap und Matilda-Effekt
Neben den fachspezifischen Gerechtigkeitsdefiziten sind Katholische Theologinnen auf der Ebene der Wissenschaft mit dem sogenannten Matilda-Effekt konfrontiert: Der Matilda-Effekt, der benannt ist nach seiner „Entdeckerin“, der Wissenschaftshistorikerin Matilda J. Gage, steht für die systematische Minderbeachtung akademischer Leistungen von Frauen. Zahlreiche Untersuchungen belegen inzwischen, dass die von Frauen produzierte wissenschaftliche Forschung weniger Aufmerksamkeit und Anerkennung in der Scientific Community erfahren. Besonders brisant ist der Gender Citation Gap, wonach Wissenschaftlerinnen weniger häufig zitiert werden als ihre männlichen Kollegen, was sich unmittelbar auf die Karrierechancen und Reputation auswirken sowie für leistungsorientierte Frauen demotivierend wirken kann. Eine Studie von AGENDA – Forum katholischer Theologinnen e. V. hat die Auswirkungen dieses Matilda-Effekts mit der Unterrepräsentanz von wissenschaftlichen Artikeln von katholischen Theologinnen sichtbar gemacht. Die 2021 veröffentlichte Studie wies auf, dass der Anteil der Autorinnen in Fachpublikationen im deutschsprachigen Raum bei 18 Prozent lag.[10] Auch zeigte die Untersuchung, dass Theologinnen bei wissenschaftlichen Veranstaltungen im Verhältnis von 21 zu 79 Prozent weniger oft als Referentinnen eingeladen werden.
Diskriminierende Erfahrungen werden auch beim letzten Schritt auf der Karriereleiter gemacht, wenn nach einem erteilten Ruf seitens der Universität das Verfahren zur Beantragung der kirchlichen Lehrerlaubnis, das Nihil obstat-Verfahren, in Gang kommt. Hier erhalten Frauen deutlich öfter Nachfragen oder Beanstandungen durch Rom, so dass sich die intransparenten Verfahren möglicherweise über einen längeren Zeitraum hinziehen können.[11] Auch das Wissen darum wirkt hemmend.
Solidarität unter Frauen? Kein Selbstläufer.
Nun könnte man meinen, dass unter den katholischen Theologinnen bei so viel struktureller und intersektionaler Diskriminierung eine große Solidarität herrscht, so dass mithilfe von Frauen-Netzwerken analog zu der bekannten Seilschaft-Logik von Männern einander Brücken gebaut werden. Doch das täuscht. Die gemeinsame multiple, intersektionale Diskriminierungserfahrung – berücksichtigt man zudem die soziale Diskriminierung von Frauen – führt nicht automatisch zu einer solidarischen, unterstützenden Haltung. Immer wieder stehen Frauen aufgrund des eigenen harten Kampfes um Anerkennung und Reputation anderen Frauen im Wege.
Theorie Praxis Gap – wer will schon „wissenschaftlicher Nachwuchs“ sein?
Und doch besteht Hoffnung: Bei den jüngeren Frauen bzw. weiblich gelesene Personen sind immer weniger bereit, sich zu assimilieren. Sie emanzipieren sich: Sie wollen kein „wissenschaftlicher Nachwuchs“ sein und auch keine „Assistentinnen“, wollen keinen „Doktorvater“ haben und auch keine „Doktormutter“. Sie wollen überhaupt keine „Doktoreltern“ haben.[12] Sie wollen als die gesehen werden, die sie sind: eigenständige Personen und Wissenschaftlerinnen. Es liegt an den Etablierten, diese Irritation, die hier endlich stärker artikuliert wird, nun nicht – nur, weil man es im Kontrast zum eigenen Erfahrungs- und Erlebnishorizont in dieser Lebensphase erlebt – bereits im Keim zu ersticken. Gerade vor dem Hintergrund, dass Theologieprofessorinnen erfahrungsgemäß mehr Klinken geputzt haben, muss hier die Gefahr erkannt werden, die eigenen Mitarbeiter:innen nicht durch die gleiche „harte Schule“ gehen zu lassen. Es anders zu machen, hat nichts mit einer Gönnerhaftigkeit zu tun, sondern mit der Überzeugung, dass es das Wagnis wert ist. Mit der Überzeugung, dass wir nicht nur zu den Themen Macht, Ungerechtigkeit und Missbrauch tagen und publizieren dürfen, sondern es hier – ganz offensichtlich – einen Theorie Praxis Gap zu überwinden gilt. Ist das einfach? Nein. Ist das bequem? Nein. Werde ich dadurch eigene Nachteile in Kauf nehmen müssen? Ja. Und dennoch: Will die akademische Theologie eine Zukunft haben und im Gesamt des universitären Kontextes und der dort präsenten Fächervielfalt überhaupt noch ernst genommen werden, so wäre es unserer Meinung nach an der Zeit, Energie eher in die Selbsthinterfragung als in die Selbsterhaltung zu stecken. Vielleicht ergibt sich das eine dann ganz von alleine aus dem anderen.
Autorinnen:

Julia Enxing ist Professorin für Fundamentaltheologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. Sie ist 2. Vorsitzende von AGENDA – Forum katholischer Theologinnen e. V. und Redaktionsmitglied von feinschwarz.net.

Martina Bär ist Professorin für Fundamentaltheologie und Leiterin des Instituts für Systematische Theologie und Liturgiewissenschaft der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Graz. Dort ist sie Sprecherin des Forschungsschwerpunktes „Theologische Frauen- und Geschlechterforschung“. Sie ist Vorsitzende von AGENDA – Forum katholischer Theologinnen e. V.
Beitragsbild: David Rotimi, unsplash.com
[1] Bernhard Emunds/Marius Retka: Zur Lage des wissenschaftlichen Nachwuchses in der deutschsprachigen Katholischen Theologie, in: Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften, 63. Band/2022, S. 331–380, hier S. 339, online unter: https://www.uni-muenster.de/Ejournals/index.php/jcsw/article/view/4420/4589
[2] https://www.uni-muenster.de/Ejournals/index.php/jcsw/article/view/4420/4589 (S. 338)
[3] https://www.forschung-und-lehre.de/karriere/professur/der-gender-pay-gap-bei-den-professoren-5843 (abgerufen am 09.12.2024)
[4] Hubert Detmer: Der Gender-Pay-Gap bei Professuren muss auf den Prüfstand, in: Forschung & Lehre (21.08.2023), online unter: https://www.forschung-und-lehre.de/karriere/professur/der-gender-pay-gap-bei-den-professoren-5843 (abgerufen am 09.12.2024)
[5] Emunds/Retka, Wissenschaftlicher Nachwuchs, S.31.
[6] Ebd., S. 36.
[7] Ebd., S. 35.
[8] Emunds, Wissenschaftlicher Nachwuchs, S.23.
[9] Studie: Bearbeitungszeiten und Abbruchgründen von Qualifikationsarbeiten – Ruhr-Universität Bochum
[10] Vgl. Studie „Frauen in theologischer Wissenschaft – Eine Untersuchung der Repräsentanz von Frauen in theologischen Zeitschriften und auf Tagungen theologischer Arbeitsgemeinschaften im Auftrag von AGENDA – Forum katholischer Theologinnen e. V.“, 2021, online unter Studie „Frauen in theologischer Wissenschaft“ (abgerufen am 28.01.2025).
[11] Zentrum für angewandte Pastoralforschung Bochum, Nihil obstat: Verfahren und Auswirkungen. Ergebnisse einer Umfrage der Theologieprofessor:innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, PowerPoint-Präsentation.
[12] Vgl. Positionspapier der Bundeskonferenz der wiss. Assistentinnen und Assistenten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Katholische Theologie (BAM) zur Situation des akademischen Mittelbaus in der Theologie (22.02.2021), online unter: https://www.katholische-theologie.info/Portals/0/institutionen/zusammenschluesse/BAM/Situation%20des%20wissenschaftlichen%20Mittelbaus%20(Beschlussfassung%20Januar%202021).pdf?ver=xbxGyl_E5wLlgkFyIbPbxg%3d%3d (abgerufen am 25.01.2025)