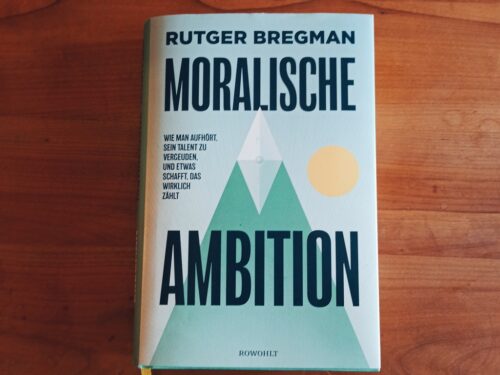Maria Purkarthofer hat Rutger Bregmans Buch „Moralische Ambition“ gelesen, das dazu aufruft sich für andere zu engagieren, entsprechend der je eigenen Talente und mit dem notwendigen Pragmatismus.
Das Buch „Moralische Ambition“ von Rutger Bregman[1] ist in jedem Fall lesenswert! Jetzt klinge ich vielleicht wie eine Thalia Ankündigung. Aber im Ernst: Ich habe es zu Weihnachten geschenkt bekommen und erstmal nicht lesen können, da mein Neffe (Mitte 20) es in die Finger bekam. Er hat beinahe bei uns übernachtet, weil er es nicht mehr aus den Händen legen wollte – auch die Gen Z begeistert es. Seitdem postet er regelmäßig gesellschaftspolitische Themen in seinem WhatsApp Status. Rutger Bregman stellt in dem Buch die Frage, wie man aufhört sein Talent zu vergeuden, und etwas schafft, das wirklich zählt – so auch der Untertitel. Nicht nur wenn ich es als Theologin lese, fühle ich mich oft angesprochen und zugleich irritiert, hinterfrage mich und die Theologie – mit einigen Aha-Effekten.
Die große Kunst von Bregman besteht darin, mit Narrativen zu arbeiten. Im Grunde erzählt er eine Geschichte nach der anderen (als Historiker ist das recht integer) und erläutert dabei jeweils, wie diese Personen mit ihrem kompetenten Handeln und ihrer konkreten Performance einen großen Impact erreichen konnten. Dabei wird auch deutlich, dass nicht immer zwingend gute Absichten auch zu gutem Handeln führen. Diese Erkenntnis ist nichts Neues, jedoch deckt er bislang oft übersehene Illusionen[2] und blinde Flecken im Blick auf gesellschaftliche Veränderungen auf, denen auch Theolog:innen immer wieder aufsitzen.
Was wenn das gesellschaftliche Engagement nicht die gewünschten positiven Effekte zeigt?
Ein bekanntes Beispiel ist die Frage nach Investitionen in Fairtrade Produkte, wodurch leider oft nicht der gewollte positive Effekt für die Betroffenen generiert wird. Ist hier Engagement und Geld falsch eingesetzt? Sollten wir es doch lieber bleibenlassen, da es eh nichts bringt? Weit gefehlt! Die Kunst, so Bregman, besteht darin, herauszufinden, wie wir mit unserem jeweiligen Talent die größtmögliche Wirksamkeit erreichen können, aber nicht Wirksamkeit für irgendwen, sondern für die, die marginalisiert sind, die auf Grund sozio-ökonomischer Faktoren ausgeschlossen sind von Teilhabe, die schlichtweg darum bangen, morgen noch ihre Familie ernähren zu können oder ihr Kind am Leben zu halten.
Dabei wird es immer herausfordernder, angesichts von Fake News, Komplexität der globalen Verstrickungen, intransparenten Machtinteressen etc. den Überblick zu behalten. Bregman verweist an dieser Stelle auf unterschiedliche Projekte und Vereine[3], die es sich zur Aufgabe gemacht haben, hier zuverlässige Orientierung zu geben. Die Lektüre des Buchs ermutigt: Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, nur wissen, wer uns sagen kann, wie es sich dreht. Und wenn das passende Projekt, die konkrete Problemstelle gefunden ist, dann gilt es sich nicht von der Ansicht lähmen lassen, dass es ja im letzten doch unmöglich zu lösen und erfolgreich abzuschließen ist. Etwa den Kampf gegen Malaria oder Wurmbefall zu gewinnen. Denn Erfolge von Bildungskampagnen hängen nicht zuletzt an erfolgreichen Entwurmungskuren. Es kommen schlichtweg keine oder wenig Kinder in so manche mit viel Engagement aufgebaute und unterstützte Klasse, da sie aufgrund von Wurmbefall dauerhaft krank sind. Und da zeigt sich ein weiteres Problem: Lieber finanziert man Bildungsmaterial und Lehrer:innen als Kuren gegen Würmer. Oder wo würden Sie sich stärker hingezogen fühlen: zu prestigeträchtigen Programmen oder zur nackten, unangenehmen Armut?
Wie ansehnlich bzw. angesehen muss der Zweck des Enagements sein?
Neben der Frage nach dem Was und Wo tritt häufig die Verzagtheit allein ohnehin nichts ausrichten zu können. Dabei ist es, das zeigt Bregman, erstaunlicherweise recht einfach, Menschen zur Mithilfe für ein gutes Engagement zu erreichen. Schon bei Charles Eisenstein findet sich die Idee, die sich über Jahrhunderte und über Kulturen hinweg durchzieht: Grundsätzlich ist jeder Mensch gerne Teil eines gemeinsamen Projektes, das durch das eigene Engagement mit einem kleinen Beitrag am Ende zu diesem großen Ganzen werden kann.[4] Als Beispiel dafür führt Bregman Untersuchungen aus der Zeit des NS-Regimes an und fragt: Was einte die Menschen, die bereit waren Jüdinnen und Juden zu verstecken und dafür ein hohes Risiko einzugehen? Sein Ergebnis, das auf den ersten Blick erstaunt: Es braucht keine Gruppe von höchst altruistisch geprägten Menschen, die spezielle Voraussetzungen erfüllen. Es war also keine exklusive Bubble der Helfer:innen, wenngleich viele der Engagierten anscheinend schon als Kinder einen stark ausgeprägten Willen hatten. Was aber viel wichtiger war bzw. ist: Man musste gefragt werden. In den meisten Fällen gaben die Personen an, dass sie Hilfe geleistet haben, weil sie gefragt und um Hilfe gebeten wurden und dann einfach angefangen haben. Meist ging ihr Engagement weit über das hinaus, was sie sich zu Beginn vorstellen konnten.
Veränderungen brauchen neben Ideen auch eine Menge Pragmatismus
Und ein Drittes gibt Bregman mit auf den Weg: Es ist eine Illusion, dass sich Veränderung mit vermeintlich „reiner Weste“ bewerkstelligen lässt. Den größten Impact erreicht man häufig durch ein Moral Reframing, das Argumente spezifisch gestaltet um das Gegenüber davon zu begeistern. Auch hier wieder ein Beispiel von Bregman: Der Sklav:innenhandel wurde nicht gestoppt, weil von NGOs permanent auf die Unterdrückung der Schwarzen aufmerksam gemacht wurde, sondern weil es gelang, Argumente für die weißen Führungskräfte zu stricken, die sie überzeugten, etwas gegen das große Unrecht tun zu müssen, ganz gleich wie krude diese Argumente vielleicht klingen mochten. Natürlich heiligt nicht der Zweck automatisch die Mittel wenngleich die Mittel und diese müssen immer im ethisch vertretbaren Rahmen bleiben, aber manchmal sind Umwege erfolgreicher als reines Beharren.
Und der Überlebenskampf von Unterdrückten und Marginalisierten geht unvermittelt weiter. Entsprechende Beispiele finden wir in der globalen gesellschaftspolitischen Lage momentan genug. Die Frage, wie man sich nicht entmutigen lässt, die Motivation zum aktiven Engagement findet und zugleich nicht in blinden Aktionismus verfällt, stellen sich viele. Wer Inspiration sucht, kann sich bei der School for Moral Ambition umschauen, die Bregman ins Leben gerufen hat[5]. Ich habe bei Bregman viel für mein theologisches Denken und die Frage nach dessen Aktivismuspotential gelernt. Und vielleicht wollen Sie auch mal Teil einer Geschichte in einem Buch werden – nur Mut, es ist möglich.
—
[1] Bregman, Rutger: Moralische Ambition. Wie man aufhört sein Talent zu vergeuden, und etwas schafft, das wirklich zählt. Hamburg 2024.
[2] s. ebd. S.93-110 – Fünf Mythen darüber, wie Veränderung funktioniert.
[3] https://www.charityentrepreneurship.com, https://www.givewell.org, https://www.givingwhatwecan.org
[4] Eisenstein, Charles: Die schönere Welt, die unser Herz kennt, ist möglich. 2021.
[5] Die Bewegung fußt auf den Grundsätzen: Aktion, Impact, Radikales Mitgefühl, Offenheit, Mitmenschlichkeit, Lebenslust, Durchsetzungsvermögen – https://www.moralambition.eu/de/community

Maria Purkarthofer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Pastoraltheologie und Pastoralpsychologie an der Universität Graz. Sie ist ausgebildete Pastoralreferentin und beschäftigt sich in ihrer Dissertation mit pastoraler Begleitung am Beginn des Lebens inspiriert durch eine Theologie der Geburt.