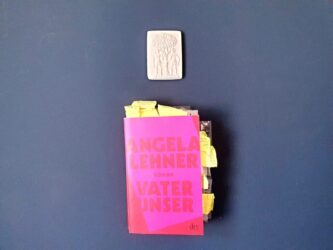Heute startet der 39. Deutsche Evangelische Kirchentag in Hannover. Carlotta Israel legt eine Hoffnungsspur angesichts des Mutigen, Starken und Beherzten dieser Tage.
Der 39. Deutsche Evangelische Kirchentag. Das Meet-and-Greet des deutschen Protestantismus. Oder zumindest eines gewissen Teils. Er gilt in Deutschland als die größte protestantische Lai*innenbewegung. Dabei ist schon zu fragen, was das in einem evangelischen Kontext heißen soll, in dem doch alle Gläubigen bzw. Getauften Priester*innen sind. Diese „größte Lai*innenbewegung“ zeichnet eine gewisse Eigenständigkeit, aber auch enge Verbindung mit Kirchenleitungen aus. Die erste „Deutsche Evangelische Woche“ fand auf Einladung des damaligen Landesbischof Hanns Lilje 1949 in Hannover statt. Dieses Jahr eröffnet mit Ralf Meister ein Landesbischof g*ttesdienstlich den Kirchentag, der für seinen Umgang mit dem Thema Missbrauch in der Kritik steht. (Dem Thema sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch ist eine eigene Podienreihe gewidmet (im PDF-Gesamtprogramm S. 275–279).)
Mutig – stark – beherzt.
Dieses Jahr findet der Kirchentag zum fünften Mal in Hannover statt. „Mutig – stark – beherzt.“ Für meine Kirchentagsohren klingelt beim aktuellen Motto das des Kölner Kirchentags 2007: „lebendig und kräftig und schärfer.“ Wise Guys Ohrwurm. Wer hat ihn noch? Dieses Jahr aber: Mutig, stark, beherzt. Drei paulinische Mahnungen, die jetzt eher wie Wünsche oder vielleicht Selbstermahnungen scheinen. Ich gebe zu, ich verstehe nur bedingt, wie die Losung auf diese einzelnen Worte kondensiert wurde. Ohne den Hinweis auf 1Kor 16,13f. wären wahrscheinlich nur Wenige auf den konkreten biblischen Ursprung des Mottos gestoßen. In 1Kor 16 ist Paulus in der Schlusskurve des Briefs: Er erzählt Reisepläne, grüßt und richtet Grüße aus, und unterzeichnet zum Abschluss eigenhändig den Brief. Dazwischen aber die Ermahnung der Losung: „13 Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark! 14 Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen!“ (Luther 2017)
Dass Demokratie auch hier Verbündete braucht, zeigen viele Veranstaltungen.
„Wachen“ und „im Glauben stehen“ haben es nicht ins Motto geschafft. Dabei wird, wenn der Text in diese Zeit hineingelegt wird, gerade doch aus dem Wachen heraus erst klar, warum es überhaupt Mut braucht. Wachsames, aktives Beobachten und sich Komplexität Aussetzen prägt dennoch diesen Kirchentag als Diskussionsort mit: Rechte Narrative und ihre Einfallstore, zum Beispiel Antifeminismus und Queerfeindlichkeit, werden enttarnt (Programmcodes: MY62/SD93/WJ93 u. ö.). Praktische Argumentationstraining gegen rechts werden mehrfach im Zentrum Kirche „Zwischen Abbruch und Innovation“ (der Name ist aktuelles Krisenfeeling in a nutshell) angeboten (TP68 u. ö.). Die Erkenntnis, wie sehr Demokratie in den USA (WD19) schon zum Spielball geworden ist und dass Demokratie auch hier Verbündete braucht, zeigen viele Veranstaltungen (z. B. GA63/DM36/BP85/MK85/BN48/DF41/XJ22/DC55/FS54 u. ö.). Mariann Edgar Budde, die mit ihren mutigen Predigtworten nach Trumps Amtsantritt Aufsehen erregt hat, tritt in einer Bibelarbeit und einem Gespräch in Erscheinung (FB39, QB51). Wenn das „Wachen“ also nicht genannt wird, findet der Mut so trotzdem einen Bedeutungshorizont.
Alte Bekannte kommen zusammen: Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung.
1983 wurden eindeutige Worte auf einem Hannoveraner Kirchentag formuliert und verbreitet. Die berühmt gewordenen „lila Tücher“ mit der Aufschrift „Die Zeit ist da für ein Nein ohne jedes Ja zu Massenvernichtungswaffen“ knüpfte an den friedensaktivistischen Protest des Hamburger Kirchentags 1981 an und trug ihn weiter. Die Forderung nach Abrüstung bzw. dem Ende einer weiteren Aufrüstung bedeutete im Kalten Krieg einen eigenen Mut, der sich im Nachhinein für jene Zeit als tragfähig erwiesen hat. Polaritäten von damals erleben heute einen erschreckenden neuen Aufguss mit unberechenbaren Herrschern und anderen Formen von Einflussnahme und Bedrängung als damals. Akteur*innen der früheren Friedensbewegungen in beiden deutschen Staaten sind auch dieses Jahr auf dem Kirchentag als Gäst*innen oder Mitwirkende. Dass der Blick auf Militär aktuell voneinander trennt, spiegelt auch der Titel des Podiums „Deutsche Zerrissenheit. Mit Waffen Frieden schaffen?“ (CK42) wider. Ebenso fand die neu aufgekommene Diskussion um die Wehrpflicht Platz im Programm (YB54). Alte Bekannte, die auch schon 1983 auf dem DEKT in Hannover, im Jahr der VI. ÖRK-Vollversammlung in Vancouver, beieinander waren, kommen wieder zusammen: Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung.
… auch an die eigene Nase fassen …
Der ökumenische Konziliare Prozess ist auch 2025 nicht abgeschlossen und dessen Trias weiterhin als Anliegen des Kirchentags erkennbar. Dass diese drei Aspekte einander durchdringen und so auch nicht unabhängig voneinander gelöst werden können, zeichnet sich ebenfalls als flächendeckende Erkenntnis ab (z. B. YY15, LR92, RW28, LL41, DE87). Und trotzdem stellt sich die Frage, wie das Verhältnis zu Protestbewegungen unserer Zeit weitergeht. Vielleicht schafft es der ökumenische G*ttesdienst anlässlich des 1. Mai sogar Brücken zu schlagen. Auf der Kundgebung mit dem DGB wird auch der*m Letzten klar, dass „Gerechtigkeit“ kein Abstraktum ist, sondern Lebens- und Arbeitsbedingungen gemeinsam errungen und gestaltet werden müssen. Dafür wäre auch an die eigene Nase zu fassen wichtig: Wer arbeitet wie für welches oder ohne Geld in kirchlichen Zusammenhängen?
G*tt ist queer.
Eine andere Bewegung: Beim vergangenen Kirchentag in Nürnberg wurde ich Augenzeugin, wie zehn bayrische Polizist*innen beim Abend der Begegnung zwei Besucher*innen, die sich mit der Letzten Generation solidarisierten, umzingelten und einkesselten. Das hat mich schockiert. Aus Quinton Ceasars berühmt gewordener Predigt beim Abschlussg*ttesdienst blieb vor allem „G*tt ist queer“ hängen. Angesichts der hohen Prozentzahlen (mindestens) einer diversitäts- und menschenfeindlichen rechten Partei mit 25% Zuspruch in der Bevölkerung, kann dieser Satz gar nicht laut genug vom letzten Kirchentag herüberschallen. Quinton Ceasar solidarisierte sich in der Predigt aber auch mit der Letzten Generation: „Wir alle sind die Letzte Generation“. Angesichts von Krieg und Gewalt in der Ukraine und in Israel rutscht Klima zu leicht hinten runter, wenngleich auch dieses Jahr die Letzte Generation auf dem Kirchentag zu finden ist (CA13) und bspw. durch digitale Angebote und Pfandgeschirr der Kirchentag auch beim Event selbst Müll eindämmt.
… nationalistische Umbrüche, deren Ausgang ungewiss ist …
Kirchentag. Leute treffen, Bibelarbeit, Musik hören, Andacht feiern, Massenquartier und rund um die Uhr singen (im Programm PDF S. 431–441), neue Gedanken kennenlernen oder bisherige bestätigen beim Diskutieren. Zwischen Bewegung und Institution, „zwischen Abbruch und Innovation“ und zwischen den Zeiten, weil global und lokal enorme nationalistische Umbrüche verlaufen, deren Ausgang ungewiss ist. Mut, Stärke und Liebe/Beherztsein werden definitiv gebraucht. Hoffentlich trägt der Kirchentag in seinen Multiplikator*innen davon etwas weiter – als Bewegung trotz aller Institution. Und bei allem Zurückblicken und Voraus-Angsthaben hoffe ich vor allem, dass dieser Kirchentag nicht eine Momentaufnahme einer im Vergehen begriffenen Phase von Pluralitätsfähigkeit und Progressivität ist, sondern mit dazu beiträgt, dass Demokratie und Menschenfreundlichkeit stärker sind als der gegenwärtig stetig geschürte Hass.

Carlotta Israel ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Kirchengeschichte und Historische Theologie im Institut für Evangelische Theologie und Religionspädagogik an der Universität Oldenburg.
Foto: Heike Roessing
Beitragsbild: Dieses Bild wurde von der Autorin gemeinsam mit ChatGPT erstellt.