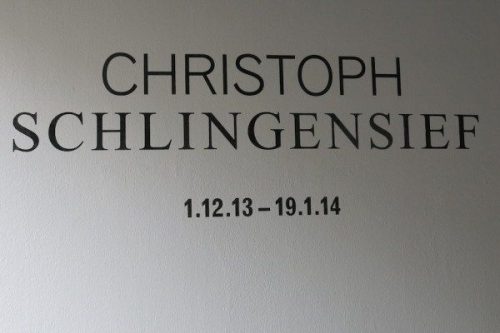Johannes Hoff erinnert an Christoph Schlingensief – ein etwas anderes Totengedenken zu Allerheiligen.
Christoph Schlingensief begann seine Karriere als Ministrant an der Herz-Jesu-Kirche in Oberhausen. Religiöse Motive durchzogen dann auch seine späteren Inszenierungen. Für sein Fluxus-Oratorium „Eine Kirche der Angst vor dem Fremden in mir“ an der Ruhrtriennale 2008 hat er sogar die Kirche seiner Ministrantenzeit nachbauen lassen.
Der preisgekrönte Schlingensief-Pavillon an der Venedig Biennale 2011 rückte diesen Bühnenaufbau ins Zentrum einer postumen unbespielten Installation. So stellte Schlingensiefs Beerdigung in der Oberhausener Herz-Jesus-Kirche am 29. August 2010 den letzten bespielten Akt seiner Performance-Karriere dar. Die versammelte Gemeinde sang vor Christophs Sarg Marienhymnen, dieweil Helge Schneiders abschließendes Orgelspiel die für die meisten seiner alles andere als katholischen Freunde unvertraute Situation auf dem Punkt brachtet: mit einer Mischung aus festlichen Orgelklängen, Schönberg und Wiener Walzer, dieweil der Sarg herausgetragen wurde und ein wenig schwankte.
Spuren einer genuin katholischen Spiritualität?
An den religiösen Motiven in Schlingensiefs Werk scheiden sich die Geister. Sind sie in die Serie modern-avantgardistischer Versuche einzuordnen, die Religion durch Kunst zu beerben? Oder sind sie als Spuren einer genuin katholischen Spiritualität zu lesen, in der die verdrängten religiösen Wurzeln moderner Avantgarde-Kunst authentisch wiederkehren? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Doch die Kompassnadel seines Weges zeigt doch in eine unzweideutige Richtung – das zumindest ist der Eindruck, den unsere Begegnungen und Email Korrespondenzen im letzten Jahr vor seinem Tod in meiner Erinnerung zurückgelassen haben.
Christoph hatte Krebs, und das war für ihn eine spirituelle Herausforderung – ganz so, wie man das aus der Tradition biblischer ‚Nervensägen Gottes‘ kennt. Bei Christoph klang das erst einmal so: „Jesus ist trotzdem nicht da. Und Gott ist auch nicht da. Und die Mutter Maria ist auch nicht da. Es ist alles ganz tot. (…) Die ganze kleinbürgerliche Kacke ist nicht mehr da. (…) Amen.“
„Sonst muss ich kotzen“
Irgendwann im September 2009 begann Christoph seinen Freund Carl Hegemann zu malträtieren. Er brauche einen Priester, mit dem er reden könne, „aber keinen der frommes Zeug sagt! – sonst muss ich kotzen.“ Da hat Carl, ein Ex-Ministrant wie Christoph, über eine gemeinsame Freundin den Kontakt zu mir hergestellt. Ich hatte einen Priester als Gesprächspartner empfohlen. Aber Christoph sagte: „Warum kommt der denn nicht selbst?“
Ich war damals zu einer Vortragsreise in Korea. Mit Unterstützung meiner Gastgeber gelang es mir, die Reiseroute zu ändern, und über London nach Berlin zu reisen. Dort haben wir dann an Christophs Küchentisch den ganzen Tag über Gott und den Tod, Kunst und Spiritualität geredet.
Und natürlich konnte man bei Christoph das Private nicht vom Künstlerischen trennen. Christoph hat vielmehr alles mit seinem Diktiergerät aufgezeichnet und abtippen lassen. Dieses Material hat er dann in seiner nächsten Inszenierung als Improvisationsvorlage genutzt – dem Stück „Sterben lernen“, das zwei Monate später, im November, am Theater Neumarkt in Zürich aufgeführt wurde. Das waren unsere ersten Begegnungen.
Spirituelle Begleitung und künstlerisch-intellektuelle Kooperation
In der folgenden kurzen Zeit unserer Freundschaft war es unmöglich spirituelle Begleitung und künstlerisch-intellektuelle Kooperation voneinander zu trennen. Im Prinzip ist das sogar bis heute so geblieben – obwohl mir zuweilen erst im Nachhinein bewusst wird, wie tief sich unsere Gespräche selbst in meine akademische Publikationen eingeprägt haben.
In Berlin hatte ich Christoph eine PowerPoint-Präsentation über das kontemplative Gebet der Wüstenväter gezeigt, die ich noch von meiner Koreareise im Rucksack hatte. Die hat er sich dann auf seine Festplatte runtergeladen, und in Zürich weiterverwurstet. Vier Monate später, als die Metastasen wieder kehrten, kam Christoph in einer Email auf das Thema meiner PowerPoint-Präsentation zurück.
Es ging um das kontemplative Gebet, und um das, was Meister Eckhart „Gelassenheit“ nannte. Aber das war Christoph natürlich zu abstrakt. Er wollte sich das irgendwie konkret vorstellen, oder genauer: Er wollte wissen, was das kontemplative Gebet mit einem schönen Frauenhintern gemeinsam hat.
Die Griechen nannten das Eros.
Ja, schrieb ich zurück, das ist ein altes Thema. Ein schöner Hintern kann einen rastlos machen. In diesem Fall assoziiert sich der Hintern mit möglichen Welten, mit Tagträumen über künftige oder auch der Erinnerung an vergangene Abenteuer. Die Wüstenväter nannte solche Tagträume ‚Zerstreuung‘: Sie hindern uns daran im hier und jetzt präsent zu sein. Das Gegenteil von Zerstreuung ist Kontemplation: Kontemplation leitet dazu an, im ‚hier und jetzt‘ zu leben; zu staunen über das was da ist, auch und gerade dann, wenn das was uns zum Staunen bringt nur unvollständig sichtbar ist. Die Griechen nannten das Eros.
Christoph fand das einleuchtend, und folgerte draus, dass man sich Jesus endlich mal ästhetisch nähern müsse. In einer späteren Email erzählte er mir dann, er habe sich dazu hinreißen lassen einen viel zu teuren Porzellanjesus von Nymphenburg zu kaufen:
„… dieser jesus ist wunderschön… gaanz lange arme, ganz schmaale lange beine….. alles fast zu lang. und als ich mich fragte, warum ich so einen schritt gegangen bin, kam mir als antwort: ich will mich jesus, der mir immer so fremd war, mit dem ich immer so komische probleme oder eine merkwürdige beziehung hatte, ästhetisch nähern.“
Nicht im Museum, sondern im Gebet
Die erotische Anziehungskraft solcher Objekte hat was mit ihrer Zerbrechlichkeit zu tun. Und im vorliegenden Fall hatte das Objekt seinen vorherbestimmten Platz wiedergefunden: nicht im Museum sondern im Gebet.
In früheren Zeiten, so erklärte ich Christoph, hätten sich Menschen durch solche Objekte zum Gebet hinreißen lassen. Unter dem puritanischen Einfluss von Reformation und Aufklärung hätte wir das dann verlernt: „Es hilft nichts, unserer Knie beugen wir doch nicht mehr“ schrieb Hegel bereits im frühen 19. Jahrhundert. Und doch hat die Aura heiliger Objekte und Orte die Hegelsche ‚Furie des Verschwindens‘ überlebt. Der Geruch von Kapellen, die nach dem Schweiß einsamer Beter riechen, kann selbst post-modernen Nomaden Vertrauen einflößen. Heilige Objekte haben sogar die Kraft, uns Dinge tun zu lassen, die wir als kopfgesteuerte Wesen gar nicht vorhaben – wir müssen uns dem nur öffnen.
Ein magischer Versprecher
In einer späteren Email erzählte mir Christoph von seiner Arbeit im Operndorf in Burkina Faso. Sein Freund Francis Kerée hatte dort drei Wasseradern gefunden, und plötzlich lief alles wie von selbst, „sozusagen wie das Wasser auf dem Operndorfplatz.“ Mit dem Wasser aus der Erde floss nämlich aus Christoph auch ein magischer Versprecher:
„und nun im operndorf erschien mir doch plötzlich wie aus dem nichts der satz: ‚so sprich nur eine wort, so wird meine seele gesund!‘ … ich weiß nicht warum dieser satz für mich genau an diesem ort plötzlich auftauchte. wo ich ihn doch seit jahren nicht mehr richtig gedacht oder erlebt, gefühlt hatte. und plötzlich dachte ich, der ort spricht das wort… der ort ist das wort. aber eigentlich spreche ich zu mir selber. ich spreche ein wort selber und meine seele ist plötzlich geheilt. verstehst du was ich da nicht erklären kann. vielleicht auch gut so, aber es muss da etwas passiert sein. kein wunder, keine offenbarung oder sowas, aber der künstler schlingensief mit seinem beendigungs- und doch immerwieder eröffnungswahn trifft auf gelassenheit.
auf ganz andere kräfte. nichts kann ihn mehr erschüttern, weil dieses wort vielleicht gesprochen wurde“
In meiner Antwort auf Christophs Email habe ich ihm dann erzählt, dass die Wüstenväter und -mütter solche unkontrollierten Versprecher als Mantra gebrauchten. Zum Beten bedarf es nicht vieler Worte; es genügt, dass man ein einziges Wort oder einen einzigen Satz unablässig wiederholt. Und im besten Fall findest Du das Wort nicht – das Wort findest Dich: als ein magisches Wort, das den Beter in die Gegenwart zurückruft, und die Dämonen vertreibt, die dich vom ‚hier und jetzt‘ in die Zerstreuung virtueller Realitäten flüchten lassen.
Hast du eine übung?
„Hast du eine übung? oder wird es sich sowieso ergeben?“ hatte Christoph mich gefragt. Und ich schrieb zurück, es habe sich schon ergeben. Dein Wort hat Dich bereits gefunden, die Übung besteht jetzt darin, es nicht zu vergessen.
Bemerkenswert ist nun, welches Wort Christoph an seinem sprudelnden Ort gefunden hat. Christoph kannte diesen Satz aus seiner Ministrantenzeit. Er wird vor der Kommunion gesprochen, und geht auf die Worte des Hauptmanns von Kafarnaum zurück: „Herr ich bin nicht würdig, dass Du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort so wird meine Seele gesund“.
Die spirituelle Grundhaltung, die aus diesem Worten spricht, ist meines Erachtens charakteristisch für Christophs gesamtes künstlerisches Werk: Es ist die Grundhaltung der Buße und Umkehr, der Metanoia.
Nach Friedrich Nietzsche markiert diese Grundhaltung die Scheidelinie zwischen dem aristokratischen Ethos der Griechen und dem was Nietzsche als jüdisch-christliche Ethik des Ressentiments bezeichnet: „Nur wenn du bereuest, ist Gott dir gnädig‘ – das ist einem Griechen ein Gelächter und ein Ärgernis: er würde sagen ‚so mögen Sklaven empfinden“ – schreibt er in seiner Fröhliche Wissenschaft.
Gebetet und gebeichtet
Christoph hatte keine Probleme mit den peinlichen Gesten und Praktiken von Sklaven und Narren. Auf Christophs Beerdigung in Oberhausen erzählte mir seine Mutter, dass sie mit dem kleinen Christoph jeden Abend gebetet habe; und dass er ihr anschließend immer die Sünden gebeichtet habe, die er tagsüber begangen habe. Zuweilen sei er sogar mitten in der Nacht aufgestanden, um eine Sünde nachzuschieben, die er vergessen oder verschwiegen habe.
Christoph hatte Nietzsches „Sklavenethik“ zutiefst verinnerlicht. Doch anders als beim protestantischen Pfarrerssohn aus Schulpforta wurde sie in seinem unverbesserlichen Ministranten-Leben zur sprudelnden Quelle einer ‚fröhlichen Wissenschaft‘.