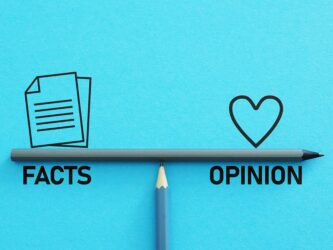Der öffentliche Diskurs gelingt nicht ohne weiteres. Doch ist eine Verengung des Sagbaren der Grund für kommunikative Entgleisungen oder eine Provinzialität, die auf einer Normalität besteht, die es nie gab? Von Ellen Ueberschär.
Ikonisch geworden ist der auf twitter zugängliche Dialog des sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer mit dem „Aluhut“. Der Bürger, ohne Mundschutz, trägt die berühmt gewordene Kopfbedeckung aus Silberfolie. Der Politiker hingegen versichert hinter einem grünen Mund-Nasenschutz, er würde zuhören. Er versucht, die Grundbedingung eines gelingenden Gespräches seinerseits sicherzustellen. Zuhören darf als eine solche Gelingensvoraussetzung gelten.
Der Bürger ist, trotz oder gerade wegen seiner Verkleidung, die ihn nonverbal ins verschwörungstheoretische Lager weist, verbal bemüht, gerade dort nicht verortet zu werden. „Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie“, sagt er zu Beginn der Sequenz, heftig gestikulierend. Man mag sich vorstellen, dass die Sprechsituation für ihn aufregend ist, umringt von einer Menschentraube und auf ihn gerichteten Kameras. Weder beschimpft noch beleidigt er seinen unmittelbaren Gesprächspartner, vielmehr fordert er dessen ungeteilte Aufmerksamkeit: „ich bin noch nicht fertig …“ Dann bringt er Fakten, gemischt mit persönlichen Einschätzungen, über die sich reden ließe; für den Moment nichts, was nicht nach dem Vier-Ohren-Prinzip von Schulz-von Thun zu besprechen wäre. Ganz offensichtlich sind ihm die Bedingungen eines gelingenden Gespräches geläufig. In einer kurzen Sequenz aber, als er offensichtlich Widerspruch aus der Menschentraube vernimmt, entgleitet ihm der unter Streß hergestellte Diskursraum – mit einer abfälligen Geste fällt er aus der Rolle: „Was bist’n Du für’n Vollidiot!“ Dann wendet er sich wieder dem Ministerpräsidenten zu und zwängt sich erneut in seine Rolle als Gesprächspartner, der ernst genommen werden will.
Ganz offensichtlich sind ihm die Bedingungen eines gelingenden Gespräches geläufig.
Diese Situation – bei voller Kenntnis der Gesprächsregeln aus der Rolle zu fallen – ist nicht erst seit Corona typisch für die hybride Kommunikation, die sich zwischen Gebrüll und Gespräch in unseren Gesellschaften ausgebreitet hat.
„Leben heißt angeredet werden“, notierte Martin Buber 1954. Leben im vollen Sinne, politisches, religiöses, soziales Miteinander lebt vom Gespräch, davon, dass konkrete Menschen einander ansprechen, sich in Frage stellen und in Anspruch nehmen lassen, dass sie Widerspruch erfahren, aber auch Zuspruch. Ihr kreatives und kritisches Potenzial kann eine Gesellschaft nur entfalten, wenn dieses Gespräch unter Individuen möglich und fruchtbar ist.
‚Leben heißt angeredet werden‘ (Buber)
Aber Beobachtungen wie die vom „Aluhut“ weisen darauf hin, dass genau dieses Gespräch im Moment gestört ist. Am Stammtisch wurde auch früher schon gepöbelt, der „Vollidiot“ ist eine alteingesessene Figur. Aber die Anonymität, die Leichtigkeit der Bedienung und die scheinbar weitgehende Folgenlosigkeit unflätiger Verbalabsonderungen im Internet lässt die Aggression mühelos anschwellen.
Statt auf die Überzeugungskraft und manchmal auch auf die Schönheit von Argumenten zu vertrauen, herrscht eine Gnadenlosigkeit, die es mit der mittelalterlichen Inquisition aufnehmen kann. In den (un)sozialen Medien werden Menschen regelrecht hingerichtet – Öffentlich sichtbare Menschen, bevorzugt Frauen, aber auch Experten wie der Virologe Christian Drosten, oder der Ratsvorsitzende der EKD werden mit Morddrohungen bedacht. Die muslimische Autorin Kübra Gümüsay berichtet in ihrem Buch „Sprache und Sein“, dass seit 2006 kein einziger Artikel von ihr erschienen sei, der nicht mit Hasskommentaren oder -Briefen quittiert worden sei. Carolin Emcke, Büchner-Preisträgerin und Essayistin, beschreibt, nein, seziert in ihrem 2016 erschienenen Buch „Gegen den Hass“ die Mechanismen der Exklusion, der Erniedrigung, der Ausgrenzung und der Gewalt in den westlichen Gesellschaften.
Verengter öffentlicher Diskursraum?
Was findet da eigentlich statt? Es gibt keine allgemein geteilte Analyse, warum der öffentliche Diskurs nicht (mehr) gelingt. Mindestens zwei Deutungen stehen sich gegenüber: Die eine läuft entlang des Befundes, dass sich der öffentliche Diskursraum zunehmend verengt: Diskursakteure dieser These verweisen darauf, dass bestimmte Wörter nicht mehr benutzt werden dürften, dass die öffentliche Debatte hypermoralisiert sei, dass Ausgrenzung gegenüber all jenen stattfände, die sich abweichend von einem als liberal identifizierten mainstream äußerten. Das Meinungsspektrum auf dieser Seite reicht von Uwe Tellkamp, der sich zu einem Opferdasein versteigt, in dem er die Existenz einer „Zivilgesellschaft“ phantasiert, die sich freiwillig verhalte wie die Stasi-Spitzel, in dem er öffentlich-rechtlichen Medien die Errichtung eines „Gesinnungskorridors“ vorwirft und in einer Buchreihe publiziert, die sich „Exil“ nennt, ein recht platter Hinweis darauf, dass man sich aus dem öffentlichen Diskurs ausgebürgert fühle.
Eine weniger egozentrische und in aufklärerischer Absicht geäußerte Variante der These von der Verengung des öffentlichen Diskurses findet sich bei Bernhard Schlink. Der Jurist und Schriftsteller beschreibt den Weg der (west)deutschen Gesellschaft vom gesellschaftlichen und politischen Totalversagen im Nationalsozialismus über die Zeit, in der Lehren aus diesem Versagen gezogen wurden, denen die Gesellschaft eine hohe moralische Qualität zumaß. Heute aber würden kulturelle oder auch migrationspolitische Positionen mit ebenso hoher moralischer Qualität ausgestattet wie der Ausschluss nationalsozialistischer Positionen.
Deutung geprägt von einer eklatanten Provinzialität
Den meisten Deutungen dieser Richtung ist eigen, dass sie von einer eklatanten Provinzialität geprägt sind. Die um-sich-schlagende-Rhetorik eines Uwe Tellkamp ist kaum verständlich für Menschen, die von der DDR wenig wissen und mit seinen deplatzierten Vergleichen nichts anfangen können. Tellkamps Horizont der öffentlichen Debatte scheint an der Dresdener Stadtgrenze zu enden. Seine Diskurswahrnehmungen sind weder vom Blick nach Polen oder Ungarn noch in die Vereinigten Staaten oder gar in Kontexte getrübt, in denen die Meinungsfreiheit tatsächlich physisch bedroht ist.
Auch Schlinks Analyse greift insofern merkwürdig kurz, als die besondere moralische Last, die der Nationalsozialismus auf den deutschen Diskurs legt, ja nur in Deutschland so schwer wiegt. Die beschriebenen Phänomene aber, die – in seiner Sicht – eine Diskursverengung repräsentieren, sind auch in anderen westlichen Gesellschaften zu beobachten.
negative Emotionalität vor allem da, wo es um Teilhabe neuer Bevölkerungsgruppen geht
Die Provinzialität erklärt, warum die negative Emotionalität gerade dort am größten ist, wo es um Diskursregeln geht, die der „Mainstream“ durch die Teilhabe ganz neuer Bevölkerungsgruppen herausgebildet hat, insbesondere der neuen Deutschen. Deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger mit einer Migrationsgeschichte also, die gleichberechtigte Teilhabe am Diskurs einfordern und zu Recht dessen Regeln mitdefinieren wollen.
Eine spürbare Folge ist, dass Ressentiments gegen Minderheiten, Andersgläubige, Frauen, Homosexuelle und Journalistinnen nicht mehr geduldet werden. Das aber ist weniger eine Verengung des Sprachraums, sondern eine Diskursregel, die alle Teilnehmenden in ihrer Vielfalt respektiert.
Eine Diskursregel, die alle Teilnehmenden in ihrer Vielfalt respektiert, ist keine Verengung des Sprachraums.
Eine andere Deutung, die zu erklären versucht, was eigentlich gerade in dieser Gesellschaft geschieht, macht die oben beschriebenen Erfahrungen der Ausgrenzung zum Ausgangspunkt. Ausgrenzung geschieht sprachlich und strukturell in einer gesellschaftlichen Atmosphäre, die Normen definiert – für Geschlechtlichkeit, für Herkunft, Religionszugehörigkeit und äußere Erscheinung – und Abweichungen entsprechend sanktioniert, bis hin zu hassvoller und gewalttätiger Ausgrenzung.
Es ist nicht die Liberalität und Weltoffenheit, die die Diskursverengung provoziert, sondern – gerade umgekehrt – die Provinzialität, die Ausgrenzung von Vielfalt, das Festhalten an einer Definition des Normalen, das es nicht gibt und nie gegeben hat.
Nicht die Liberalität, sondern die Provinzialität provoziert die Diskursverengung.
Fast spiegelbildlich zur These von der Verengung des Mainstreams beschreibt Kübra Gümüsay in ihrem neuen Buch Sprache und Sein eine Diskurs-Realität, die genau auf das Gegenteil schließen lässt: Die moralisch konnotierte Verengung geschieht nicht, weil der Raum des Sagbaren eingeengt ist, sondern weil der Raum des Sagbaren entgrenzt wird, Grenzverletzungen und Grenzübertretungen in einer Weise überhand nehmen, die keineswegs nur auf Gruppen beschränkt bleiben, die traditionell – Stichwort Ressentiment – ausgegrenzt wurden.
Auch Carolin Emcke notiert am Anfang ihres Buches „Gegen den Hass“, dass sie sich nie hätte vorstellen können, dass „jemals wieder so gesprochen werden würde in dieser Gesellschaft, … dass der öffentliche Diskurs jemals wieder so verrohen könnte.“
Während Kübra Gümüsay sich eingestehen muss, dass ihre Versuche verpuffen, als „intellektuelle Putzfrau“ mit Zahlen und Fakten gegen böswillige Anwürfe, Vorurteile und Anschuldigungen gegen Muslime und insbesondere Kopftuchträgerinnen anzureden, geht Carolin Emckes Analyse tiefer und setzt bei der Voraussetzung des Diskurses, der unwahren Definition einer machtvollen Normalität an. Sie empfiehlt „dissidente Strategien gegen Exklusion und Hass“ (von denen Gümüsays Versuche eine Variante sind). Ganz am Ende spricht sie von einem „Wir in einer offenen, demokratischen Gesellschaft“, schweigt aber darüber, wie „wir“ dorthin kommen, wenn doch die Interpretationen von Ursachen und Heilmitteln über das erkrankte öffentliche Gespräch so differieren.
‚dissidente Strategien gegen Exklusion und Hass‘ (Emcke)
Auf einer weniger sprachpolitischen, mehr sozialpsychologischen Ebene hat der Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun mit seiner Beschreibung des kommunikativen Prozesses wichtige Spuren gelegt: Die Unterscheidung von Sachinformation, Selbstkundgabe, Beziehungshinweis und Appell legt nahe, dass jede politischen Äußerung – es sei denn, sie bewegt sich im strafrechtlich relevanten Bereich – insofern genauer zu betrachten wäre, als sie unterschiedlich gemeint oder motiviert sein könnte. Gesellschaftliche Polarisierung verengt den Spielraum des Zweifels, der möglicherweise angebracht wäre, wenn es um die Zuordnung zu einer bestimmten Meinungsgruppierung geht.
größere Aufmerksamkeit für die emotionalen Ebenen
Kommunikation ist ein komplexes Geschehen zwischen rationaler und emotionaler Ebene. Diagnose und Heilung des öffentlichen Gespräches und die Poiesis – im ästhetischen und im politischen Sinne – eines neuen gesellschaftlichen „Wir“ braucht eine wesentlich größere Aufmerksamkeit für die emotionalen Ebenen und ihre kommunikationspsychologische Analyse, für Varianz in der Reaktion auf bestimmte Äußerungen und weniger Vorfestlegungen. Der Aluhut zeigt seine emotionale Aufgewühltheit, wenn er zur Seite auskeilt und sich gleichzeitig bemüht, auf der Sachebene zu argumentieren. Wäre er zu gewinnen für ein vernünftiges Streitgespräch? Für die offene Suche nach einer neuen gesellschaftlichen Übereinkunft? Darauf käme es an.
—
Ellen Ueberschär ist Theologin und seit 2017 eine der beiden Vorstände der Heinrich-Böll-Stiftung. Vorher war sie Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages.
Quellen:
Twitter pic.twitter.com/OUx6LARiT7
Bernhard Schlink, Der Preis der Enge. Umgang mit Rechten und AfD, in faz.net, Aktualisiert: 31.07.2019.
Martin Buber, Die Schriften über das dialogische Prinzip. Ich und Du. Heidelberg 1954.
Kübra Gümüsay, Sprache und Sein, Berlin, 2020.
Carolin Emcke, Gegen den Hass, Ffm 2016.
Anne Buhrfeind, Interview mit Friedemann Schulz von Thun, in: Chrismon Plus März 2020.