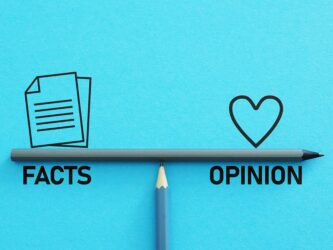Ein Plädoyer für die Professionalisierung der sogenannten „Armutsmedizin“ von Hauke Bertling.
Armut, Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit sind Prädiktoren einer erhöhten Krankheitslast. So nüchtern und medizin-mechanistisch klingt eine bittere Wahrheit. Wer auf der Straße lebt, hat eine erheblich reduzierte Lebenserwartung. In dieser Formulierung wird das Prekäre des Angerissenen schon etwas deutlicher erkennbar. Wer einen Menschen, der „Platte macht“, unmittelbar vor sich sieht, ihn riecht – gestresst, verschmutzt, vielleicht kurzatmig oder mit geschwollenen Beinen, mit offenen Wunden – versteht klarer, welche Realität sich hier verbirgt.
Armut und Krankheit
Armut und Wohnungslosigkeit haben in den letzten Jahren in Deutschland erheblich zugenommen. Dokumentiert ist dies vielfach, u.a. im Armuts- und Reichtumsbericht aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, im Wohnungslosenbericht aus dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, weiterhin durch die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W).
Die gegenläufigen Zusammenhänge zwischen wirtschaftlichem Auskommen und sozialem Stand mit der individuellen Gesundheit sind bekannt und belegt. Das hat nicht verhindert, dass die Verteilung der Einkommen und Vermögen unsere Gesellschaft mehr und mehr spaltet. In den größeren Städten fehlt es massiv an bezahlbarem Wohnraum. Im Vorbeigehen haben wir uns an den Anblick von Menschen gewöhnt, die um Geld bitten, in Schlafsäcken in Hauseingängen liegen oder kleinere Lager aus Pappen, Planen, diversem Hab und Gut bewohnen.
Schutzräume
Wohnungslose, oder genauer, obdachlose Menschen sind auf ihrer „Platte“ meist nur schlecht geschützt vor Nässe, Kälte, Hitze oder Übergriffen. Sie halten sich alternativ an überdachten, öffentlichen Orten wie Bahnhöfen auf, in denen sie geduldet werden, die aber nur wenig Rückzugsmöglichkeiten bieten.
Mit dem Leben auf der Straße ist das Erleben tätlicher Gewalt verbunden. Sie erfolgt oftmals zwischen den Betroffenen im Streit um die knappen Ressourcen, unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, bei mangelnder Frustrationstoleranz. In jüngerer Zeit erfolgen gehäuft Übergriffe gegen Obdachlose durch Unbeteiligte; eine zunehmende Verrohung unserer Gesellschaft wird hierin sichtbar: Wir erkennen uns offenbar nicht mehr in der oder dem Anderen, der auf der Straße lebt.
Wichtige Schutzräume sind die Kontakt- und Notschlafstellen der örtlichen Wohnungslosenhilfeeinrichtungen, in denen es Ansprache und etwas zu essen gibt, wo Besucher*innen sich ausruhen, ggf. duschen und ihre Kleider wechseln können, wo Postadressen hinterlegt und soziale Beratung erfolgen kann.
Vom Besucher zum Patienten
In wenigen deutschen Städten erfolgt in den Kontaktstellen eine aufsuchende medizinische Versorgung. Wenn Besucher*innen dort eine medizinische Sprechstunde nutzen wollen, ist eine besondere Niederschwelligkeit von Bedeutung. Als Patient*innen müssen sie keine speziellen Voraussetzungen erfüllen (z.B. nicht krankenversichert sein), sie müssen keine Termine vereinbaren, dürfen erwarten, dass sie wegen ihrer Lebenslage nicht be- oder entwertet werden.
Den Behandler*innen begegnet eine Vielzahl unterschiedlicher Herkunfts- und Entwicklungsgeschichten, die eine Bedeutung für die beklagten Probleme, Beschwerden oder Erkrankungen haben. Zumeist haben sich die Patient*innen lebensgeschichtlich mit einer bestimmte „Schale“ ausgestattet, für die im besten Falle auch Sympathie besteht. Deutlich überproportional bestehen, psychologisch gesprochen, dysfunktionale Bewältigungsstile wie eine Rückzugstendenz, Misstrauen, Vermeidung, Aggression oder auch eine Wahnsymptomatik. Über frühe Vernachlässigungen, Entwertungen, Zurückweisungen, Niederlagen und auch eigene Schuld könnte ein großer Teil der Besuchenden berichten. In psychiatrische Diagnosen gefasst bestehen häufig Suchterkrankungen und Persönlichkeitsstörungen, auch Traumafolgestörungen und Psychoseerkrankungen.
Ärztliches Handeln
Das Feld Armutsmedizin ist komplex. Wer hier eine Atemwegsinfektion, ein offenes Bein oder auch eine Parasitose behandelt, sollte mitlaufend auf das besondere Psychogramm der Patient*innen reagieren. Eine Kontaktgestaltung mit respektvoller Zurückhaltung ist ratsam, um nicht unbeabsichtigt negative Emotionen zu aktivieren. Die Begegnung bedarf im besonderen Maße einer sensiblen, fürsorglichen Aufmerksamkeit, einer geteilten Verletzlichkeit.[1] Gleichzeitig müssen eigene emotionale Grenzen gesetzt werden, um Verletzungen auf Seiten der Behandler*innen zu vermeiden. Es bedarf einer aufmerksamen Ruhe oder auch Rhythmik zwischen Einladung und Begrenzung, die das Zuhören und Mitfühlen ebenso ermöglicht, wie das autonome Beschließen eines Kontaktes. Transparente Regeln, über Erlaubtes und Nicht-Erlaubtes, über vorhandene Ressourcen (z.B. die zur Verfügung stehende Zeit) sind dazu hilfreich. Die Gestaltung dieses Behandlungsrahmens ist eine wichtige Aufgabe für die Behandlungsteams, der in Bezug auf seine Passgenauigkeit immer wieder intern geprüft und ausgehandelt werden muss.
Herkömmliche Arztpraxen können diese besondere Komplexität im Tempo des dortigen Praxisalltages kaum berücksichtigen. Schon eine Rezeption mit ihrem Schrankencharakter oder auch der Wartebereich können als Barriere erlebt werden, die eben nicht auf die besondere Verletzlichkeit der Patient*innen reagiert und so häufig bereits die Begegnung mit der Ärztin oder einem Arzt verhindert.
Gegen einen unreflektierten Altruismus
Warum wendet sich der Autor mit diesem Artikel an die Leser*innen eines theologischen Feuilletons? Soll hier Aufmerksamkeit für die Benachteiligten unserer Gesellschaft geweckt werden? Natürlich. Soll hier an die christliche Tugend der Barmherzigkeit appelliert werden? Nein, das gerade nicht. Das Anliegen besteht darin, die geschilderte Tätigkeit aus dem Umfeld eines (christlicher motivierten) Altruismus herauszuholen. Selbstlose Barmherzigkeit ist oftmals unausgesprochen mit der Erfahrung eigenen Leides verknüpft, was im Sinne der Nahbarkeit durchaus in der Beziehung zu den Patienten durchscheinen darf. Schwierig wird es, wenn barmherziges Handeln (unbewusst) zur Wiedergutmachung eigener Schuld oder mit einer Dankbarkeitserwartung verknüpft wird, die bei Enttäuschung in Vorwürfe oder Abwendung mündet. Hier bedarf es einer Selbstreflektion und Feinfühligkeit, um nicht durch Übertragungen die fast immer vorhandenen erheblichen Schuldgefühle der Patient*innen oder auch deren Abwehr zu aktivieren.
Beispielhaft haben gerade im Falle mitlaufender schwerer Suchterkrankungen Behandlungen z.B. chronische Wunden häufig einen unausgesprochen palliativen Charakter, der den Patient*innen nicht zum Vorwurf gemacht werden sollte (weil etwas trotz intensiver Bemühungen immer noch nicht besser geworden ist).
Für eine Professionalisierung
Der Artikel ist daher ein Plädoyer für eine Professionalisierung der Armutsmedizin, die besondere soziale und psychologische Anforderungen bereithält und zudem ein Repertoire an komplexen Erkrankungen bietet, das so in konventionellen Arztpraxen nicht anzutreffen ist und spezialisierter Kenntnisse bedarf.
Es bestehen auch besondere praktische Aufwände in der Behandlung: Sprachbarrieren sind häufig, Sprachmittler*innen sehr hilfreich. Patient*innen benötigen Zeit, um das mitgeführte Hab und Gut abzulegen, um die Probleme zu schildern, um sich für eine Untersuchung zu entkleiden (Kleidung wird oft in Schichten getragen). Den Lebensumständen der Menschen muss auch in den Behandlungsempfehlungen Rechnung getragen werden (wer draußen schläft, kann kaum mehrmals täglich verschiedene Medikamente einnehmen; wer keine Rezeptgebühr bezahlen kann, dem nutzt auch ein Rezept nichts). Eine Praxis für Armutsmedizin muss befähigt sein, bestimmte Medikamente und Verbandsmittel vorzuhalten. Die Vernetzung und Kooperation mit den regionalen sozialen Hilfeträgern ist essentiell.
Armutsmedizin benötigt eine professionalisierte Struktur und spendenunabhängige Mittel, um den besonderen Anforderungen qualitativ gerecht werden zu können, und Mittel, um die erforderlichen Behandlungen sicherstellen zu können. Solange Armut, Wohnungs- und Obdachlosigkeit zunehmen, bedarf es in einer an der Menschenwürde orientierten Gesellschaft auch (gesundheits)politischer Antworten auf diese soziale Not.
______________________________

Dr. med. Hauke Bertling, geb.1967, ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er arbeitet nach 20 Jahren in der psychiatrischen Regionalversorgung seit 2016 in der medizinischen Grundversorgung wohnungsloser und drogenabhängiger Menschen für das Gesundheitsamt Köln. Er ist auch psychiatrischer Konsiliararzt einer JVA.
[1] Vgl.: Giovanni Maio, Verletzlichkeit, Das philosophische Radio, WDR 5, ARD Audiothek. https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-das-philosophische-radio/audio-giovanni-maio-verletzlichkeit–100.html