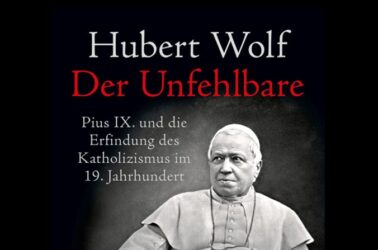Die Samstagsrezension. Von Andreas Heek.
Ich, Jahrgang 1967, stamme aus dem Ruhrgebiet, bin aufgewachsen in einer „Zechensiedlung“. Das sind gleichaussehende Doppelhäuser, in denen Bergarbeiter mit kleinem Garten für die Selbstversorgung wohnten. Mein Vater, Sohn eines Steigers auf der Zeche „Friedlicher Nachbar“ in Bochum-Linden, konnte nicht mehr in den Bergbau. Damals schon kriselte die Branche. Das war sein Glück, weil dadurch eine Chance zum Aufstieg erwuchs. Nach der Volksschule machte er eine Ausbildung bei der Post und arbeitete dann zeitlebens als Sachbearbeiter bei einer Glasfabrik in Essen. Er war stolz darauf, im Anzug „ins Büro“ gehen zu können und nicht im Blaumann „auf’n Pütt“. Er hat sich von „seiner Klasse“ entfernt, ohne ihr allerdings vollständig entkommen zu sein.
Hier beginnt die Verbindung zu dem anrührenden Buch von Christian Baron. Autobiographisch erzählt er seine Lebensgeschichte aus einer Unterschicht-Familie. Manchen Rezensenten aus dem Feuilleton (z.B. „Die Zeit“) ist die Schilderung des Alltags als Sohn eines alkoholkranken, als Möbelpacker arbeitenden Vaters und einer viel zu früh verstorbenen, vom eigenen Ehemann ständig misshandelten Mutter zu klischeehaft, als dass sie interessant sein könnte. Ich staune jedoch. Zum Beispiel darüber, wie Tante Juli, die Schwester der Mutter, trotz eigenem kleinen Säugling und mit Verzicht auf weitere eigene Kinder, vier halbwaise Kinder zu sich aufnimmt, unter ihnen den Autor, nachdem der Vater wegen Brutalität und Trunksucht einen „Platzverweis“ aus der Familie bekommt.
Noch mehr staune ich allerdings darüber, wie herzergreifend, aber ohne jegliches Pathos Baron um die Würde seines Vaters kämpft. Er wird nicht verurteilt, aber auch nicht verherrlicht. Baron leidet unter der Gewalt dieses Alkoholkranken, hat Angst vor den Schlägen, die meistens die Mutter treffen. Aber er weiß auch, dass sein Vater stets eigenes Geld verdient hat und einer regelmäßigen Arbeit nachgegangen ist. Die Familie wohnt deshalb nicht im sozialen Brennpunkt, sondern zumindest daneben. Arbeiterstolz pur, dem Baron Respekt zollt.
Über solche „Verhältnisse“ gab es bei uns zu Hause nur Naserümpfen und moralische Letzturteile, obwohl Vater und Großvater auch einen Hang zu Zornausbrüchen besaßen, die mir als Kind mitunter große Ängste bescherten, die mich lange im Leben begleiten sollten. Die kleinbürgerlichen Verhältnisse eines Angestellten und einer Hausfrau, „die nicht arbeiten musste“, waren sicher schon ein Zwischenschritt zum gesellschaftlichen Aufstieg, für den ich dankbar sein darf. Baron musste den hingegen ganz allein schaffen. Trotzdem fühle ich mich in einem gewissen Unbehagen am eigenen Aufstieg dem Autor nahe, der seine Herkunft nicht leugnen kann und letztlich auch nicht verleugnen will und doch innere Kämpfe austragen muss, selbstbewusst in eine andere Welt zu gehen, die er sich allein selbst erobern musste.
Aber noch etwas anderes ist bemerkenswert. Neben der Erzählung über einen Heranwachsenden, der sich durch Intelligenz und Fleiß aus der destruktiven Welt zwischen Möbelpackern, Stammkneipe und ständiger Armut in Kaiserlautern zu einem Mann entwickelt hat, der vom Schreiben leben kann, ist das Buch eben auch eine dramatische Geschichte von Vater und Sohn. Dass diese überhaupt erzählt werden kann, beruht allerdings auf der berührend beschriebenen Tatsache, dass es eine intensive Beziehung zur Mutter gab, die viel zu früh (in Barons achtem Lebensjahr) stirbt. Durch diese unverbrüchliche Liebe erst kann der Autor überhaupt ausloten, was ihm sein Vater bedeutet. Nämlich alles, was seine Mutter nicht kann.
Am Ende des Buches stellt sich Baron auf dem eigenen Sterbebett vor. Er ist sich sicher, dass er nicht nach seiner Mama rufen wird, denn diese Verbindung ist stets in ihm. Er schreibt vielmehr: „Mit all meinem Zorn, und all meinem Glück, mit all meinem Schmerz und all meiner Überraschung, mit all meiner Scham und all meinem Stolz, mit all meiner Angst und all meiner Liebe, mit all meinem Hass und all meiner Hoffnung, mit all meinen Zweifeln werde ich kurz vor meinem Tod dieses eine Wort aussprechen, das mein Vater sein Leben lang nie von mir zu hören bekam: Papa.“
Das Unbehagen über Herkunft, Werden und Sein wird bleiben. Aber ausgesprochen zu haben, woher er kommt, und dass er letztendlich dankbar dafür ist, selber überlebt zu haben, und jetzt weitgehend hoffnungsvoll lebt, das tat Baron sicher gut. Und dem geneigten Leser, männlichen Geschlechts zumal, der Ähnlichkeiten mit der eigenen Herkunft erkennt, tut dies auch gut. Vor allem deshalb, weil die Welt nicht schwarz oder weiß sein muss, sondern zwischen allen Farben mit Licht und Schatten changieren darf, damit sie hinreichend gut ist, zumindest so gut, dass es sich lohnt, Teil von ihr zu sein. Und man dabei stets lernt, dass eine Welt auch in Ordnung sein kann, wenn Gut und Böse niemals kategorisch voneinander getrennt sind.
Christian Baron, Ein Mann seiner Klasse, Berlin (Ullstein) 2020.
Dr. Andreas Heek, Leiter der Arbeitsstelle Männerseelsorge der Bischofskonferenz und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der LSBTIQ-Seelsorger/innen in den deutschen Diözesen.
Bild: Rainer Bucher/Buchcover