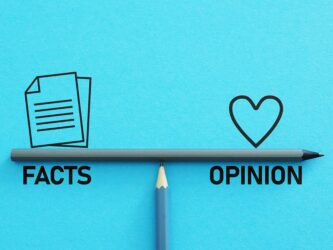Ein Dialog über die Pandemie als erzwungenes „Praktikum in Behinderung“ zwischen Egbert Ballhorn, Professor für Altes Testament und der Inklusionspädagogin Janieta Bartz.

Egbert Ballhorn: Wenn ich in diesen Zeiten auf dem Markt einkaufen gehe, ich mühsam atme und mir die Brille so beschlägt, dass ich nur noch Schemen wahrnehme und mich nur orientieren kann, weil ich den Ort kenne, wenn ich Sorge habe, beim Überqueren der Straße ein Auto oder eine/n Radfahrer/in zu übersehen, wenn ich mich beim Bezahlen so tief über meinen Geldbeutel bücke, wie ich es sonst nur bei alten Leuten erlebe, dann habe ich das Gefühl, nur noch sehr eingeschränkt ich selbst zu sein. Dann bin ich nicht mehr auf die Weise souverän, die ich mein bisheriges Leben für selbstverständlich gehalten habe. Dann bin ich
dankbar für jeden freien Atemzug, dann bin ich
glücklich über jeden klaren Blick.
Dankbar für jeden freien Atemzug.
Und dann eine kleine „Erleuchtung“. Es war in einer Videokonferenz. Inzwischen sind wir alle mit diesem Format notgedrungen vertraut. Wir tauschten uns aus, wie es uns damit geht. Und waren uns einig, dass der Austausch von Sachinformationen gelingt, aber die Kommunikation viel mühsamer wird. Man starrt auf die Kacheln vor sich, hört einzelne sprechen. Aber vieles andere geht verloren: ein winziges Zucken des Gegenübers, ein Räuspern, eine unwillkürliche Reaktion, ein hin und her schießender Blick zwischen zwei anderen im Raum, ein Atemholen, um zu einer Antwort oder nur einem kurzen Einwurf anzusetzen. Und dann sprach die Kollegin Janieta Bartz den entscheidenden Satz: „Da sehen Sie, was wir Menschen mit Beeinträchtigungen immer tun müssen.“
Da sehen Sie, was wir Menschen mit Beeinträchtigungen immer tun müssen.

Janieta Bartz:
Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen nehmen auf ganz ähnliche Weise wahr wie Menschen in einer Videokonferenz. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Wer beispielsweise nicht sehen kann, interagiert mit Menschen, ohne die von ihnen gesendeten visuellen Signale zu verarbeiten. Das ist von der Situation her mit einer Videokonferenz vergleichbar, bei der das Gegenüber die Kamera ausgeschaltet hat.
Ähnlich verhält es sich mit der Wahrnehmung bei auditiven Einschränkungen. Wenn jemand diesbezüglich eingeschränkt ist, müssen die Informationen in realen Kommunikationssituationen durch Lippenlesen etc. kompensiert werden. In einer Videokonferenz kennen wir die Erfahrung, dass Menschen aufgrund von Verbindungsproblemen nicht zu verstehen sind, oder dass sie ihr Mikrofon nicht eingeschaltet haben. Kurzum: Die Teilnahme an einer Videokonferenz gibt einen sehr authentischen Eindruck davon, was Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen tagtäglich leisten, um mit anderen in Kontakt zu stehen. Dies ist sowohl kommunikativ herausfordernd als auch körperlich anstrengend.
Authentischer Eindruck davon, was Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen tagtäglich leisten.
Egbert Ballhorn: Dieser eine Satz meiner Kollegin hat für mich die Perspektive verändert. Kommunizieren in Coronazeiten heißt seitdem für mich nicht nur, aufgrund eines ärgerlichen äußeren Umstandes für einen gewissen Zeitraum im beruflichen Alltag auf einen anderen Modus umschalten zu müssen. Es macht mir deutlich, dass ich mühsam neue Kommunikationsweisen lernen, mich den Möglichkeiten und Grenzen des unverzichtbaren Mediums anpassen muss. Ich muss Verhalten in neue Muster übersetzen, anders hinschauen, stärker moderieren, unendlich viel disziplinierter sprechen. Es geht alles, ist jedoch eine Daueranstrengung, die mich ermüdet. Freilich, ich genieße auch neue Freiheiten: Im Modus der Videokonferenz sind ganz unkompliziert Zusammenkünfte von Menschen möglich, die weit voneinander entfernt wohnen. Und zu Konferenzen muss man nicht mehr mühsam anreisen. Auch Gottesdienste sind jetzt anders möglich: Gottesdienstgemeinden können sich über Entfernungen hinweg zusammenfinden und so miteinander feiern, wie es ihnen entspricht.
Ich muss Verhalten in neue Muster übersetzen.
Und trotzdem bleibt es unendlich mühsam. Mir kommt die mediale Überbrückung der Entfernung auch wie eine Prothese vor, die ich hasse, weil sie ein Fremdkörper ist, den ich mir immer wieder umschnallen muss, und die ich schätze, weil ich ohne sie gar nicht auf die Beine käme.
Janieta Bartz:
Mein Kollege spricht mit Blick auf die Erfahrungen in der Pandemie trotz aller Vorteile von Kommunikation und virtueller Gemeinschaft von einer Prothese, die vieles ermöglicht, was dennoch mühsam bleibt.
Menschen mit Beeinträchtigungen arbeiten und leben mit Hilfsmittel, die nicht mehr oder weniger sind als das, was der Name sagt: Hilfsmittel – kein Wundermittel. Das Leben und Arbeiten mit diesen Prothesen wird ermöglicht, meist zu einem Preis, der mehr oder weniger hoch ist. Deshalb sollte man Menschen mit Beeinträchtigungen im Alltag mit Respekt und Anerkennung begegnen, da sie ein Vielfaches mehr leisten als Menschen ohne Beeinträchtigungen. Die Coronazeit gibt Menschen ohne Beeinträchtigung ein erstes Gefühl dafür, wie mühselig ein Alltag mit Hindernissen und Hilfsmitteln sein kann. So gesehen ist auch die Erwartung, dass Hilfsmittel alle Probleme im Alltag beseitigen zu hoch. Wenn man eine Software für eine Videokonferenz besitzt, garantiert dies ja auch nicht, dass diese einwandfrei funktioniert und die Kommunikation per se ermöglicht.
Menschen mit Beeinträchtigungen leisten ein Vielfaches mehr als Menschen ohne Beeinträchtigungen.
Egbert Ballhorn: Seit dem Wort meiner Kollegin habe ich auch einen anderen Blick auf die Mühsamkeiten des Corona-Alltags. Er ist für mich ein (zeitweises!) „Praktikum in Behinderung“. Ich lerne so mit dem eigenen Körper, was es heißt, aus der gewohnten Normalität meines eigenen körperlichen Daseins und meiner Kommunikationsvollzüge entfremdet zu werden. Ich lerne, mit welcher Daueranstrengung ich im Alltag überkompensieren muss, was sonst mühelos und gleichsam automatisch gelingt. Ich schaue mit neuer Hochachtung auf meine Mitmenschen, die mit vielfältigen Formen von Behinderung leben und was sie alles leisten (müssen), um an den Diskursen des Restes der Gesellschaft teilnehmen zu können. Dafür bin ich zutiefst dankbar.
Janieta Bartz:
Corona als Praktikum in Sachen Behinderung zu nutzen, ist eine interessante Idee und aus meiner Sicht für jeden Menschen ohne Beeinträchtigung empfehlenswert. Dieses Praktikum ermöglicht, sich und andere in einer neuen Perspektive wahrzunehmen. Sie kann zu Dankbarkeit für die eigene Situation, zu Wertschätzung und Anerkennung von Menschen mit Beeinträchtigung führen. Aus der Perspektive der Betroffen bleibt kritisch anzumerken: Dieses Praktikum hat irgendwann ein absehbares, mitunter auch planbares Ende. Eine Beeinträchtigung bleibt in der Regel ein Leben lang bestehen. Dann ist es weniger hilfreich zu wissen, dass andere Menschen ohne Beeinträchtigung dankbar für ihren körperlichen meist unversehrteren Zustand sind. Im Gegenteil: Wenn es bei dieser Erkenntnis bliebe, wird eher Frust geschürt.
Eine Beeinträchtigung bleibt in der Regel ein Leben lang bestehen.
Aus dem Begreifen und Verstehen des Lebens mit Hindernissen und Grenzen, sollte neben Dankbarkeit, auch neue Energie entstehen. Die Bereitschaft, betroffenen Menschen mit Verständnis zu begegnen, wenn sie an ihre Grenzen kommen und diese kommunizieren. Die Lust, mitleidenschaftlich zu agieren, am Leid der Menschen Anteil zu nehmen und auch den Wunsch, ihre Leseweisen des Lebens wahr- und ernst zu nehmen. Es sollte angesichts von Corona stärker zu einem Miteinander unterschiedlicher Menschen kommen, in denen Menschen mit Beeinträchtigung keine marginalisierte Rolle einnehmen, sondern als Expertinnen und Experten im Umgang mit Krisen adressiert werden. Ich denke, dass Corona uns auch oft gezeigt hat, dass es konstruktiver und heilsamer ist, den Blick auf das zu richten, was möglich ist.
Menschen mit Beeinträchtigungen sind Expert/innen im Umgang mit Krisen.
Egbert Ballhorn: Das erzwungene „Praktikum in Behinderung“ ist mir eine Erfahrung, die mir mein eigenes Menschsein neu erklärt und mich anders und hoffentlich auf Dauer aufmerksamer auf meine Mitmenschen schauen lässt. Und es ist für mich eine geistliche Erfahrung: in Demut einmal erfahren und annehmen zu dürfen, wie mühsames Leben aussehen und sich anfühlen kann – in der gleichzeitigen luxuriösen Erwartung, dass die allermeisten Einschränkungen auch wieder ein Ende haben werden. Aber auch ich weiß nicht, was in meinem Leben noch auf mich wartet. Ich nenne es für mich „Corona-Exerzitien“.
Janieta Bartz:
Mich erinnert die neue Form der Kommunikation und virtuelle Gemeinschaft, von der wir hier berichten, an die Situation der Jüngerinnen und Jünger nach Christi Himmelfahrt. Sie konnten nicht physisch mit Jesus verbunden sein. Das war sicherlich auch eine Krise für sie und sie mussten einen neuen Weg finden, untereinander und mit Jesus in Verbindung zu bleiben. Der Geist hat ihnen eine neue Dimension eröffnet, nicht nur Kommunikation mit Jesus, sondern auch untereinander und mit anderen Menschen im Alltag neu zu entdecken. Aus dem Verlust wurde ihnen etwas Neues geschenkt.
___
Text: Dr. Janieta Bartz, Fachgebiet Soziale und Emotionale Entwicklung in Rehabilitation und Pädagogik, und Prof. Dr. Egbert Ballhorn, Professur für Exegese und Theologie des Alten Testaments, beide arbeiten auch im „Dortmunder Profil für inklusionsorientierte Lehrer/-innenbildung“ mit, TU Dortmund.
Bilder: pixabay, Hermann Traub, walking-stick-415810_1280 und privat