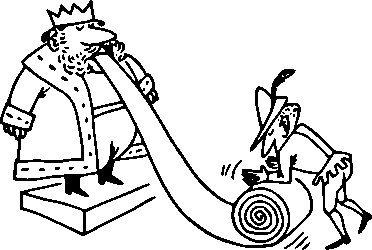Warum es genau jetzt eine Theologie braucht, die sich wieder (zu-)traut, politisch zu sein. Von Saskia Wendel
In seinem 1994 veröffentlichten Buch „Und der Zukunft zugewandt“ vertrat Wolfgang Schäuble die These, dass es angesichts gewachsener Unübersichtlichkeit einer neuen sinnstiftenden gesellschaftlichen Metaerzählung bedürfe, die das soziale Band und den Zusammenhalt der Gesellschaft legitimiert und sicherstellt.[1] Solch eine Metaerzählung müsse allerdings nicht nur die Vernunft, sondern auch das Gefühl ansprechen. Dies könne aufgrund der gesellschaftlichen Säkularisierungs- wie Individualisierungsprozesse nicht mehr durch die Religion gewährleistet werden, die diese Funktion lange Zeit erfolgreich ausgeübt habe. An die Stelle der Religion hat für Schäuble daher die Nation zu treten, die in ihrer Funktion als „Schutzgemeinschaft“ die Angst vor Unsicherheit kompensieren und sowohl Komplexitätsreduktion wie Kontingenzbewältigung leisten könne.
Notwendigkeit einer Zivilreligion?
Schäuble knüpfte damit auch an Thesen zur Notwendigkeit einer Zivilreligion an, wie sie damals etwa Hermann Lübbe formuliert hatte.[2] In dieser Lesart bedürfen die Prinzipien des liberalen Staates einer Verankerung in einer (quasi-)religiösen Instanz. Dahinter steht genau besehen nicht allein das berühmte „Böckenförde-Paradox“, sondern vor allem die primär von konservativen Staatstheoretikern vertretene Auffassung, dass dem liberalen, pluralen und demokratisch verfassten Gemeinwesen aufgrund der Autonomie und der Pluralität von Überzeugungen und Weltanschauungen sowie des Mehrheitsprinzips und des deliberativen Verfahrens ein defizitäres Moment zu Eigen sei. Hinzu kommt die Auffassung, dass der Konsens der Bürgerinnen und Bürger bzw. ihre Bindung an das Gemeinwesen nicht allein durch einen „Verfassungspatriotismus“ zu gewährleisten ist, da dies zu abstrakt sei, um tragfähige Bindungen hervorzurufen.
Vielmehr brauche es dafür eines starken Gefühlsmomentes, und dieses bieten etwa zivilreligiöse Elemente. Die Ursachen von politischen, sozialen und ökonomischen Krisen werden denn auch in erster Linie in der herrschenden Kultur gesehen, etwa in Werteverfall, Traditionsschwund, im Zerfall des bürgerlichen Familienideals nebst emanzipatorischer Bildung u.a., nicht aber in konkreten politischen und ökonomischen Machtverhältnissen. Bereits 1976 hatte etwa Daniel Bell hedonistische und subjektive Wertorientierungen als Krisenursachen ausgemacht und plädierte für die Überwindung einer „profanisierten Kultur“ und für die Erneuerung eines religiösen Bewusstseins als Grundlage der Gesellschaft.[3]
Funktionalisierung der Religion?
Insbesondere Vertreter der Politischen Theologie wie etwa Jürgen Moltmann und Johann Baptist Metz haben das Konzept der Zivilreligion und die Funktionalisierung von Religion überhaupt als bloße gesellschaftliche Kontingenzbewältigung sowie Garantin einer Bindung der Bürger an den Staat bzw. eines bürgerlichen Wertekonsenses kritisiert. Zum einen wird im Konzept der Zivilreligion entgegen der Behauptung der Transzendierung verfasster Religionen die eigene, christliche Religion, insgeheim zum Modell der Zivilreligion, womit letztlich all diejenigen aus dem behaupteten Legitimationskonsens ausgeschlossen werden, die diese Optionen nicht teilen.
Zum anderen wird die insgeheim in Anspruch genommene christliche Tradition ihrer kritischen Gehalte beraubt und so zu einer entleerten „bürgerlichen Religion“. Und vor allem wird übersehen, dass die Begründungsverpflichtung politischer Macht und politischer Institutionen sich im demokratischen Gemeinwesen gerade nicht mehr an einem religiös legitimierten „top/down“-Modell orientiert und somit keine Sakralisierung von politischen Ämtern, Institutionen und handelnden Personen impliziert. Letztlich verstricken sich Versuche einer quasireligiösen Legitimation des Staates im Problem der Repräsentation, insbesondere in das Problem autoritärer Repräsentationsmodelle und deren Verknüpfung mit politischen Legitimationserzählungen, die das angebliche Begründungsdefizit demokratischer Gesellschaften beheben sollen.
Das Aufkommen nationalkonservativer Metaerzählungen in der Amalgamierung von Nation und Religion
Schäuble setzte nun 1994 noch auf das Nationale als „Zivilreligion“, eben weil er die Religion entscheidend geschwächt sah. Heute sind wir weltweit mit politischen Bewegungen und Parteien konfrontiert, die sich auf das Nationale als politische Metaerzählung stützen. Doch anders als Schäuble vermutet hatte, ist die Nation nicht zum Substitut von Religion geworden. Im Kontext postsäkularer Gesellschaften geht vielmehr der Rekurs auf das Nationale mit einem Rekurs auf religiöse Traditionen einher bzw. findet eine ideologische Amalgamierung von Nation und Religion zu einer neuen nationalkonservativen Metaerzählung statt, wobei den Platz des Religiösen keine Zivilreligion einnimmt, sondern ein kultur-, gesellschafts- und sozialkonservativ interpretiertes Christentum im Dienst der Konstruktion eines ehedem integralen „christlichen Abendlandes“. Es zeigt sich zudem, dass sich das ursprünglich neokonservative Konzept einer Zivilreligion zu einem explizit nationalkonservativen bzw. rechtspopulistischen Projekt zugespitzt und transformiert hat.
Die politische Verantwortung der Theologie
Genau an diesem Punkt erwächst der gegenwärtigen Theologie eine zentrale politische Aufgabe und Verantwortung zugleich, in der sie auch an die damalige Debatte um die Zivilreligion anknüpfen kann. Dabei hat die Theologie nicht nur die Aufgabe einer gleichsam „nach außen“ gerichteten Ideologie- und Gesellschaftskritik, sondern auch einer „nach innen“ gerichteten Kritik derjenigen eigenen Traditionen, die von rechts politisch rezipiert wurden und werden. „Wer treibt wann und wo für wen Theologie?“[4] – diese Frage ist heute wieder hoch aktuell. Ich möchte exemplarisch auf zwei Motive eingehen, die solch einer Kritik bedürfen: auf den Gedanken der Souveränität und auf das spezifisch katholische Verständnis der Repräsentation.
Souveränität und Gottesbegriff
Der Souveränitätsgedanke kommt zum einen hinsichtlich der Konstruktion einer Begründung des Staates „von oben“ durch einen dezisionistischen Akt absoluter Durchsetzungsmacht zum Zuge, wie sie etwa Carl Schmitt vertreten und dabei eine Analogie zur absoluten Souveränität Gottes hergestellt hatte.[5] Diese Rezeptionsmöglichkeit fordert zu Überlegungen zu einem vom Begriff der Souveränität unterschiedenen Verständnis der Allmacht und des Handelns Gottes und zu Kritiken eines interventionistischen Gottesbildes heraus. Theologische Reflexionen über die Gottesprädikate erweisen sich so verstanden nicht als praxisfernes Glasperlenspiel, sondern als wichtiges Moment einer politisch sich verstehenden Theologie.[6] Zum anderen wird der Souveränitätsgedanke im Zusammenspiel mit demjenigen der Repräsentation virulent, sei es die Repräsentation von Macht und Herrschaftsgewalt, sei es diejenige eines Willens (des Volkes, des Herrschers…).
Die Konstruktion eines einheitlichen, allgemeinen, „wahren“ Willen des Volkes kann mit dem Ideal der Repräsentation dieses Willens durch einen einzigen Souverän verknüpft werden, mit der Idee einer Korporativgestalt, die diesen Willen direkt verkörpert, repräsentiert. Auch der Staat oder die Nation kann als solch eine korporative Größe vorgestellt werden, in den die Einzelnen inkorporiert werden. Genau hier greifen denn auch die Schemata von Inklusion und Exklusion, Innen und Außen, Freund und Feind, und hier wirkt die biopolitische Konstruktion einer ‚Kontinuität von Nativität und Nationalität‘ und einer ‚Trinität von Staat, Nation (Geburt) und Territorium‘.[7] Dieses Modell der direkten Repräsentation, ontologisch aufgeladen durch Rekurs auf Partizipationsontologie nebst Verkörperungsmetaphorik, kennt auch die katholische Tradition. Nicht von ungefähr zog Carl Schmitt gerade mit Blick auf das katholische Verständnis von Repräsentation die Analogie zwischen römischen Katholizismus und politischer Form.
Repräsentation und Legitimation „von oben“ oder „von unten“?
Theologisch kann man dagegen das tradierte Modell direkter Repräsentation und das partizipationsontologische Modell der Verkörperung kritisch reflektieren und alternative Konzeptionen von Repräsentation und auch von Verkörperung entwickeln. Auch hier zeigt sich die politische Relevanz theologischer Reflexionen etwa über das christologische und ekklesiologische Verständnis der Leib-Christi-Metapher oder über die Bedeutung des Sakramentalen im Kirchen- und Amtsverständnis jenseits tradierter Partizipationsmetaphysik. In diesem Zusammenhang ist von theologischer Seite auch die Sehnsucht nach einem top-down-Modell nicht nur in Fragen von Souveränität und Repräsentation, sondern auch hinsichtlich der Legitimation des liberalen Staates durch religiöse Rückbezüge zu problematisieren.
Demokratische Gesellschaften brauchen keine Legitimation von oben, denn sie können sich „von unten“ durch die Kreativität und Handlungsmacht ihrer einzelnen Bürgerinnen und Bürger legitimieren, die die „polis“ sowohl begründen als auch zusammenhalten. Allenfalls werden religiös Gesinnte diese Fähigkeit letztlich als Zeichen der Gottbildlichkeit interpretieren, dies aber nicht allen anderen als sinnstiftende politische Metaerzählung bzw. als politischer Konsens vorschreiben, wenn sie sich nicht nur als religiöse, sondern zugleich auch als liberale Bürgerinnen und Bürger verstehen.
Solche „von unten“ legitimierte Gesellschaften definieren sich auch nicht durch einen allgemeinen Willen, ebenso wenig durch Inkorporation in einen homogenen, durch Nativität bestimmten nationalen „Körper“. Sie definieren sich allein über die Anerkennung der Freiheit und Gleichheit aller und über die unveräußerliche Geltung von Menschenwürde und Menschenrechten, die autonom, unabhängig von religiösen Überzeugungen, auszuweisen ist, soll sie wirklich für alle gelten, also auch für nichtreligiöse Bürgerinnen und Bürger. Diese Anerkennung ist im Übrigen nicht allein Ergebnis eines reflexiven Aktes, sondern schließt auch die mit einem Gefühl zu vergleichende Intuition mit ein, dass jede und jeder als Zweck an sich selbst und nicht als Mittel zur Durchsetzung eigener Interessen zu betrachten ist.
Das Göttliche als Geheimnis
Hier zeigt sich im Übrigen auch die politische Relevanz der theologischen Überzeugung, dass das Göttliche sich niemals ganz präsentiert, sondern stets auch Geheimnis bleibt, unbeschadet des Bemühens um begriffliche Bestimmung. Der Grund des Politischen und damit auch der Handlungsmacht besitzt einen unbestimmbaren Rest, da niemand über den Grund von Bewusstsein und der mit ihm einhergehenden Freiheit im Sinne von Handlungsmacht und Willensfreiheit zweifelsfrei wissen kann, auch der Gläubige nicht, der darauf vertraut, dass er sich im Vollzug bewussten Lebens letztlich einem unbedingten Grund verdankt, den Theisten „Gott“ nennen. Der „Grund im Bewusstsein“ ist prinzipiell offen für Deutungen, so auch im Feld des Politischen, dessen Möglichkeitsbedingung er letztlich darstellt.[8]
Es zeigt sich also, dass Theologie auch dann, wenn sie nicht direkt politisch reflektiert, politisch ist. Auf diese Art und Weise ist es ihr auf ihre eigene Weise möglich, einen Beitrag zur Delegitimierung und ggf. auch Depotenzierung rechter politischer Bewegungen zu leisten und dadurch demokratische Gegenmacht aufzubauen. Frei nach Bonhoeffer: Die Aufgabe der Theologie ist es hier, dem Rad in die Speichen zu fallen, und das nicht erst dann, wenn das Rad schon auf Volldampf dreht, sondern schon dann, wenn man es überhaupt daran hindern muss, Fahrt aufzunehmen.
[1] Vgl. Wolfgang Schäuble: Und der Zukunft zugewandt. Berlin 1994.
[2] Hermann Lübbe: Die Religion der Bürger. Ein Aspekt politischer Legitimität. In: Evangelische Kommentare 15 (1982) 3, 125-128. Hier: 126f.
[3] Vgl. Daniel Bell: The Cultural Contradictions in Capitalism. New York 1976.
[4] Johann Baptist Metz: Zum Begriff der Neuen Politischen Theologie. 1967-1997. Mainz 1997. 124.
[5] Vgl. Carl Schmitt: Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität. Berlin 2009.
[6] In dieser Traditionslinie lässt sich auch Erik Petersons Kritik am Monotheismus und vor allem dessen Indienstnahme durch die Politische Theologie Schmitts verstehen. Vgl. Erik Peterson: Der Monotheismus als politisches Problem. In: Ders.: Theologische Traktate. München 1951. 45-147.
[7] Vgl. Giorgio Agamben: Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben. Frankfurt am Main 2002. 140 und 185f.
[8] Johann Baptist Metz hat hier zu Recht auf Agnes Hellers‘ Überlegungen zum „schwachen Messianismus“, symbolisiert durch einen „leeren Stuhl“ im politischen Raum, verwiesen. Vgl. Metz: Politische Theologie. 180 und 195f.