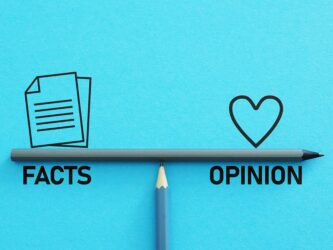Kein anderer Satz wurde der großen deutschen Demokratie-Prozession dieses Jahres so sehr als Monstranz vorangetragen: „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann.“ Eine Reflexion von Ursula Weidenfeld.
Wer über Gegenwart, Zukunft und Bedrängnis der Demokratie diskutierte, kam ohne das Theorem von Ernst Wolfgang Böckenförde zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes nicht aus. Die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen erkennen darin die brennende Frage, wie lange sich demokratische Gesellschaften noch auf den Gemeinsinn verlassen können, der sie zusammenhält – der aber außerhalb des Herrschaftsprinzips von Mehrheitsentscheidungen, Gewaltmonopol und Gewaltenteilung entstehen und existieren muss?
Die Schwäche der Weimarer Republik waren ihre Bürger und Bürgerinnen.
Lange hat man geglaubt, die Schwäche der Weimarer Republik sei ihre Verfassung gewesen, die die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten möglich gemacht hat. Das war ein Irrtum. Die Schwäche der Weimarer Republik waren ihre Bürger und Bürgerinnen. Sie haben ihre Verfassung nicht verteidigt, als es darauf ankam. Einem ähnlichen Missverständnis über die Bedeutung der Verfassung sitzen nun diejenigen auf, die denken, man müsse nur das Grundgesetz und das Verfassungsgericht gegen seine Feinde immunisieren, die Institutionen stärken, und schon sei die Demokratie wieder stabil.
Böckenförde stellte seine Überlegung in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts an, ein paar Jahre, bevor die 68er Generation ihren Vätern und Müttern Rechenschaft über deren Vergangenheit im Nationalsozialismus abverlangte. Er drückte die Unsicherheit über das Wertefundament der deutschen Nachkriegsgesellschaft aus, die keine religiöse Grundlegung mehr voraussetzte, sich aber selbstverständlich im Resonanzraum der christlichen Kirchen entwickelte. Noch war die Demokratie keine Selbstverständlichkeit, man traute der eigenen demokratischen Gesinnung nicht so richtig. Deshalb war die Frage existenziell, unter welchen Voraussetzungen demokratische Gesellschaften dauerhaft existieren und funktionieren können, wenn das Vorfeld nicht mehr verbindlich definiert werden kann.
Heute muss sich das Land dieselbe Frage wieder vorlegen. Der Historiker Till van Rahden hat vor kurzen daran erinnert, dass das Bemühen um die Grundlagen des Staates in den ersten Jahrzehnten der jungen Republik differenzierter ausfielen als später. Zum einen sicherte der Staat den Kirchen und Religionsgemeinschaften, aber auch Gewerkschaften, Vereinen und Gemeinschaften besondere Existenzbedingungen zu. Vor allem aber habe die Demokratie als Lebensform für Politikerinnen und Politiker, Politik- und Sozialwissenschaftler und -wissenschaftlerinnen eine bedeutende Rolle gespielt. Wie müssen Gesellschaften sein, welche Werte müssen sie teilen, um als demokratische Gemeinwesen stabil zu funktionieren?
Notwendigkeit, die demokratischen Gesellschaften immer wieder neu zu begründen.
Weil es im kalten Krieg immer eine Alternative zur demokratischen Gesellschaft gab, mussten sich die freiheitlichen Regierungen anstrengen, ihre Bürgerinnen und Bürger vom demokratischen Prinzip zu überzeugen. Sie mussten erfolgreicher sein als die anderen, in allen Dimensionen. Für Deutschland galt das nach dem Epochenbruch des Nationalsozialismus in ganz besonderem Maß. Im geteilten Land wurde die Alternative zur freiheitlichen Gesellschaft auf der anderen Seite des eisernen Vorhangs gelebt – und zumindest in den Anfangsjahren als Konkurrenz auch ernst genommen.
Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus entfiel die Notwendigkeit, die demokratischen Gesellschaften immer wieder neu zu begründen, für sie zu werben, ihre Schwächen und Unzulänglichkeiten anzugehen, sie ihren Bürgerinnen und Bürgern plausibel und erstrebenswert zu machen. Die demokratischen und marktwirtschaftlichen Gesellschaften hatten gewonnen. Die Friedensdividende wurde nicht nur materiell ausgezahlt. Sie gestattete auch eine bis dahin unbekannte Trägheit und Bequemlichkeit in der politischen Bildung, bei der Entwicklung eines demokratischen Wertefundaments für Einwanderungsgesellschaften, der Erziehung zur Demokratie.
Die Quittung wird jetzt gerade zugestellt: Im Jahr 2005 lebte rund die Hälfte der Weltbevölkerung in demokratischen Gesellschaften. Heutzutage ist es noch ein Fünftel. Die Demokratie scheint ihre beste Zeit hinter sich zu haben.
Das mag damit zusammenhängen, dass die Entscheidungsfindung in demokratischen Gesellschaften angesichts der vielen Krisen der Gegenwart frustrierend langsam und ineffizient erscheint. Auch die Ergebnisse demokratischer Prozesse sind nicht immer so, dass der Souverän darüber in ständigen Jubel ausbrechen würde. Im Gegenteil: Sie sind für das Individuum in aller Regel ziemlich frustrierend. So ist beispielsweise ein substanzieller Prozentsatz der deutschen Bevölkerung überzeugt, dass der Staat nicht gut mit Geld umgehen kann. Trotzdem zahlen die Bürger und Bürgerinnen natürlich Steuern. Sie unterwerfen sich Anwohnerparkregimes, der Schulpflicht, zahlen die CO2-Steuer und beugen sich den Klimaregeln – selbst wenn sie die Parteien nicht gewählt haben, die ihnen das einbrocken.
Demokratische Gesellschaften brauchen mehr Gemeinsinn als andere.
Deshalb brauchen demokratische Gesellschaften mehr Gemeinsinn als andere. Weil ihr Zusammenhalt nicht durch Herrschaft gesichert werden kann, sondern auf Zustimmung und Frustrationstoleranz angewiesen ist, müssen sie sich auf die Werte verständigen, die der Staat nicht erzwingen kann. Woher aber können die kommen, wenn der freiheitliche Staat im 21. Jahrhundert die Werte des Christentums, der Aufklärung und des Humanismus verbraucht hat, ohne selbst für Nachschub oder für neue sorgen zu können? Entsteht irgendwo ein neues Fundament?
In diesem Jahr war viel von Verfassungspatriotismus die Rede. Dabei wurde übersehen, dass viele Ostdeutsche diesen Patriotismus nicht teilen können – wie auch? Vierzig Jahre deutsche Teilung heilen nicht, wenn man die Geschichte der DDR wie einen Blinddarm der Nachkriegsgeschichte behandelt: immer da, manchmal schmerzhaft, zum größten Teil überflüssig. Niemand verlangt, den 75. Geburtstag der DDR zu feiern, schon gar nicht das Jubiläum der DDR-Verfassung. Aber zu akzeptieren, dass es für vierzig Jahre zwei gültige Stränge der Geschichte gibt, wäre schon mal ein Anfang.
Das bedeutet aber auch zu akzeptieren, dass der mühselige Weg zum Verfassungspatrioten – einen Begriff, den Dolf Sternberger Ende der 1970er Jahre prägte – ein westdeutscher war, und ein westdeutscher geblieben ist. Sternberger, der in den fünfziger Jahren nach einer „Lebenden Verfassung“ fragte, kam zum 30. Geburtstag des Grundgesetzes zu der Antwort, die Staatsverfassung tauge als neue Trägerin der Nachkriegsidentität. Auch er ging davon aus, dass Gemeinsinn, bürgerliche Tugenden und Solidarität außerhalb der Rechtsordnung entstehen. Deshalb sei der Verfassungsstaat gut beraten, diese Urgründe demokratischer Gesellschaften zu schützen.
Die Partei, nicht die Verfassung, war Dreh- und Angelpunkt des DDR-Staates.
Für die DDR konnte das nie gelten: Zuerst nicht, weil die Verfassung im Sozialismus keine besondere Rolle spielte. Die Partei hatte immer Recht, sie war der Dreh- und Angelpunkt des DDR-Staates. Verfassungspatrioten brauchte die DDR nicht. Zum zweiten nicht, weil dem Beitritt der DDR zum Bundesgebiet nach Artikel 23 des Grundgesetzes zum 3. Oktober 1990 keine ausführliche Verfassungsdebatte folgte, wie das viele Bürgerinnen und Politiker der damaligen DDR erwartet hatten. Und schließlich nicht, weil das postnationale Bewusstsein Westdeutschlands nicht nur in den ersten Jahren nach der Einheit mit der gerade erwachten Suche nach einer neuen nationalen Identität in Ostdeutschland kollidierte. Die verspäteten Nationen in Osteuropa fanden ein Geschwisterkind in den fünf neuen Bundesländern. Das aber wurde nie ebenbürtig, weil es im Gegensatz zu den osteuropäischen Nationen schon im Kleid der westdeutschen Demokratie steckte, als es sich seiner Unterschiedlichkeit noch gar nicht bewusst war.
Was bedeutet das für die Zukunft der demokratischen Gesellschaften, was heißt es für „die zweite Chance für Deutschland, seine Kraft, seinen Reichtum, sein Streben für den Frieden und die Vernunft“ zum Wohle Europas einzusetzen, wie das der in Deutschland geborene amerikanische Historiker Fritz Stern im Einheitsjahr 1990 formulierte?
„Freiheit ist ansteckend“ sagte Ernst Wolfgang Böckenförde zwanzig Jahre nach der deutschen Einheit, als es um die Frage der Integrationsfähigkeit muslimischer Bürgerinnen und Bürger in die westliche Wertegemeinschaft ging. Er argumentierte, man brauche vor allem Zeit. Zunächst reiche es aus, wenn sich Migranten und Migrantinnen gesetzes- und verfassungstreu verhielten, sie müssten die Werte der säkularen, freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft gar nicht unbedingt aus innerster Überzeugung teilen. Dass sie beispielsweise aus religiösen Gründen Reserven gegenüber dem Staat haben könnten, müsse man hinnehmen. Diese Distanz verglich er mit der der katholischen Bevölkerung des 19. Jahrhunderts gegen den preußischen Staat. Sie sei erst mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil geschwunden.
Demokratie muss selbst gelebt werden.
Wer Geduld hat, kann darauf vertrauen, dass die Freiheit ihre Ansteckungswirkung nicht eingebüßt hat, und der Weiterentwicklung des Wertefundaments der westlichen Demokratien noch ein paar Jahrzehnte Kredit einräumen. Wer weniger Vertrauen hat, muss die demokratische Ordnung als Lebensform wieder entdecken, fördern und vor allem: in Schulen, Kirchen, Vereinen, Ortsverbänden, Bewegungen und Bündnissen selbst leben.
___

Bild: Ausschnitt Buchcover von Ursula Weidenfeld, Das doppelte Deutschland, Rowohlt 2024.