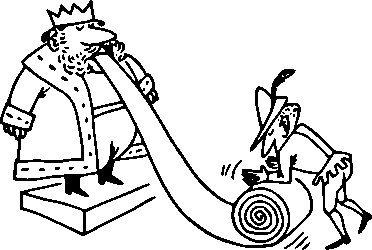Feminismus in Ost- und Westdeutschland – dieses Thema stellen wir in einer Interview-Reihe in den nächsten Wochen immer mittwochs vor. Es geht um Anfänge, Aufbrüche und Aktuelles. Eva Harasta interviewte für feinschwarz.net Feministinnen aus Ost und West. Heute im Gespräch mit Ina Merkel.
Harasta: Was ging in feministischer Hinsicht 1989 vor? War 1989 auch ein feministischer Aufbruch in der DDR?
Merkel: Frauengruppen und Diskussionen über direkte und indirekte Diskriminierung von Frauen gab es in der DDR in verschiedenen Zusammenhängen schon vor der Wende. Ich selbst bin im akademischen Kontext – an der Humboldt-Universität zu Berlin – damit in Berührung gekommen, das war Mitte der 1980er Jahre.

Die Diskrepanz bekam eine konkrete Bedeutung.
Im Herbst 1989 war dann für mich – wie für viele andere – der Moment, aus dem akademischen Zirkel herauszutreten und in die Öffentlichkeit zu gehen. Es eröffnete sich eine Gelegenheitsstruktur. In dieser intensiven Zeit wurden viele Ideen produziert, wir dachten, wir könnten die Gesellschaft verändern. Und zugleich hatte ich den Eindruck, dass vor allem Männer in der Öffentlichkeit präsent waren, und dass ihre Vorschläge keine besondere Rücksicht auf die besondere Lebenslage von Frauen nahmen. Dem wollte ich etwas entgegensetzen, und dem wollten auch andere Frauen widersprechen. Über Bekannte bekam ich den Kontakt zur Lila Offensive, die sich dafür engagierte, die Energien der vielen kleinen Frauengesprächskreise, die es gab, zu bündeln. Ich ging zu ihrem Initiativtreffen, wo die Idee geboren wurde, einen Dachverband zu gründen. Das politische Ziel war, feministische Frauen an den Runden Tisch zu entsenden.
Die Chance war Lobbying für Frauenfragen.
Der Unabhängige Frauenverband war ein Zusammenschluss von verschiedensten Frauengruppen aus allen Bereichen der Gesellschaft: Wissenschaftlerinnen, Kirchengruppen, Lesben, Alleinerziehende, es gab eine Gruppe von Frauen „mit nicht deutsch aussehenden Kindern“, Künstlerinnen usw. usf. Manche wollten den Verband zu einer politischen Partei entwickeln, andere sahen die Stärke des Verbandes darin, dass sich Frauen über Parteigrenzen hinweg untereinander vernetzten. Das war auch meine Position. Ich sah die Zukunft des Verbandes nicht als Partei. Dafür waren die politischen Positionen der Frauen(gruppen) im Verband viel zu unterschiedlich. Die Chance war doch, dass man – unterstützt durch den Frauenverband – Lobbying für Frauenfragen in verschiedenen Parteien machen konnte. Mit den ersten freien Volkskammerwahlen im März 1990 gab es die Möglichkeit, als Listenvereinigung anzutreten. Doch die Oppositionsgruppen vom Runden Tisch wollten nicht gemeinsam antreten, und das Bündnis 90 wollte die Unabhängigen Frauen nicht dabeihaben. Es gab für uns damit zwei Möglichkeiten: als Verband auf eine eigene Wahlbeteiligung zu verzichten und unabhängige Frauen in SPD, CDU usw. auf gute Listenplätze zu hieven – wofür u. a. ich plädierte – oder sich einen Partner zu suchen – was die Mehrheit wollte. Die Wahl fiel auf die Grünen. Das Wahlergebnis war mit nicht einmal zwei Prozent enttäuschend. Wegen der vorher verabredeten Liste kam am Ende keine Unabhängige Frau in die Volkskammer.
Wir – und damit meine ich alle Oppositionsgruppen – haben die eigene Bedeutung und die Erfolgschancen bei der Bundestagswahl von 1990 völlig überschätzt. Die Unabhängigen Frauen wurden überdies oft als aggressiv wahrgenommen und man sah uns als Vertreterinnen von Partikularinteressen und nicht als diejenigen, die in Zukunft bestimmen sollten, wie es weitergehen soll. Außerdem hatten wir keine Erfahrung mit Wahlkämpfen. Wir waren unprofessionell und naiv. Ich erinnere mich an einen Fernsehspot für den Unabhängigen Frauenverband mit Nonnen auf Rollschuhen und anderen Leuten, die sich bei Regen unter dem Dach einer Busstation versammeln. Das Motto: „Alle unter einem Dach“. So etwas war vielleicht sympathisch, aber absolut dilettantisch.
Harasta: Was brachte Sie persönlich dazu, sich für Geschlechtergerechtigkeit zu engagieren?
Merkel: Ich habe früh, mit 19 Jahren, im Studium, mein erstes Kind bekommen und dessen Vater bald verlassen, war alleinerziehend, mit 23 habe ich dann mein zweites Kind bekommen. Kindergärten waren eine Selbstverständlichkeit, und es war kein Problem, mit zwei kleinen Kindern das Studium fortzusetzen. Ich fühlte mich gleichberechtigt. Das änderte sich dann. Nicht nur aufgrund meiner eigenen Erfahrungen bspw. mit den Jobangeboten, sondern auch durch die Beschäftigung mit Frauenfragen im Studium. Eine meiner damaligen Professorinnen, Irene Dölling, machte das zum Thema eines Oberseminars. Wir waren eine Gruppe von fünf oder sechs Studierenden, die in diesem Rahmen ihre Abschlussarbeit geschrieben haben. Wir „entdeckten“ überall Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen. Und wir lasen gemeinsam „Westliteratur“, die frech und herausfordernd war – wie z. B. das Buch von Cheryl Benard und Edit Schlaffer „Der Mann auf der Straße“ von 1980 – die uns unsere Professorin zur Verfügung stellte. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Geschlechterfragen führte dazu, meine Erfahrungen aufgrund dieser Lektüren und Diskussionen zu deuten.
Heute nennt man das „doing gender“.
In meiner Doktorarbeit habe ich über Geschlechtsspezifik in der frühkindlichen Sozialisation geschrieben und herausgearbeitet, wie schon frühzeitig geschlechtsspezifisches Verhalten eingeübt wird. Heute nennt man das „doing gender“. Das führte auch zu Diskussionen in meiner eigenen Familie, besonders mit meinem – wahrlich emanzipierten – Vater, dem ich vorwarf, meine Mutter in ihrer Entwicklung behindert zu haben. Nach der Promotion habe ich dann über Frauen- und Männerbilder in DDR-Illustrierten gearbeitet, da trat die anfangs erwähnte Diskrepanz zwischen gesellschaftlichem Ideal von Emanzipation und realer Benachteiligung noch einmal ganz anders zum Vorschein. Das musste anders werden, war meine feste Überzeugung. Wenn man so will, war ich auf die politische Wende vorbereitet.
Im Herbst 1989 wurde es auf einmal möglich, darüber öffentlich zu reden und Vorschläge für eine andere Gesellschaft zu machen. Der Umbruch von 1989 war eine Gelegenheit für Frauen aus der DDR, ihre Stimmen öffentlich zu erheben. Wir haben sie genutzt und waren sehr euphorisch – allerdings nicht sonderlich erfolgreich, wenn man auf das Ergebnis guckt. Mich hat es sehr begeistert zu erleben, wie sich Frauen öffentlich aussprachen und von ihren Gefühlen erzählten. Dass sie immer gedacht haben, es läge nur an ihnen selbst, wenn sie im Beruf nicht weiterkamen oder an ihren Beziehungen verzweifelten, und nun – da viele dieselben Geschichten erzählten – merkten, dass es an den patriarchalen Strukturen der Gesellschaft lag.
Das Manifest „Ohne Frauen ist kein Staat zu machen“ ist ein Zufallsprodukt. Ich habe es spontan in der Nacht nach einer intensiven Diskussion niedergeschrieben, einfach um die aufgestauten Gedanken und Gefühle abzulassen. Und dann kam bei der Vorbereitung der Gründungsversammlung für den Unabhängigen Frauenverband die Schauspielerin Walfriede Schmitt auf mich zu und fragte, ob ich nicht einen Text hätte, den sie vortragen könnte. Sie hatte als Ensemblemitglied die Volksbühne für uns organisiert und wollte eine Rede halten. Sie hat meinen Text dann am 3. Dezember 1989 in der Volksbühne bei unserer Versammlung vor etwa 2000 Frauen vorgelesen, und mit ihrer großartigen Stimme und Intonation die Massen begeistert. So wurde er zum Gründungsprogramm des Unabhängigen Frauenverbandes.
Harasta: Wie sehen Sie Ihre Aktivitäten damals heute?
Merkel: Es war eine grandiose Erfahrung von Selbstermächtigung, die ich nicht missen möchte. Ganz viele Frauen sind damals aktiv geworden, haben das Wort ergriffen und ihre Sichtweise auf die Dinge eingebracht und verteidigt. Was die konkrete Frauen- oder Gleichstellungspolitik betrifft, denke ich, dass es wichtig ist, Frauenfragen nicht (nur) als Sonderfragen, sondern als Menschheitsfragen zu begreifen. Frauenfragen betreffen alle Menschen, sie hängen zusammen mit allen Bereichen gesellschaftlichen Lebens und politischen Entscheidens. Wenn man exklusiv nur die sogenannten „Frauenfragen“ anspricht, die sich meist um das Kinderkriegen und seine scheinbar unabwendbaren Folgen drehen, dann verengt das die Perspektive – und verfälscht sie auch. Frauen sind nicht die besseren Menschen, aber sie sind in einem anderen Maße von gesamtgesellschaftlichen Strukturen betroffen, z. B. von Umweltfragen, von niedrigen Löhnen, von sexistischer Anmache.
Mein konkretes politisches Engagement im Unabhängigen Frauenverband war von kurzer Dauer, vielleicht ein halbes Jahr lang war ich extrem intensiv involviert. Während dieser Zeit habe ich weiter an der Universität gearbeitet, unterrichtet, an neuen Lehrkonzepten gebastelt, über neue Universitätsstrukturen diskutiert und an einem Buch geschrieben. Mein Forschungsinteresse war schon damals kulturhistorisch orientiert. Welche Themen, welche Interessen schaffen es zu welchen Zeiten in die Öffentlichkeit? Wie werden sie dargestellt, wie wird etwas öffentlich repräsentiert? Und wie verändern sich diese Repräsentationen? Als Kulturwissenschaftlerin habe ich später vor allem zur Konsumgeschichte der DDR und zur Kinogeschichte der Nachkriegszeit gearbeitet. Geschlechterfragen spielen hier hinein und werden von mir reflektiert, aber sie bilden nicht den Fokus meines Interesses.
Meine kurze Erfahrung mit politischer Arbeit lief darauf hinaus, immer wieder dasselbe zu sagen und trotzdem nicht gehört zu werden.
Übrigens war es für mich nie eine Frage, dauerhaft in die Politik zu gehen. Meine kurze Erfahrung mit politischer Arbeit lief darauf hinaus, immer wieder dasselbe zu sagen und trotzdem nicht gehört zu werden. Die gleichen Argumente endlos zu wiederholen, ohne dass etwas Nennenswertes passiert. Das ist vielleicht etwas kurz gegriffen, und Politik kann sicher viel mehr, aber ich habe kein Talent dafür.
Prof. Dr. Ina Merkel ist Professorin für Europäische Ethnologie und Kulturwissenschaft an der Philipps-Universität Marburg und forscht besonders in den Themenbereichen Kulturgeschichte der DDR sowie Film- und Medienwissenschaft. Sie war 1989 Mitbegründerin des Unabhängigen Frauenverbandes und ganz kurz auch dessen Vertreterin beim Zentralen Runden Tisch. Der von ihr verfasste Text „Ohne Frauen ist kein Staat zu machen“ wurde zum Gründungsprogramm des Unabhängigen Frauenverbandes, in dem sich circa 60 Frauengruppen aus der ganzen DDR organisierten.
Die Fragen stellte PD Dr. Eva Harasta, Studienleiterin für Theologie, Politik und Kultur an der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt e.V. in Lutherstadt Wittenberg.
Interessierte am Thema sind bereits jetzt herzlich zur Tagung „Ohne Frauen ist kein Staat zu machen. Frauenbewegungen in Ost und West“ (7. bis 9. Mai 2021) eingeladen – u.a. mit Prof. Dr. Ina Merkel.
Foto: Ina Merkel, privat
Beitragsbild: Rolf Walter, Robert-Havemann-Gesellschaft
Manifest „Ohne Frauen ist kein Staat zu machen“: https://www.ddr89.de/ufv/UFV16.html
Informationen zum Unabhängigen Frauenverband: https://www.digitales-deutsches-frauenarchiv.de/akteurinnen/unabhaengiger-frauenverband-ufv
Werbespot des Unabhängigen Frauenverbands, 1990: https://youtu.be/MCVXi11Dq8U
Prof. Dr. Ina Merkel bei academia-net: https://www.academia-net.org/profil/prof-ina-merkel/1133946