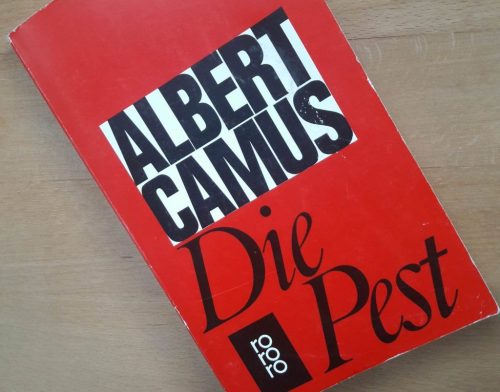Das Coronavirus wirft existenzielle Fragen auf und konfrontiert uns mit Unvorhersehbarem. Albert Camus beschrieb und analysierte die jetzt neu ins Bewusstsein dringende Bedingtheit unseres Menschseins. Von Markus Seidl-Nigsch.
Am 4. Jänner vor sechzig Jahren starb der Schriftsteller und Philosoph Albert Camus bei einem Autounfall. Damit endete das Leben des im kolonialen Algerien aufgewachsenen Franzosen auf tragische Weise. Zugleich fällt es schwer, sich vorzustellen, wie es anders hätte sein können. Einerseits deshalb, weil Camus mit 47 Jahren schon so viel erlebt und erreicht hatte: er wurde von Lehrern freundschaftlich gefördert; er konnte studieren und über sein soziales Umfeld hinauswachsen; er war Reporter und arbeitete während der Besetzung Frankreichs durch die Nationalsozialisten für die Widerstandszeitung Combat; er wurde Vater von Zwillingen – und hatte literarischen Erfolg bis hin zur Ehrung mit dem Nobelpreis 1957.
Wer sich Camus verbunden fühlt, muss rückblickend fürchten, dass er angesichts dieser Fülle in weiteren Lebensjahren schließlich Demut erwerben hätte müssen. Das wäre Camus als Mensch im Modus der Revolte vermutlich sehr schwergefallen, zumal er existenzielle Überzeugungen aufgeben hätte müssen, die sein Leben und all seine Schriften bestimmten.
Einheit von Wort und Tat
Andererseits scheinen Camus’ Forderungen an sich selbst so groß gewesen zu sein, dass die Annahme naheliegt, jeder Mensch würde irgendwann daran scheitern. Etwa seine Kompromisslosigkeit, die sich darin zeigt, dass Camus die Einheit von Philosophie und Handeln – Wort und Tat – verlangt. Im Fall Camus’ entscheidet sie über Leben und Tod, denn er war davon überzeugt, dass „die Grundfrage der Philosophie“ jene sei, „ob das Leben es wert ist, gelebt zu werden oder nicht“.
Solidarität als Revolte – auch gegen Gott
Die theoretische Antwort darauf hat Camus 1942 in seinem Essay „Der Mythos des Sisyphos“ gegeben. Camus beruft sich zwar in all seinen Schriften auf existenzielle Erlebnisse, in der Frage nach dem Suizid ist er aber strenger Logiker. Er kommt zum Schluss, dass es keine „Logik bis zum Tode“ gibt. Der Selbstmord stelle vielmehr eine Flucht, einen unzulässigen „Sprung“ dar, keinen logischen Schluss. Wollen wir unserer Ratio treu bleiben, müssten wir uns daher jedem Leid stellen, genauso wie dem Gefühl totaler Entfremdung, das jeden befallen könne. Dessen philosophische Reflexion ist unter dem Begriff des Absurden untrennbar mit Albert Camus verbunden. Wollen wir darüber hinaus allein mit dem leben, was wir mit Gewissheit wissen und auch darin Camus zustimmen, bleibt für Hoffnung und Gott kein Platz.
Schicksalsgemeinschaft
Folgerichtig impliziert die Annahme des Leids bei Camus nicht demütige Ergebenheit, vielmehr fordert er einen Akt stolzer Revolte gerade durch das Akzeptieren des eigenen Schicksals – dem mythologischen Vorbild Sisyphos’ folgend. Wir würden Camus aber vollkommen missverstehen, wenn wir in der Revolte das Schicksal des Einzelnen sähen. Das Leiden der Menschen ist für Camus ein Skandal, der sie als Schicksalsgemeinschaft zu Solidarität verpflichtet. Tatsächlich durchzieht Camus’ kompromisslose Forderung solidarischen Engagements sein ganzes Werk. Menschlichem Leiden und einem Gott, der es zulässt, bietet Camus die Stirn.
Das Absurde
Trotz Armut und schwierigen familiären Verhältnissen war Camus’ Kindheit reich an ausgelassener Freude. Im posthum erschienenen Roman „Der erste Mensch“ hat er sie literarisch gewürdigt. Die algerische Landschaft, die Wermutssträucher und Mastixbüsche, die Steine, das Meer, der Wind und vor allem die Sonne – die Erfahrung des „Einklang[s] eines Geschöpfes mit seiner Existenz“ haben Camus ein Leben lang getragen. Seinem Erkennen aber zeigte sich die Welt und der menschliche Alltag als „Unzahl schillernder Bruchstücke“. Die unerfüllbare Sehnsucht des Menschen nach Einheit bedeutete für Camus daher eine schmerzvolle, unaufhebbare Grunderfahrung. Im „Mythos des Sisyphos“ machte er sie zum Ausgangspunkt seiner Betrachtungen: Die „Entzweiung zwischen dem Menschen und seinem Leben […] ist das Gefühl der Absurdität.“ Religiösen Trost à la Augustinus („Unruhig ist mein Herz, bis es ruht in dir“) gibt es für ihn auch hier nicht.
Leben im Ausnahmezustand
Wer das Absurde (und sei es nur ein einziges Mal) vor Augen hat, steht plötzlich vor einem sinnentleerten Leben. Gerade weil kein unmittelbarer Grund diesen Ausnahmezustand auslöst, kann er ohne intellektuellen „Sprung“ nicht aufgehoben werden. Man muss darin leben. Zugleich hat das Absurde, so Camus, „nur insoweit einen Sinn, als man sich nicht mit ihm abfindet“, es also bejaht und sich zugleich dagegen auflehnt. Für Camus ist nicht Resignation oder eine Wendung zu Gott die Antwort auf Bedrängnis und Ohnmacht, sondern hellsichtiger Lebenstrotz.
Keine letzte Sicherheit
Ähnlich wie die Erfahrung der Absurdität macht uns nun das Coronavirus vieles bewusst, das heute nur scheinbar an Gewicht verloren hat: Unser Leben ist verletzbar, körperliches und seelisches Leid bestimmen in vielen Regionen der Welt das Dasein. Es gibt keine letzte Sicherheit – ökonomische und politische Krisen können unsere Gesellschaft, jeden Unternehmer genauso „an jeder beliebigen Straßenecke“ anspringen wie das Gefühl der Absurdität den einzelnen Menschen. Und dabei ist es nicht zwingend so, dass der Mensch die „ihm von Gott verliehene Freiheit missbraucht“ und sich deshalb zum Beispiel Krankheiten verbreiten, wie Mouhanad Khorchide vor Kurzem suggerierte (Die Furche vom 5. März 2020). Viele Menschen leiden unschuldig. Mit Albert Camus ist keine Theodizee zu machen: ein Gott, der Leid zulässt, könne nicht gerecht sein.
Und wie steht es um unsere Angst vor der eigenen Vergänglichkeit? Camus bezieht konsequent Stellung für die politisch Unterdrückten, die Ausgeschlossenen und Leidenden und somit jene, die tatsächlich bedroht sind. Die weite Welt bedeutet ihm nicht Reichtum und Chance, sondern eben Verlust und Vergänglichkeit. Camus Gegenrezept ist Solidarität. Das Ringen darum – vor dem Gewissen und im Angesicht der eigenen Grenzen – verarbeitete er in seinem 1947 erschienenen Roman „Die Pest“.
Das Leben bejahen
Albert Camus konnte und wollte den christlichen Glauben nicht teilen. Er lehnte jede Hoffnung ab und schrieb stattdessen gegen das Verzweifeln an. Seine darin zutage tretende Mystik klingt Christen dennoch nicht fremd: „Im schwärzesten Nihilismus unserer Zeit suchte ich nur Gründe, ihn zu überwinden“ – „aus instinktiver Treue zu jenem Licht, in dem ich geboren wurde und in welchem seit Jahrtausenden die Menschen gelernt haben, das Leben zu bejahen bis in seine Leiden hinein.“
Dr. Markus Seidl-Nigsch arbeitet als Wissenschaftsjournalist und Chemiker.
Bildquelle: Ch. Bauer