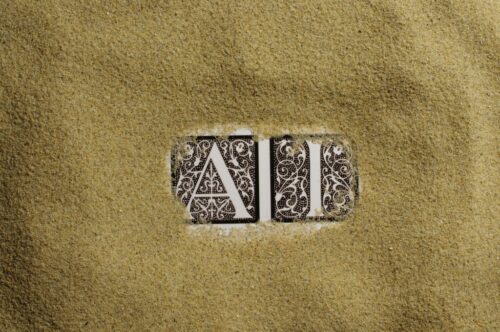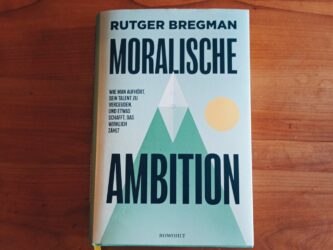Wir haben uns daran gewöhnt, zu den einflussreichsten Faktoren unseres Erdzeitalters geworden zu sein: dem Anthropozän. Klaus Vellguth über die Bedeutung von Technik und KI, und dem schleichenden Übergang vom Anthropozän zum Technozän.
„Ungeheuer ist viel und nichts ist ungeheurer als der Mensch“, formulierte Sophokles in seiner Tragödie „Antigone“. Der Satz des antiken Dichters wurde immer wieder in Verbindung mit dem Begriff des Anthropozäns zitiert, um die ungeheure Wirkmacht des Menschen auszudrücken. Doch es scheint, dass für das Zeitalter des Anthropozäns die Abenddämmerung angebrochen ist. Und vielleicht wird man den Satz des Sophokles bald umformulieren: „Ungeheuer ist viel und noch viel mehr ist ungeheurer als der Mensch.“
… ungeheure Wirkmacht des Menschen …
Vor einem Vierteljahrhundert wurde der Neologismus Anthropozän erstmals von dem niederländischen Chemiker und Atmosphärenforscher Paul Crutzen zusammen mit Eugene F. Stoermer formuliert. Der Begriff, den die beiden Wissenschaftler im Jahr 2000 in den Diskurs eingeführt haben, beschreibt die geochronologische Epoche der Gegenwart, in der sich der Mensch als homo faber zu einem maßgeblichen Einflussfaktor auf die Prozesse des Erdsystems entwickelt hat. Diese neue Epoche hebt sich von vorhergehenden geologischen Zeitabschnitten durch die signifikanten anthropogenen Veränderungen ab, die etwa in Form von Biodiversitätsverlust, Klimawandel oder geochemischen Veränderungen sichtbar werden.
… relational gedachte Anthropologie, in der das menschliche Leben in ein ökologisches Beziehungsgefüge eingebettet ist.
Semantisch eng verbunden mit dem Begriff des Anthropozäns ist dabei der Begriff der Anthropozentrik, die sich lange Zeit im Schatten einer christlichen Anthropologie ideologisch geadelt fühlen konnte. Doch setzte gerade in der kritischen Auseinandersetzung mit dem Anthropozän und seinen verheerenden Folgen eine kritische Auseinandersetzung mit anthropozentrischen Perspektiven ein: auch in der Theologie. In seinem apostolischen Schreiben Laudate Deum (2023) knüpft Papst Franziskus beispielsweise an die ökologisch-theologischen Überlegungen seiner vor zehn Jahren veröffentlichten Enzyklika Laudato si’ an und entwickelt diese unter veränderten semantischen Akzenten weiter. Während er in Laudato si’ den Begriff einer „fehlgeleiteten Anthropozentrik“ verwendet, hat Papst Franziskus in Laudate Deum den Ausdruck eines „situierten Anthropozentrismus“ eingeführt, um das Verhältnis des Menschen zur Schöpfung differenzierter zu beschreiben. Franziskus problematisiert damit ein anthropozentrisches Weltbild, das den Menschen als isoliertes Zentrum der Schöpfung versteht, und fordert stattdessen eine relational gedachte Anthropologie, in der das menschliche Leben in ein ökologisches Beziehungsgefüge eingebettet ist. Die jüdisch-christliche Weltanschauung, so Franziskus, erkenne zwar den besonderen Wert des Menschen innerhalb der Schöpfung an, doch müsse dieser Wert im Lichte der existenziellen Abhängigkeit des Menschen von anderen Lebewesen neu bestimmt werden.
Kapitalozän, Eurozän, Phobozän, Technozän?
Mit dem Bewusstsein für das Anthropozän hat sich zunehmend auch ein ethisches Bewusstsein für eine generationenübergreifende, diachrone Verantwortung für das Leben herausgebildet. Diese Form der Verantwortung erstreckt sich über die Gegenwart hinaus und schließt künftige Generationen mit ein. Sie steht in engem Zusammenhang mit einem synchronen Verständnis von Konvivenz – dem friedlichen und solidarischen Zusammenleben in einer pluralen, auch interreligiösen Weltgemeinschaft. Während die Vorstellung vom Zeitalter des Anthropozäns sich zu einem Basisnarrativ zahlreicher auch ökotheologischer Diskurse entwickelt hat, sind daneben zuletzt auch alternative Narrative entstanden, die spezifische Ursachen und Perspektiven der Umweltkrise in den Vordergrund rücken. So problematisiert das Kapitalozän die Rolle kapitalistischer Wirtschaftsstrukturen, während das Eurozän auf die kolonialen und eurozentrischen Prägungen globaler Umweltveränderungen verweist. Das Phobozän fokussiert auf die Rolle der Angst und Unsicherheit im Umgang mit ökologischen Krisen, während das Technozän die technologische Entwicklung als zentrale Triebkraft begreift.
Die Künstliche Intelligenz wird die Wirkmacht des Menschen verdrängt haben.
Doch während der Begriff des Anthropozäns sich inzwischen in zahlreichen Diskursen durchsetzen konnte, weil er hilfreich ist, um die Zeichen der Zeit zu erkennen, dürfte der Zenit dieses Begriffs, der ein Erdzeitalter beschreibt, schon nach einem Vierteljahrhundert überschritten sein: Für die Semantik des Anthropozäns hat bereits die Abenddämmerung eingesetzt. Und vielleicht wäre es künftig sinnvoller, von einer besonderen Form des Technozän als neues Erdzeitalter zu sprechen. Denn zu Beginn des anbrechenden neuen Tages wird die Künstliche Intelligenz (KI), die bereits im Jahr 1955 erstmals von John McCarthy beschrieben worden ist, die Wirkmacht des Menschen verdrängt haben und als ungeheuerliche Wirkmacht über allem aufgehen. Rückblickend dürften sich dann die Visionen eines George Orwell oder Aldous Huxley als harmlose, naive, fast schon romantische und in Sicherheit wiegende Zukunftsphantastereien lesen.
… umfassende Replikation menschlicher Intelligenz …
Bei der Einordnung des neuen von der KI dominierten Erdzeitalters geht es in erster Linie nicht um die sogenannte schwache KI (die auch als methodische KI bezeichnet wird), die auf der Basis algorithmischer Verfahren und statistischer Analysen spezifische, klar definierte Probleme innerhalb begrenzter Anwendungsbereiche löst. Diese Form der schwachen KI, die heute vom Übersetzungsprogramm über diagnostische Verfahren in der Medizin bis hin zum Chat-Assistenten des Online-Shops in ungezählten Systeme hilfreich präsent ist, kann Muster in großen Datenmengen erkennen und darauf aufbauend Entscheidungen oder Prognosen treffen. Die Arbeitsweise dieser Systeme ist nachvollziehbar und steigert die Effizienz. Im Gegensatz dazu zielt die starke KI auf die umfassende Replikation menschlicher Intelligenz ab. Dazu werden Computersysteme entwickelt, die in der Lage sind, menschliches Verständnis in seiner Komplexität nachzubilden. Theoretische Modelle zur starken KI gehen davon aus, dass ein solches System ab einem bestimmten Entwicklungspunkt ein Selbstbewusstsein entwickeln könnte. Dieses hypothetische Stadium wird häufig mit dem Begriff der technologischen Singularität verbunden, welche ein potenziell unumkehrbares Ereignis in der Entwicklung künstlicher Intelligenz sein dürfte. Gerade diese starke KI wird, so Papst Franziskus in seiner Botschaft zum 57. Weltfriedenstag am 1. Januar 2024, „eine noch nie dagewesene Kontrolle über die Wirklichkeit ermöglichen“[1].
… massiv gebärdender Neorealismus, der auf das Recht des Stärkeren setzt …
Noch steckt die starke KI in den Kinderschuhen. Und gerade in Europa versucht man, den Dämon einer ungebremsten starken KI nicht aus der Flasche zu lassen. Diesem Ziel fühlt sich beispielsweise die europäische Verordnung über künstliche Intelligenz aus dem Jahr 2024 verpflichtet. Doch es sind vor allem die USA und China, die neben den Europäer:innen massiv in die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz investieren: schlicht und einfach deshalb, weil KI das neue Zeitalter prägen, Macht verleihen und Märkte konstruieren wird. Der globale Wettbewerb um die KI-Dominanz hat deswegen schon längst begonnen und ist dabei von zwei Rahmenfaktoren wesentlich geprägt. Zum einen ist die europäische Kultur vom Geist des Institutionalismus geprägt, der an eine Regulierung durch auf Interessensausgleich basierende Institutionen glaubt. Dem steht aber im internationalen Wettbewerb ein sich gerade auch in den letzten Wochen massiv gebärdender (man könnte auch sagen: eskalierender) Neorealismus entgegen, der auf das Recht des Stärkeren setzt und eigene Interessen bedingungslos durchsetzt. Und es kann bezweifelt werden, ob sich ein europäischer Institutionalismus mittelfristig gegenüber einem amerikanischen oder chinesischen Neorealismus durchsetzen wird. Zum anderen wird die Entwicklung der starken KI exponentiell verlaufen. Damit wird sich der zeitliche Verlauf der technischen Entwicklungen den an linearen Abläufen gewohnten menschlichen Vorstellungswelten entziehen und ab einem bestimmten „Kipppunkt“ weder voraussehbar noch steuerbar sein. Sobald dieser Kipppunkt erreicht ist, sind apokalyptische Szenarien aller Art in unmittelbarer Reichweite. Und der Mensch wird feststellen, dass ihm das Heft des Handelns, das er im Zeitalter des Anthropozäns scheinbar noch in den Händen hielt, im Zeitalter des von der Künstlichen Intelligenz dominierten digitalen Technozäns längst entrissen worden ist. Es ist nicht auszudenken, was dies mit Blick auf die drängenden ökologischen Herausforderungen bedeutet.
„Was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden“, hält der Schweizer Dramatiker Friedrich Dürrenmatt in seinem Drama „Die Physiker“ fest. Im Zeitalter des Anthropozäns konnte dieser Satz noch exklusiv auf das Denken von Menschen bezogen werden. Doch die Abenddämmerung des Anthropozäns hat begonnen. Künftig wird sich dieser Satz gleichermaßen auch auf das beziehen, was KI-generiert ist. Und es wird sich zeigen, was Sophokles zu seiner Zeit noch nicht denken konnte: „Ungeheuer ist viel und noch viel mehr ist ungeheurer als der Mensch.“

Klaus Vellguth, Dr. theol. habil. Dr. phil. Dr. rer. pol., ist Professor für Pastoraltheologie an der Theologischen Fakultät Trier und daneben Honorarprofessor für Missionswissenschaft an der VPU Vinzenz Pallotti University sowie Schriftleiter der pastoraltheologischen Fachzeitschriften „Diakonia“ und „Anzeiger für die Seelsorge“.
[1] Papst Franziskus, Künstliche Intelligenz und Frieden, Botschaft seiner Heiligkeit zum 57. Weltfriedenstag, Vatikan 2023.
Beitragsbild: Immo Wegmann, unsplash.com