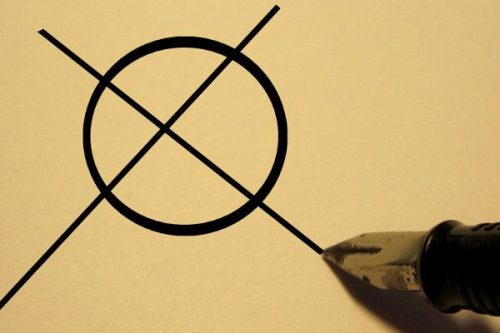Demokratie hat einen Wert an sich. Burkhard Conrad bringt in diesem CrossBlog die demokratische Demut in Analogie zur Kenosis Jesu Christi. Für Christinnen und Christen gibt es daher gute Gründe, sich leidenschaftlich für die Demokratie einzusetzen.
Dieser Text erscheint zeitgleich bei rotsinn – dem ideengeschichtlichen Blog eines Laiendominikaners – und auf feinschwarz.net – dem theologischen Feuilleton im Netz.
Was haben wir von der Demokratie?
Diese Frage darf man sich gerne einmal nüchtern stellen. Denn kaum etwas ist für die Zukunft der Demokratie schädlicher als deren fast schon gleichgültige Einschätzung als einer Selbstverständlichkeit. Die Demokratie ist an sich alles andere als selbstverständlich. Schon gar nicht ist sie natürlich, auch wenn sie hierzulande nach über siebzigjähriger bundesrepublikanischer Biografie eine Art Natürlichkeit an den Tag legt. Diese Natürlichkeit ist aber trügerisch, denn die Demokratie ist eine historische Geburt und als solche ist sie kontingent. So, wie sie als Regierungsform in die Welt gekommen ist, so kann sie auch wieder verschwinden. Das sehen wir derzeit in der Türkei, in Ansätzen auch in Polen und in Ungarn.
Von daher ist es mehr als berechtigt, sich die Frage nach dem Sinn und Zweck der Demokratie zu stellen. Diese Frage kann man dann unter anderem mit dem Verweis auf den sogenannten Output beantworten. Unter Politikwissenschaftlern spricht man dann von der „Outputlegitimität“ der Demokratie. Darin erscheint die Demokratie dann als ein mögliches Organisationsprinzip zur Herstellung kollektiv bindender Entscheidungen mit einer bestimmten Performanz. Ist diese Performanz gut – wird schnell entschieden und effektiv umgesetzt – dann legitimiert sich die Demokratie; ist die Performanz schlecht – Entscheidungen kommen nicht zustanden bzw. werden im Verwaltungsalltag beständig unterlaufen – verliert die Demokratie ihre Legitimität.
Mir geht es um die Demut, welche die Demokratie als Regierungsform allem politischen Handeln aufnötigt.
Der Output einer Demokratie trägt maßgeblich zu ihrer Akzeptanz unter den Bürgerinnen und Bürger bei. Das reicht aber nicht, um die eingangs gestellte Frage zu beantworten: Was haben wir von Demokratie? Denn Demokratie hat auch einen Wert an sich; davon bin ich felsenfest überzeugt. Diesen Wert an sich möchte ich nun aber auf etwas untypische Art und Weise herleiten. Denn mir geht es hier nicht primär um das Freiheitsversprechen, um die Mitwirkungsrechte oder um den politischen Gleichheitsgedanken, welche allesamt die Demokratie ausmachen. Mir geht es um die Demut, welche die Demokratie als Regierungsform allem politischen Handeln aufnötigt.
Auch wenn es überraschend klingen mag: Ich bin beileibe nicht der erste, der die Demokratie mit Demut in Verbindung bringt. Der Jurist Josef Isensee kam der Sache schon sehr nahe, als er 1987 die Demokratie als die „bescheidenste Staatsform der Weltgeschichte“ bezeichnete (Josef Isensee 1987: Widerstand und demokratische Normalität, in: Jurist und Staatsbewußstein, hrsg. von Peter Eisenmann & Bernd Rill, Heidelberg: Decker & Müller, S. 48). Isensee wendete sich gegen das Ansinnen, politisches Handeln müsse von „absoluten Gewißheiten“ (ebd. 49) ausgehen und dieses konkret werden lassen. Dagegen rief er zum Vertrauen in das Prinzip der demokratischen Mehrheitsentscheidung auf. Mehrheit statt Wahrheit – hier klingt ein Diktum des demokratischen Pragmatismus von Hermann Lübbe durch. Beim Historiker Paul Nolte klingt es dann so: „Demokratie handelt von der Kontingenz der Dinge, von dem Auch-anders-sein-Können, eher von der Suche als von der definitiven Lösung“ (Paul Nolte 2012: Was ist Demokratie? Geschichte und Gegenwart, München: Beck, S. 73).
Die Demut der Demokratie schärft den Blick für die überbordernde Machtlust, den politischen Egotrip, den Furor der Ideologien und des Dogmatismus.
Der Brite John Keane spricht dann explizit von der „humility, also der Demut der Demokratie (in J. Keane 2009: The Life and Death of Democracy, London: Pocket, 846ff.). Auch Keane betont die Kontingenz des Politischen, wenn er schreibt: „When democracy takes hold of people’s lives, it gives them a glimpse of the contingency of things“ (853). Keane setzt aber noch eins drauf: „The democratic ideal thinks in terms of government of the humble, by the humble, for the humble, everywhere, any time“ (855). Für Keane ist Demut die Schlüsseltugend der Demokratie. Die Demut der Demokratie schärft den Blick für die überbordernde Machtlust, den politischen Egotrip, den Furor der Ideologien und des Dogmatismus.
Eine Haltung der politischen Demut lenkt die Aufmerksamkeit weg von den Starken und Einflussreichen hin zu den Schwachen und Mittelmäßigen. In Keanes deutlicher Sprache: „People who are humble try to live without illusions. They dislike vanity and dishonesty; nonsense on stilts and lies and bullshit sitting on thrones are not their scene“ (ebd.). Man könnte folgern: Die Autokratien unserer Tage sind hingegen vollgepackt mit Hochmut, Lügen und zum Himmel stinkender Machtgier.
In der Demokratie gibt es keinen eigentlichen Sitz der Macht.
Quasi als Gegengift gegen das Gift der Macht gibt es in der Demokratie keinen eigentlichen Sitz der Macht. Oder anders formuliert und um Claude Lefort zu zitieren: Der Sitz der Macht ist leer. Ähnlich Keane: In der Demokratie gilt: „No body should rule“ (ebd., 856). Die Macht und Herrschaftsinstrumente, die vorhanden sein müssen, um die notwendigen kollektive Entscheidungen zu treffen und umzusetzen, werden in der Demokratie dezentriert und über verschiedene Autoritäten und Institutionen hinweg verteilt (ebd. 860). Machtkonzentration, sozusagen geballte, in einem Zentrum institutionalisierte Hochmut gilt es zu vermeiden. Dort, wo sie sich ausbreitet, ist Demokratie nicht (mehr) vorhanden.
Demut (…) ist eine Tugend oder gar ein Wesenszug, der im christlichen Glauben einem konkreten Vorbild folgt: Jesus Christus.
Ich möchte aber noch einen Schritt weitergehen als Isensee, Nolte und Keane. Die demokratische Demut ist für mich nämlich ein Fingerzeig, dass die Demokratie gerade wegen ihres demütigen Pragmatismus einen metaphysischen Überschuss generiert, besonders aus christlicher Sicht. Denn die Demut, das Abstreifen von Machtstreben und Größenwahn, ist eine Tugend oder gar ein Wesenszug, der im christlichen Glauben einem konkreten Vorbild folgt: Jesus Christus.
Ich möchte durchaus behaupten, dass die demokratische Demut analog zur Kenosis Jesu Christi verstanden werden kann.
Unter dem Fachterminus „Kenosis“ wird theologisch zumeist das verhandelt, was ich eben im Bezug auf die Politik von der demokratischen Demut sagte: die Entsagung jeder äußeren Macht, das Ablegen göttlicher Eigenschaften bzw. Kräfte und die Ablehnung jeder Überrumpelungsstrategie zur Durchsetzung des eigenen Willens. Diese herabsteigende, demütige Bewegung wird im Brief des Paulus an die Gemeinde in Philippi in besonderer Weise Jesus Christus zugeschrieben. Paulus schreibt in dem Brief in einer bekannten Passage:
Er (d.h. Jesus Christus; BC) war Gott gleich, / hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich / und wurde wie ein Sklave / und den Menschen gleich. / Sein Leben war das eines Menschen; er erniedrigte sich / und war gehorsam bis zum Tod, / bis zum Tod am Kreuz. (Phil. 2, 6-8).
Nun möchte ich keinesfalls behaupten, dass die beschriebene politische Demut der Demokratie kausal mit der Demut Jesu Christi, wie sie sich in der von Paulus beschriebenen herabsteigender Bewegung manifestiert, zusammenhängt. Da wäre der politisch-theologische Bogen deutlich überspannt. Ich möchte aber durchaus behaupten, dass die demokratische Demut analog zur Kenosis Jesu Christi verstanden werden kann.
Es gibt also gute Gründe, als Christin oder Christ ganz affirmativ für die Demokratie zu sein und für sie zu kämpfen.
Denn so wie es der christliche Glauben von Jesus Christus formuliert: dass er nämlich Ewigkeit und Machtfülle der Göttlichkeit hinter sich ließ, um als Gottmensch (Sören Kierkegaard) in die Kontingenz des Irdischen einzusteigen; so kann es auch der Demokratie zugeschrieben werden. In einer Demokratie gibt es kein beständiges Oben und Unten. In einer Demokratie gibt es kein eindeutiges Machtzentrum. In einer Demokratie gibt es vielmehr eine beständige Durchlässigkeit von Oben und Unten, ein Herab- und Heraufsteigen in der hierarchischen Leiter, eine Begrenzung des Zugangs zu Machtressourcen auf Amtszeiten. Und es gibt eine Dezentrierung der Herrschaft heraus von dem einen Stuhl der Macht hinein in unterschiedliche politische Institutionen und gesellschaftlichen Kräfte.
Vor diesem Hintergrund ist es durchaus berechtigt, der Demokratie – aus christlicher Sicht – den politisch-theologischen Vorrang vor jeder anderen Herrschaftsform zuzubilligen. Es gibt also gute Gründe, als Christin oder Christ ganz affirmativ für die Demokratie zu sein und für sie zu kämpfen. Nicht (nur) wegen ihres Freiheitsversprechens, nicht (nur) wegen ihres Teilhabeversprechens. Vielmehr bildet das demokratische Handeln im politischen Raum am ehesten das nach, was Gott in Jesus Christus im spirituellen Raum exemplarisch den Gläubigen vorlebt: Demut, Entäußerung von Macht, Mit-leben und Mit-leiden mit den Menschen.
___
Burkhard Conrad ist promovierter Politikwissenschaftlicher und laiendominikanischer Blogger (@rotsinn – dem ideengeschichtlichen Blog). Er arbeitet beim Erzbistum Hamburg.
Bild: Wilhelmine Wulff / pixelio.de