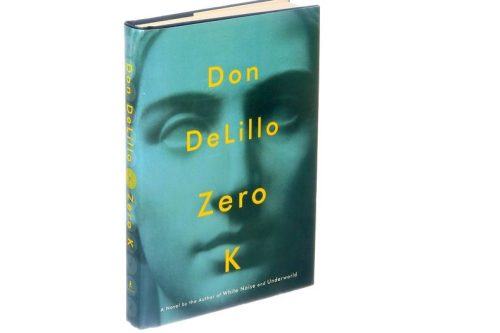Der absolute Gefrierpunkt und ein Sonnenuntergang in Manhattan: Sie umspannen die Sehnsucht nach der Wahrnehmung der Welt, wie sie wirklich ist. Matthias Wörther hat Don DeLillos jüngsten Roman Null K gelesen.
Es ist Artis, die spricht, Artis Martineau, die zweite Frau des Milliardärs Ross Lockhart. Ihr irritierender Monolog bildet das Artis Martineau überschriebene Mittelstück zwischen Teil I und Teil II von Don DeLillos jüngstem Roman Null K. Aber ist tatsächlich sie es, die spricht? Denn eigentlich ist Artis tot. Sie hat sich im Endstadium ihrer multiplen Sklerose im Kryonik-Komplex ihres Mannes einfrieren lassen. Sie steht nackt und tiefgefroren in einem der glänzenden Stahlzylinder, in denen die Technologiegläubigen auf die Reparatur des Körpers und die Wiederherstellung ihrer Identität in näherer oder fernerer Zukunft hoffen: „Aber bin ich denn, wer ich war … Wo ich bin ist kein Irgendwo, das ich wissen oder fühlen kann … Muss ich warten.“
Null K ist kein Zukunftsroman.
Zero K (übersetzt von Frank Heibert, Kiepenheuer & Witsch 2016), ist kein Zukunftsroman. Firmen wie die Alcor Life Extension Foundation (www.alcor.org) praktizieren bereits, was DeLillo ein kleines Stückchen weiter denkt. Denn bislang wird nur eingefroren, wer klinisch tot ist. Artis dagegen ist dem Tod freiwillig ein Weniges zuvorgekommen, weil sich laut der Kryonik-Experten ihr Körpergewebe so besser konservieren lässt. Ihr gesunder Mann wollte sie aus Liebe zunächst auf der Reise in die Zukunft begleiten, macht dann aber in letzter Minute einen Rückzieher. Zwei Jahre später allerdings geht auch er den Weg in die Kälte, um, wie er hofft, gemeinsam mit ihr ein neues Leben beginnen zu können.
DeLillo erzählt die Geschichte von Artis und Ross aus der Perspektive von Jeffrey, Lockharts Sohn aus erster Ehe, den er hat einfliegen lassen, damit er sich von seiner Stiefmutter verabschieden kann. Mit den Augen Jeffreys lernen die Leser den hochtechnisierten, vielfach gesicherten, teils einem Kloster, teils Kafkas Schloss ähnelnden futuristischen Komplex kennen, den sein Vater und mit ihm die Reichen der Welt irgendwo zwischen Kasachstan und Kirgisistan bei Tscheljabinsk haben errichten lassen. Er dient einem einzigen Zweck: Menschen zu präparieren und einzufrieren, die es sich leisten können, um ihnen ein Leben in der Zukunft zu ermöglichen. Bei ziellosen Wanderungen durch den Komplex und in enigmatischen Begegnungen mit technischem Personal, Sicherheitsbediensteten, Gurus, selbst ernannten Priestern und einem philosophierenden Zwillingspaar bekommt Jeffrey Einblick in eine ausgefeilte Ideologie des immanenten Weiterlebens: „Der Tod ist ein kulturelles Artefakt, keine strikte Bestimmung von etwas menschlich Unvermeidlichem.“ (74)
Einblick in eine ausgefeilte Ideologie des immanenten Weiterlebens.
Das Lebensmotiv seines Vaters, „Jeder will das Ende der Welt in der Hand haben“ (9), mit dem der Roman beginnt, teilt Jeffrey allerdings nicht. Ihr Verhältnis ist distanziert, er trifft den Vater nur sporadisch. Sein Geld interessiert ihn nicht, im Gegenteil. Er möchte ein eigenes Leben führen und nicht als Protegé seines Vaters betrachtet werden können: „Das Jobangebot würde kommen. Und ich würde es ablehnen.“ (174) Lockhart hatte Jeffreys leibliche Mutter Madeline vor Jahren verlassen. Von den Umständen ihres Todes erfährt er erst jetzt von seinem Sohn, als er beschlossen hat, selbst die Grenze zur Zukunft zu überschreiten. Jeffrey begleitet seinen Vater in den letzten Tagen auf dem Weg der kryonischen Behandlung, ohne selbst an das technisch vermittelte Jenseits zu glauben.
Er lässt sich durchs Leben treiben und verfolgt keine ehrgeizigen Ziele. Sein Leben besteht aus Gelegenheitsjobs und wechselnden Beziehungen, derzeit mit Emma, die einen adoptierten Sohn hat, Stak. Stak ist begabt, aber seltsam, eigenbrötlerisch, ungewöhnlichen Phänomenen zugetan, ein Waisenkind, das Emma und ihr damaliger Mann in einer Einrichtung für verlassene Kinder in der Ukraine gefunden hatten. Sein Schicksal dient DeLillo dazu, die Kunstwelt des kryonischen Komplexes mit den bleibenden Realitäten von Gewalt und Krieg zu kontrastieren.
„Bin ich nur die Wörter. Ich weiß da ist noch mehr.“
Im Komplex nämlich flimmern auf großen Videowänden Bilder von Naturkatastrophen und gewaltsamen Auseinandersetzungen, dazu bestimmt, den Kandidaten für die Tiefkühlbehandlung den Abschied von dieser Welt wünschenswert und stimmig erscheinen zu lassen. Auf einem dieser Bildschirme hat Jeffrey das Ende von Stak beobachten können, als Freiwilliger, in der Ukraine, ‚In den Zeiten von Konstantinowka‘, „… hier, über mir, angeschossen, blutend, der Fleck auf Brust wird größer, junger Mann, geschlossene Augen, überragend real.“ Auch Jeffrey hatte trotz seiner Bemühungen letztlich keinen Zugang zu Stak gefunden, bevor er verschwunden war und Emma lange vergeblich nach ihm gesucht hatte: „… das Kind, aus dem ein Ein-Mann-Land wurde.“ (270)
Das tödliche Schicksal eines traumatisierten jungen Menschen auf der Suche nach seinen Ursprüngen, „überragend real“, ist einer der Schlüssel zu DeLillos faszinierendem philosophischem Roman. Denn mit Jeffrey hält DeLillo an einer menschlichen Wirklichkeit fest, die schicksalhaft ist und tödlich, aber auch bedeutsam, in der sich Identität tatsächlich leben lässt und nicht bloß ein vages Zukunftsprojekt ist wie für Artis in ihrem Tank: „Bin ich nur die Wörter. Ich weiß da ist noch mehr.“ (166)
In seinen Gesprächen mit Stak bringt Jeffrey angesichts eines Kunstobjektes die entscheidende Erkenntnis einmal so auf den Punkt: „Der Fels ist, aber er existiert nicht“ (222). So betrachtet er wohl auch Artis, als eine Art Fels, ohne dass DeLillo Jeffrey gegen Artis’ Position ausspielen würde.
Die Epiphanie, mit der der Roman endet.
Denn Artis ist überzeugt von einer kommenden Welt, die erfüllt, was die gegenwärtige Welt allenfalls momentweise enthüllt: „Ich glaube fest daran, dass ich mit einer neuen Wahrnehmung der Welt wiedererwachen werde.“ … „Der Welt, wie sie wirklich ist.“ … „Wiedergeboren werden in eine tiefere und wahrere Wirklichkeit. Linien aus strahlendem Licht, jedes Stück Materie in seiner Gänze, ein heiliger Gegenstand.“ (49) Die Epiphanie, mit der der Roman endet, greift genau diese Beschreibung von Transzendenzerfahrungen auf, verortet sie jedoch in der Immanenz. In einem Bus in New York beobachtet Jeffrey einen Jungen, als die Strahlen der Sonne, was zwei Mal im Jahr geschieht, von Westen her genau parallel in die Häuserschluchten Manhattans hineinleuchten: „… und der Junge … erlebte in reinster Verwunderung die enge Berührung von Erde und Sonne. Ich kehrte auf meinen Platz zurück und sah nach vorn. Ich brauchte das Himmelslicht nicht. Ich hatte die Schreie des Jungen, sein Staunen.“ (280)
DeLillo ist inzwischen 80 Jahre alt. Seit seinem gewaltigen Amerika-Panorama Unterwelt (1997) hat er vor allem schmale und zunehmend auf die menschliche Existenz und ihre Bedingtheiten reflektierende Werke veröffentlicht: Körperzeit (eine Künstlerin setzt sich mit dem Tod ihres Mannes auseinander, 2001), Cosmopolis (ein Hightech-Banker wird mit der Realität konfrontiert, 2003), Falling Man (eine Auseinandersetzung mit dem 11. September 2001 und der Angst, 2007) oder Der Omega-Punkt (eine Meditation über das Ziel der Menschheit, 2010).
Faszination und Bedrohtheit unserer Existenz.
Wenn in der grandiosen Einstiegssequenz von Unterwelt ein Farbdruck von Bruegels Triumph des Todes von der Tribüne eines Baseballstadions zu Boden flattert, ist unvergesslich ins Bild gesetzt, dass in jedem Moment des Lebens die Faszinationen unserer Existenz mit deren Bedrohtheit und Vergänglichkeit verschränkt sind. Null K reflektiert diese unauflösliche Paradoxie im Horizont einer technik-euphorischen Zukunftsgläubigkeit, die im Menschen eine optimierbare biologische Maschine sieht. Die Erfahrung der Welt, wie sie wirklich ist, und nach der auch Artis sich sehnt, ist nicht in der Zukunft, sondern allein in der Gegenwart zu finden. DeLillos Position ist klar: Es gibt Momente wie jenen Sonnenuntergang in Manhattan. Sie ergeben sich, aber lassen sich nicht herbeiführen. Die Frage, ob und in welchem Sinn sie über sich hinaus verweisen, bildet das Zentrum von Null K.
Matthias Wörther ist Leiter der Fachstelle Medien und Kommunikation der Erzdiözese München und Freising.