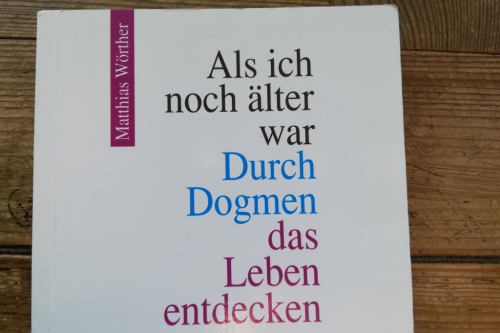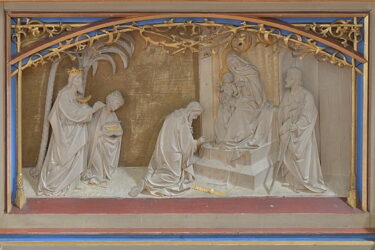1996 veröffentlichte Matthias Wörther „Als ich noch älter war. Durch Dogmen das Leben entdecken“. Der Titel bezog sich auf eine Zeile aus Bob Dylans Song „My back pages“. Das Buch war der Versuch eines jungen Theologen, seine Erfahrungen mit sich selbst, mit der Kirche und mit seinem Glauben auf einen theologischen Begriff zu bringen. Heute, mehr als 20 Jahre später, blickt der Autor zurück: Was davon ist, viele Jahre später, noch tragfähig?
Der Reihe nach: Warum dieser paradoxe Titel „Als ich noch älter war“? Er fasst ziemlich genau den autobiografischen Ausgangspunkt, der das Buch motivierte, und verweist auf jene lähmende Diskrepanz zwischen meinem Erleben und dessen religiös bestimmter Deutung, die die Atmosphäre meiner Jugend prägte. Ohne selbst Opfer einer besonders rigiden kirchlichen Erziehung gewesen zu sein, genügte das durchschnittliche Milieu der siebziger Jahre in einer gewöhnlichen Stadtpfarrei, um zumindest in meinem Fall eine massive Identitätsstörung hervorzurufen. Katholisch sollte und wollte ich damals sein, aber eben auch modern und gegenwärtig. Das funktionierte weder für mich selbst, noch konnte ich meinen Anspruch überzeugend nach außen vertreten. Und schon gar nicht lag mein Versuch auf der Linie des Zeitgeistes, der die Befreiung von Unterdrückung und Unterdrückern auf seine Fahnen geschrieben hatte.
Ein religiös überhöhtes Idealbild des Lebens.
Zündstoff bei meinen Gesprächen, Diskussionen und Argumentationsstrategien lieferten immer wieder die ‚Dogmen‘ der Kirche, die zu verteidigen ich mich unter innerer Strafandrohung (‚Sünde‘) angehalten sah. Dabei hatte weder ich selbst einen vernünftigen Begriff von ihnen, noch war die implizite und explizite Katechese in Religionsunterricht, Pfarrgemeinde und Predigt auch nur ansatzweise in der Lage, mir Einsichten und Argumente für diese Diskussionen zur Verfügung zu stellen. Also verteidigte ich, was ich nicht verstand, und behauptete, einen Lebensbezug zu sehen, wo keiner war. Den Konflikt zwischen dem übermächtigen Wahrheitsanspruch der Institution (‚Dogma‘) und meiner eigenen Autorität als junger Mensch (‚Subjektivität‘) entschärfte und verdrängte ich, indem ich erstarrte, anstatt zu rebellieren. Ich tat so, als sei der Begriff meines Lebens schon erarbeitet, und ersparte mir um den Preis einer inneren Lähmung die Auseinandersetzung mit meinen eigenen Erfahrungen und Widersprüchen. Das fühlte sich schließlich genauso an, wie es das Titelparadox ausdrückt: Ich war älter, als meinem Alter entsprach, und lebte jenseits der Erfahrungen, die ich noch gar nicht gemacht hatte, eingemauert in ein religiös überhöhtes Idealbild des Lebens.
Existenz ist keine Eigenschaft von Dingen, sondern von Begriffen.
Im Grunde handelte es sich bei meiner damaligen Lebensideologie um die Variante eines Positivismus, der unter Begriffen eine Art fotografische Abziehbildchen versteht, mit denen die Welt zu katalogisieren ist. In jüngster Zeit hat Markus Gabriel in seinem Buch „Warum es die Welt nicht gibt“ auf erfrischende Weise gegen diesen Platonismus des Denkens angeschrieben. Offenbar ist das Problem weiterhin virulent, auch außerhalb des kirchlichen Klimas. Während des Theologiestudiums stellte Elmar Klinger dann mein Denken mit Hilfe von Gottlob Frege und Alfred North Whitehead vollständig auf den Kopf und brachte es in Bewegung. Es ist nicht übertrieben, von einem fundamentalen Paradigmenwechsel zu sprechen, den er bei seinen Studentinnen und Studenten hinsichtlich ihres Begriffs vom Begriff zustande brachte. Dieser Paradigmenwechsel vollzog sich bei all jenen, die schließlich verstanden hatten, dass Existenz keine Eigenschaft von Dingen, sondern eine Eigenschaft von Begriffen ist.
Und Wirklichkeiten übersteigen jeden Begriff.
Damit wurden mindestens drei grundsätzliche Denkfehler meinerseits behoben, denn es zeigte sich:
- Begriffe bilden die Wirklichkeit nicht ab.
- Wirklichkeiten entziehen sich einer vollständigen Erfassung, weil sie jeden Begriff übersteigen.
- Wie man sich zum eigenen Leben verhält, hängt tatsächlich auch vom Begriff ab, den man von sich selbst und von der Welt hat.
In einem Atemzug von Einhörnern und Gott zu reden, erschien mir plötzlich nicht mehr absurd, denn Einhörnern konnte zu Recht Existenz bescheinigt werden, etwa im Raum der Literatur, und ebenso konnte der Gottesbegriff unbefangen danach befragt werden, welche Tatsachen des Lebens er denn seinerseits als existent behauptete. Der Begriff ‚Geheimnis‘ verlor den Charakter einer Nebelkerze, mit der man sich kritischen Argumenten entzog, denn er hielt die prinzipielle Unaufklärbarkeit des Lebens als Tatsache fest. Die christologischen Debatten und Begriffsunterscheidungen verloren den Anschein von altkirchlichen Spitzfindigkeiten, weil sie sich als Auseinandersetzungen über eine angemessene Anthropologie im Horizont von Platonismus, Dualismus und biblischer Offenbarung erschließen ließen.
Die pastorale Dimension der Dogmen.
Vor allem aber wurde auf einmal die Behauptung von der pastoralen Dimension der Dogmen verständlich. Die Theorie-Praxis-Debatten, die Aussagen der dogmatischen Tradition und der Wahrheitsanspruch des christlichen Glaubens zeigten sich als rückgebunden und rückbindbar an geschichtliche Horizonte, persönliche Erfahrungen, Handlungszusammenhänge und die Behauptung von Möglichkeitsräumen. Whitehead hat diese im positiven Fall lebensstiftende, im negativen aber lebensverhindernde Funktion von ‚Theorien‘ in seinem Buch ‚Wie entsteht Religion‘ eingängig so formuliert: „Unser Charakter entwickelt sich gemäß unserem Glauben.“
„I’m younger than that now“, ich bin jünger als damals, heißt es weiter bei Bob Dylan. Wenn ich mein Buch neu schreiben wollte, würde ich heute diese Hälfte der Gedichtzeile in den Vordergrund rücken und für den Buchtitel verwenden. Es würde mir dann nicht mehr so sehr um die Aufarbeitung meiner problematischen Vergangenheit, sondern um eine grundsätzliche Darlegung der Funktion des Begrifflichen gehen.
Worin bestehen die Maßstäbe für die Unterscheidung von Fakten und Fiktionen des eigenen Lebens?
Die Grundthese würde heißen: Die meisten Probleme haben ihren Ursprung in unseren Konzepten und in der unterschiedlichen Qualität der Beziehung, die zwischen unseren begrifflichen Entwürfen und der Wirklichkeit besteht. Deshalb sind in pastoraler Hinsicht die interessantesten und wichtigsten Studienobjekte im Hinblick auf eine ‚Begriffslehre‘ Verschwörungstheorien und ‚enge‘ Weltanschauungen, wie sie etwa Sekten vertreten, sowie durchaus zutreffende Denkentwürfe, die jedoch missverstanden werden. Die Fragen, die sich dann stellen, lauten: Wie kommt man zur ‚richtigen‘ Auffassung über das eigene Leben und die Welt? Was ist die Voraussetzung dafür, dass jemand einen engen Begriff seines Lebens zugunsten eines weiteren Begriffs aufgibt? Worin bestehen die Maßstäbe für die Unterscheidung von Fakten und Fiktionen des eigenen Lebens?
An welchen Gott glaube ich?
In einem darauf aufbauenden zweiten Teil wäre die Grundthese auf den Glauben und seine begriffliche, d.h. dogmatische Gestalt anzuwenden. Die pastorale Dimension des Dogmas zu erschließen würde dann heißen, die Tatsachen zu identifizieren, die mit Hilfe dogmatischer Begriffe behauptet und festgehalten werden. Hier lautete die These: Wer sich sein Leben und die Welt ‚dogmatisch‘ erschließt, kann zuverlässig deren Grenzen und ihre Möglichkeiten entdecken. Eine Aufgabe könnte dann durchaus sein, die pastorale Dimension des Glaubens an Gott zu entfalten. An welchen Gott glaube ich? Welche Tatsachen hält der christliche Gottesbegriff fest, welche der der Muslime? Sind sie identisch oder überschneiden sie sich? Und wenn, in welchem Sinn? Gibt es Begriffe, die vergleichbare Tatsachen des Lebens festhalten, aber auf das Wort ‚Gott‘ verzichten? Welchen Charakter bilde ich aus, wenn ich an den einen oder den anderen Gott glaube? Gibt es Möglichkeiten eines wertenden Vergleichs ‚dogmatischer‘ Auswirkungen in meinem Leben?
Ich werde dieses zweite Buch vermutlich nicht schreiben. Aber ich muss das erste in wesentlichen Punkten auch nicht revidieren. Allerdings hätte ich gerne damals schon die Lockerheit gehabt, die ich erst erreichte, als ich jünger geworden war …
Matthias Wörther ist Leiter der Fachstelle Medien und Kommunikation der Erzdiözese München und Freising.
Photo: Rainer Bucher
Von Matthias Wörther u.a. auf feinschwarz erschienen:
Verkündigung als Verpackungsproblem?