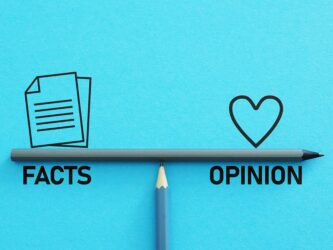Als Erfüllungsgehilfen gesellschaftlicher Ziele sind Mütter und Väter willkommen. Jenseits davon gelten die Entscheidung für Kinder und der Alltag mit ihnen als private Angelegenheit. Das muss sich ändern, und die Eltern könnten selbst dazu beitragen, meint Elisabeth Zschiedrich.
Die Bevölkerung altert und schrumpft? Mehr Geburten braucht das Land! Der Wirtschaft fehlt es an Fachkräften? Bildet die Kinder gut aus! Und Mütter, vor allem Ihr Akademikerinnen, beteiligt Euch am Arbeitsmarkt! Gleichberechtigung ist noch immer nicht erreicht? Väter, nehmt Elternzeit! Und Ihr Mütter, gebt Euch nicht mit Teilzeit zufrieden!
Antworten auf demografische, ökonomische und emanzipatorische Fragen werden gern bei den Familien gesucht. Das geschieht zwar selten in dieser Transparenz, sondern meist unter dem Deckmantel der Familienförderung. Es ist aber offensichtlich, dass die deutsche Politik und Wirtschaft etwa bei den zuletzt eingeführten Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht primär das Wohl der einzelnen Familienmitglieder und deren viel gepriesene „Wahlfreiheit“ im Blick haben. Im Vordergrund steht ein öffentliches Interesse an Müttern, Vätern und Kindern, der mehr oder weniger verdeckte Versuch, Familien für eigene Zwecke zu instrumentalisieren.
Eine „win-win“-Situation?
Tatsächlich ist die Rechnung der entsprechend neu eingeführten Anreizstrukturen (Einführung des Elterngeldes, Ausbau der Kinderbetreuung) in Deutschland erstaunlich gut aufgegangen: Die Geburten haben zeitweise zugenommen, die außerhäusliche Betreuung von Unter-Dreijährigen ist zum Normalfall geworden, der Anteil der erwerbstätigen Mütter hat sich deutlich erhöht, und die mit dem Elterngeld verbundenen „Vätermonate“ werden von einem Großteil der Familien in Anspruch genommen. Umfragen zufolge entspricht diese Entwicklung nicht nur dem Interesse von Politik und Wirtschaft, sondern häufig auch dem Wunsch der Eltern. Viele Menschen wünschen sich Kinder, Mütter möchten berufstätig sein, und Väter legen mehr Wert auf Zeit mit dem Nachwuchs. Eine gleichberechtigte Rollenverteilung ist das Ziel vieler Paare. Auf den ersten Blick scheint öffentliches und privates Interesse also wunderbar zusammen zu passen. Eine „win-win“-Situation, für die Einzelnen und für die Gesellschaft.
Nicht nur Wünsche, auch Zwänge
Dabei sind nicht alle Eltern aus freier Wahl doppelt berufstätig. Die Einkommen junger Menschen im Familiengründungsalter sind heute allgemein niedriger als die der vorhergehenden Generation. Viele Familien benötigen daher zwei Einkommen zur Sicherung ihres Existenzminimums. Ohne eigene Berufstätigkeit und finanzielle Autonomie droht im Alter und im Fall einer Trennung aufgrund der aktuellen Gesetzeslage zudem ein ernsthaftes Armutsrisiko. Und wer länger nicht berufstätig ist, muss mit einem erschwerten Wiedereinstieg rechnen. Familienphasen gelten häufig noch immer als verlorene Zeit.
Es sind also nicht nur Wünsche, sondern auch (reale oder gefühlte) Zwänge, die das Handeln der Einzelnen bestimmen und nicht wenige Familien an den Rand der Erschöpfung bringen. Gar keine Wahl haben dabei die Kinder. Sie werden nicht gefragt, wie viel Zeit sie in Krippen, Kitas und Schulen verbringen möchten. Die Antwort fiele je nach Kind, Alter und Betreuungssituation wohl sehr unterschiedlich aus. Fest steht jedenfalls: Nicht alle kommen auf ihre Kosten. Es ist inzwischen vielfach belegt, dass Krippenbetreuung für sehr kleine Kinder Stress bedeutet und der Umfang der Betreuungszeit das kindliche Wohlbefinden entscheidend beeinflusst. Auch ältere Kinder wünschen sich mehr Zeit mit ihren Eltern. Was der Wirtschaft hilft und die Gleichstellung befördert, entspricht also nicht zwangsläufig dem Wunsch der Familien und macht schon gar nicht automatisch die Kinder glücklich.
Widersprüchlichkeiten gelten als rein persönliche Herausforderung der Familien
Natürlich ist jede Familie anders. Ob und wie gut ihr Alltag funktioniert, ob der Stress dominiert oder alle relativ entspannt zusammenleben, hängt von vielen Faktoren ab. Es spielt eine Rolle, ob Eltern allein erziehen oder zu zweit, ob sie ein Kind haben oder mehrere, wie viel und wie flexibel sie arbeiten, wie groß der finanzielle Spielraum ist und ob Großeltern in der Nähe wohnen, die im Betreuungs-Notfall einspringen können. Die genannten Widersprüche der Vereinbarkeits- und Gleichstellungsdebatte und die dadurch entstehenden Konflikte kennt aber jede Familie. Wurden sie lange Zeit nur vom konservativen, häufig auch antiemanzipatorischen Lager problematisiert, kommt der tägliche „Wahnsinn“, den sich (vor allem doppelt berufstätige) Eltern zumuten, inzwischen journalistisch und auch in künstlicher Gestalt, etwa im Kinofilm, zur Sprache. Als gesellschaftlich relevante Angelegenheit wird dieser aber noch lange nicht verhandelt. Ihn zu durchleben und zu lösen, bleibt die private Herausforderung der Familien.
Niemand hat Eltern gezwungen, Kinder zu bekommen
Natürlich ist das so, könnte man sagen. Eltern haben ihre Lebensform heute in den allermeisten Fällen bewusst gewählt, nun sollen sie ihre Situation auch selbst bewältigen. Niemand hat sie gezwungen, eines oder gleich mehrere Kinder zu bekommen. Außerdem ist der Nachwuchs doch ein Geschenk, er bereichert das Leben, gibt Sinn und weitet den Horizont. Und es ist ja nicht so, dass der Staat Familien nicht finanziell unterstützte! Tatsächlich dominiert diese Einstellung den öffentlichen Diskurs. Und sie kennzeichnet nicht nur die Position derjenigen, die keine Kinder haben, sondern ist auch unter jungen Eltern verbreitet. Diesen Eindruck gewinnt zumindest, wer in die zahlreichen Blogs und Bücher schaut, in denen Frauen und Männer beschreiben, wie es sich anfühlt, Mutter oder Vater zu sein. Wie grausam, wenn das Baby schlecht schläft, wie schön, wenn es zum ersten Mal „Mama“ sagt, wie nervig, wenn die Geschwister streiten, wie anstrengend, wenn alle Tipps geben wollen. Eltern zu sein ist schrecklich schön, so herausfordernd und bereichernd, wie nichts anderes im Leben, lässt sich die Botschaft fast immer zusammenfassen.
Ob Kind oder Hund – einerlei: Privatsache!
Das ist natürlich nicht falsch und es ist sicher hilfreich, seine Mutter- oder Vater-Rolle genauer auszuleuchten, sich unter Eltern auszutauschen und gegenseitig Mut zu machen. Nur entsteht bei einer solchen, völlig unpolitischen Nabelschau der Eindruck, mit der Gesellschaft, ja, mit allem außerhalb der „Familien-Blase“, habe Elternschaft wenig zu tun. Als sei es mit Kindern wie mit Hunden. Die einen mögen sie und leben mit ihnen, interessieren sich dafür und kommunizieren darüber, die anderen mögen sie oder auch nicht, leben aber jedenfalls ohne. Eine Haltung, mit der man nirgendwo aneckt, die die Entscheidung für Kinder und das Leben mit ihnen aber auch als ganz und gar privat einordnet.
Die Gefahr, als reaktionär zu gelten
Mit Blick auf Elternschaft (und Kinderlosigkeit) politisch zu werden, erfordert Mut. Wer die Meinung vertritt, Kinder zu bekommen und großzuziehen sei keine reine Privatsache, sondern eine gesellschaftliche Leistung, die Anerkennung verdiene, wird schnell in eine reaktionäre, häufig auch antiemanzipatorische Ecke gerückt. Es verwundert daher nicht, dass sich vor allem die heutige Großväter-Generation zu diesem Thema äußert. Allzu leicht entsteht außerdem der Eindruck, man diskriminiere Menschen ohne Kinder, vergesse die, die ungewollt kinderlos blieben. Regelmäßig melden sich Autor*innen zu Wort, die sich über mangelnden Respekt, über Vorwürfe und Anfeindungen angesichts ihrer Kinderlosigkeit beklagen.
Eltern gegen Kinderlose auszuspielen, wäre in der Tat fatal. Aber es ist ebenso schädlich für unsere Gesellschaft, so zu tun, als sei Kinder zu haben ein aufwändiges Hobby, das jeder für sich selbst organisieren müsse.
Elternschaft in einem größeren Kontext betrachten
Man muss nicht das leicht angestaubte katholische Schlagwort von der Familie als „Keimzelle der Gesellschaft“ aus der Mottenkiste holen. Es ist aber an der Zeit, einige zuletzt tabuisierte Binsenweisheiten beim Namen zu nennen und Elternschaft wieder in einem größeren Kontext zu betrachten. Genau das ist das Anliegen der christlichen Sozialethik. Sie stellt den spezifischen Sinngestalt, den eigenen Wert von Familien heraus und betont deren Beitrag zum Bestand und zur Entwicklung der Gesellschaft. Dabei geht es ihr im Kern aber immer um die einzelnen Menschen als Personen, um deren Würde und Freiheit.
Dass überhaupt Kinder geboren werden, ist für eine Gesellschaft von entscheidender Bedeutung. Man braucht viel Phantasie, um einer vergreisenden Bevölkerung und verödenden Landstrichen Chancen abzutrotzen. Die Vorzüge einer jungen oder zumindest altersmäßig durchmischten Population liegen dagegen auf der Hand. Natürlich bekommt niemand Kinder für den Staat oder der Rente wegen. Die Entscheidung, Elternverantwortung zu übernehmen, ist aber auch nie eine rein private, sondern immer eine mit gesellschaftlichen Auswirkungen.
Gelungene Sorgearbeit wertschätzen
Wie die Kinder, die geboren werden, aufwachsen, ob sie gesund groß werden, sich zu gut ausgebildeten Erwachsenen und vor allem zu stabilen Persönlichkeiten entwickeln, ist für die Gesellschaft mindestens ebenso relevant. Bei dieser Frage spielen Eltern und Familien in den meisten Fällen immer noch die entscheidende Rolle. Familie, so heißt es im Apostolischen Schreiben Amoris laetitia, ist „der erste Ort, wo man lernt, gegenüber dem anderen eine Stellung zu beziehen, zuzuhören, mitzufühlen, zu ertragen, zu respektieren, zu helfen und zusammenzuleben.“ (AL 276)
Nun entwickelt sich die Persönlichkeit von Kindern zwar nicht allein im Elternhaus, sondern auch im Kontakt mit anderen gesellschaftlichen Institutionen. Allerdings ist es gerade der private Raum der Familie, der „die Möglichkeit individueller, nicht effizienzorientierter Zuwendung im Kontext persönlicher Beziehungen öffnet, die für die umfassende soziale und emotionale Entwicklung der Persönlichkeit von großer Bedeutung sind.“[1] Das mag man beklagen, wie es mit Blick auf die Abhängigkeit von Schulabschluss und Elternhaus regelmäßig geschieht. Man kann gelungene Sorgearbeit aber auch wertschätzen und so Mütter und Väter in ihrer Rolle bestärken anstatt sie als Helikopter-Eltern zu verspotten oder ihnen aus bildungspolitischer Sicht eine frühe Krippenbetreuung nahezulegen.
Familien brauchen mehr zeitliche und finanzielle Freiheit
Wir brauchen eine neue Debatte über die Würde und den Wert von Kindern und Familien, idealer Weise angestoßen von jungen Müttern und Vätern, die selbstbewusst, aber nicht selbstbezogen, bereit wären, für ihre Rolle und deren Wichtigkeit einzustehen. Gegenüber Arbeitgebern, gegenüber der Politik und auch gegenüber Menschen, die keine Kinder haben. Das hätte nichts mit mangelndem Respekt oder Diskriminierung zu tun, sondern damit, dass Eltern sich nicht länger instrumentalisieren ließen und aufhörten, die Konflikte der schönen neuen Gleichstellungs- und Vereinbarkeitswelt isoliert und in den eigenen vier Wänden mit ihren Kindern auszumachen. Dass sie stattdessen dafür kämpften, dass Familien die zeitlichen und finanziellen Spielräume bekommen, die sie brauchen, um nicht chronisch überlastet zu sein und ihr Leben gemäß den eigenen Werten und Zielsetzungen tatsächlich frei gestalten zu können.
Davon profitierten nicht nur die Kinder, sondern alle Familienmitglieder – und mit ihnen die ganze Gesellschaft.
—
Dr. Elisabeth Zschiedrich ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Arbeitsbereich Christliche Gesellschaftslehre der Universität Freiburg im Breisgau. Bild: Jürgen Jotzo – pixelio.de
[1] Jurczyk, Karin, Familie. Verschwinden oder Neustrukturierung des Privaten, in: Vorgänge (2008) Nr. 3, 4–15.