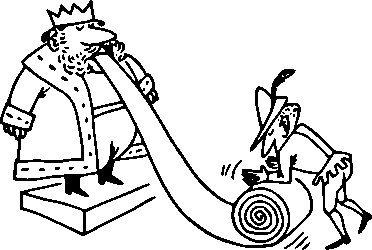Woran liegt es, dass religiöse Praxis und Glaube immer mehr zu Chimären werden – kaum mehr greifbar und in den überlieferten Formen zu leben? Joachim Negel geht dem in seiner Antrittsrede als Dekan der Theologischen Fakultät im schweizerischen Fribourg nach.
„Gaudet Mater Ecclesia quod, singulari Divinae Providentiae munere, optatissimus iam dies illuxit, quo […] Concilium Oecumenicum Vaticanum Secundum sollemniter initium capit.“[1] Es ist merkwürdig, meiner ersten Fakultätsratssitzung als neuer Dekan an einem 11. Oktober vorzustehen, noch dazu in diesem Jahr. Denn alle, die mit der jüngeren Kirchengeschichte auch nur ein wenig vertraut sind, wissen, dass heute vor genau 60 Jahren der damalige Papst Johannes XXIII mit den eingangs zitierten Worten das Zweite Vatikanische Konzil eröffnete.
Wir alle, die wir hier sitzen, sind Kinder oder Enkel dieses Konzils. Um für mich selber zu sprechen: Als das Konzil eröffnet wurde, war ich noch kein Jahr alt. Als es 1965 endete, besuchte ich den Kindergarten. Seine augenfälligsten Umbrüche, etwa in Gestalt der Liturgiereform, habe ich selber gar nicht mehr als Umbruch erlebt, die jetzige Liturgie ist die, in der ich großgeworden bin, hingegen mein vier Jahre älterer Bruder hatte als Achtjähriger noch das lateinische Stufengebet auswendig lernen müssen, jene Zwiesprache zwischen Priester und Ministrant am Beginn der Messe: „Introibo ad altare Dei. Ad Deum qui laetificat juventutem meam.“ – Was für ein herrliches Psalmwort!
Haben wir Theolog.innen der Aufgabe genügt?
Das Konzil wollte die Kirche wieder jung machen; es sollte, wie Johannes XXIII., dessen Gedenktag wir heute begehen, in seiner Eröffnungsrede forderte, dafür sorgen, dass „die sichere und beständige Lehre [der Kirche ‹…›] so erforscht und ausgelegt werde, wie unsere Zeit es verlangt.“[2] Haben wir als Theologinnen und Theologen (egal ob auf Professor*innen- oder Studierendenseite), hat die Generation vor uns dieser anspruchsvollen Aufgabe genügt? Vielleicht ja. Vielleicht auch eher nicht. Ich wage keine Antwort. Aber bisweilen überkommen mich Zweifel, ob das, was wir tun, dem Auftrag des Konzils gerecht wird: den Brückenschlag wagend, die Liebe Gottes, die aufgestrahlt ist in Jesus Christus, in die heutige Zeit zu übersetzen. Ob das Konzil selber nicht vielleicht überhaupt auf halbem Wege stehen geblieben ist?
Neben manch anderem mag der Zweifel, den ich hier artikuliere, wohl darin begründet sein, dass das Konzil in der Aufbruchsstimmung, die es freigesetzt hatte, selber zu optimistisch war. Die elementaren Fragen, die im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zur sogenannten Modernismuskrise in der Katholischen Kirche geführt hatten (Verunsicherung durch die historisch-kritische Bibelexegese, durch die verstörenden Entdeckungen der Evolutionsbiologie und der modernen Kosmologie, durch die politischen Umbrüche in Europa, durch die Technisierung und Industrialisierung der Lebenswelt, schließlich die beunruhigende Vervielfältigung der philosophischen Zugangsweisen zur Welt und damit einhergehend die Vervielfältigung der Wahrheitsperspektiven) – alle diese Probleme und Verunsicherungen, Schwierigkeiten und Zweifel waren seitens der Kirche ja kaum je wirklich wahr- und ernstgenommen, geschweige denn seriös beantwortet worden.
Das Empfinden der Befreiung war in Überdruss umgeschlagen
Man hatte sie lange Zeit einfach autoritär klein gehalten (erinnert sei nur an den Antimodernisteneid, der bis 1967 in Geltung stand und den mein Heimatpfarrer und meine Religionslehrer noch ablegen mußten). Und das rächte sich jetzt. Das Empfinden der Befreiung, des Aufatmens, das den Katholizismus in seiner Mehrheit in den Jahren zwischen 1959 und 1966 beseelt hatte, war seit den 1970er Jahren bei vielen in Überdruss umgeschlagen. Man war innerlich längst auf Abstand gegangen, daran änderte auch eine etwas moderner gehaltene Liturgie nichts.
Der lange Pontifikat Johannes Pauls II. mochte zwar noch einmal neue Akzente setzen; das persönliche Charisma dieses Papstes und sein geradezu seismographisches Gespür für die politischen Veränderungen in seiner Heimat und im ganzen damaligen Ostblock haben der Kirche für eine gewisse Zeit neue Aufmerksamkeit, z.T. geradezu Bewunderung eingebracht. Aber ist dadurch der christliche Glaube plausibler geworden? Ist das Programm von „fides et ratio“, das Papst Johannes Paul II unter Federführung des damaligen Präfekten der Glaubenskongregation Joseph Ratzinger formuliert hatte, gelungen? Haben sich die Glaubenszweifel durch den 2.865 Artikel zählenden Weltkatechismus, der 1993 eingeführt wurde, verringert? Wer in unseren Gemeinden liest eigentlich diesen Katechismus? Wer lebt mit ihm?
Auch und nicht zuletzt die DNA der katholischen Kirche führt in die Krise
Aber damit nicht genug. Seit mehr als zehn Jahren (und in manchen Gegenden, insbesondere in Nordamerika, schon beträchtlich länger) befindet sich unsere Kirche in einer Krise, für die man nun wirklich nicht mehr „die böse Welt“ verantwortlich machen kann oder den fortschreitenden Säkularismus; diese Krise ist von ihr selber, sie ist von uns verschuldet. Sie wissen, wovon ich spreche: die Missbrauchskrise. Sie ist keine Krise einzelner Ortskirchen. Was uns aus den US-amerikanischen Diözesen und einem noch bis vor wenigen Jahren so tiefkatholischen Land wir Irland entgegenbrandet, was in den vergangenen Jahren in den deutschen Bistümern, in Österreich, Polen und Frankreich an den Tag kam, sind nicht lokale Einzelfälle.
Mehr und mehr wird deutlich, dass wir es hier mit einem systemischen Versagen zu tun haben, das, wie der Hildesheimer Bischof Heiner Willmer es in einem plakativen Bild ausdrückt, „in der DNA der katholischen Kirche“ selber begründet liegt. Papst Franziskus hat im Grunde ähnliches gesagt, als er den Klerikalismus als „ein Grundübel der Kirche“ gebrandmarkt hat, als eine regelrechte „Perversion“. Und hat er damit nicht den Finger auf die Wunde gelegt? So wenig ich mit den Brüdern und Schwestern in den Kirchen der reformatorischen Tradition tauschen möchte, so sehr gibt es mir zu denken, dass die Missbrauchsfälle, die es natürlich auch bei ihnen gibt, zahlenmäßig signifikant unter denen in unserer Kirche liegen. Es möge keiner sagen, dies sei Zufall, und überhaupt gebe es Missbrauch überall, etwa im Sport, in den Familien usw. So richtig das ist, so oberflächlich ist solche Rede. Denn die vielen Missbrauchsfälle in unserer Kirche haben in der überwältigenden Mehrheit eine sehr römisch-katholische Färbung, d.h. sie haben nicht zuletzt mit den sehr speziellen Herrschaftsstrukturen unserer Kirche zu tun.
Unsere Fakultät selbst ist betroffen
Warum erzähle ich dies alles? Ich erzähle es, weil es uns als Theologische Fakultät der Universität Fribourg an der Schnittstelle zwischen den beiden Kulturen, der deutschen und der französischen, elementar betrifft. Die Missbrauchskrise ist nicht irgendeine Krise; sie erschüttert uns bis ins Mark, ob wir dies wahrhaben wollen oder nicht. 330.000 Fälle seit den 1950er Jahren in den französischen Bistümern und Ordensgemeinschaften listet allein der „Rapport Sauvé“ auf, der vor ziemlich genau einem Jahr veröffentlich wurde [3] – und das sind nur die belegbaren Fälle, die ans Tageslicht kamen; die Dunkelziffer dürfte erheblich höher sein). Die französische Öffentlichkeit steht seitdem unter Schock. Und wir sind von diesen Vorfällen ja nun auch an unserer eigenen Fakultät betroffen gewesen (ich erspare es uns, hier konkreter zu werden) [4].
Deswegen bin ich froh, daß wir uns als Fakultät vor einem Jahr wenigstens darauf einigen konnten, der Straßburger Moraltheologin Marie-Jo Thiel das Ehrendoktorat unserer Fakultät zu verleihen, wenn es uns schon nicht gelungen war, dem französischen Regisseur François Ozon diesen Titel anzutragen. Es wäre für die französische Öffentlichkeit und – ja – auch und gerade für die französische Kirche ein großartiges Zeichen gewesen. Wir hier als Fakultät in der französischsprachigen Schweiz haben da mehr Freiheit als unsere Kolleginnen und Kollegen in Frankreich selbst.
Wo sollen sie denn herkommen, die Studierenden?
Und damit sind wir bei einem schwierigen Thema angelangt, das uns natürlich auch als Fakultät elementar berührt, auch wenn wir vermutlich selbst auf lange Sicht wenig daran ändern können: Ich meine das Problem die Studierendenzahlen an unserer Fakultät, die natürlich auch und nicht zuletzt von dem Ansehen abhängen, das Glaube und Gebet, Religion und Kirche in der Öffentlichkeit genießen. Zwar sind viele der Probleme, an denen wir als Katholische Kirche herumlaborieren, hausgemacht. Insgesamt aber müssen wir feststellen, wie tiefgreifend der Ansehensverlust von Glaube und Religion (und nicht zuletzt des Christentums insgesamt) in der Öffentlichkeit ist.
Wo sollen unsere Studenten denn herkommen, wenn den entsprechenden religionssoziologischen Studien zufolge sich nur noch etwa 50 % der heranwachsenden Generation in der Schweiz als „religiös“ bezeichnen, und gerade noch 4 % unter ihnen sich als ihrer Kirche verbunden erleben. (Die Zahlen in Frankreich und Deutschland sind nicht besser.) Das spüren natürlich auch die Theologischen Fakultäten in unserem Land: Fribourg, Luzern, Chur und Lugano; die Kollegen an den Reformierten Fakultäten in Zürich, Basel, Bern, Lausanne und Genf erleben es nicht anders. (Um nur eine Zahl zu nennen, die ich gerade erfahren habe: An der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität München hat es für dieses Wintersemester ganze vier Einschreibungen gegeben. Vier!)
Was ist da eigentlich passiert in diesen letzten Jahrzehnten?
Und so wäre zu fragen, was da eigentlich passiert ist in den Jahrzehnten, die seit dem Konzil hinter uns liegen. Es springt ja geradezu ins Auge, wie sehr im Zuge der kulturellen und lebensweltlichen Umbrüche in den vergangenen zwei Generationen das gesamte Glaubensbild und -gefüge christlicher Religion langsam und unmerklich an Leuchtkraft und Überzeugungsmacht eingebüßt hat. Zwar verlor man den Glauben nicht von heute auf morgen wie eine Geldbörse oder einen Schlüsselbund; er hörte nur langsam auf, dem Leben Gestalt zu geben, er wurde chimärisch, entfärbte sich ins Unwirkliche.
Letztlich, so scheint es mir, haben sich Gestalt und Horizont Gottes selbst verdunkelt – und so stehen wir da in unserem kurzen Hemd und frösteln (es ist nie angenehm, zu einer kognitiven Minderheit zu gehören). Ich zitiere stellvertretend für viele die Kölner Journalistin Vilma Sturm (1912 – 1995), die in ihren autobiographischen Aufzeichnungen diesen fast unmerklichen und doch unerbittlich wirkenden Vorgang folgendermaßen beschrieben hat:
„Ich blieb in der Agneskirche zu Hause, fand dort mein Genügen, für eine Weile noch. Dann ging das zu Ende. Dann glitt ich, wie ein Boot, ohne Segel, ohne Ruderschlag, nur von der Strömung getrieben, fort. Gewiß lag das nicht an diesem oder jenem Versagen der Kirche; die war uns ja lange schon (mit Ausnahme des Papstes Johannes) eher gleichgültig gewesen, eine zum Widerspruch herausfordernde Institution. Aber warum wandten wir uns mit der Zeit auch von Gemeinde und Gottesdienst ab, damit auch von Bibel und Gebet, damit schließlich überhaupt von jeglicher ausdrückbaren Frömmigkeit? Ich weiß es nicht. Ich befinde mich mitten in einem Prozeß der Ablösung, die an mir geschieht, ohne daß ich es will. […] Kaum sind noch die Gestade sichtbar, von denen ich kam; und die Worte, die Namen, die ich einmal hatte, um das Heilige zu benennen, haben sich in Nebel aufgelöst.“[5]
Dieser Entwicklung, die sich bei vielen findet, vermutlich auch bei manchem von uns selbst, müssen wir uns als Theologische Fakultät stellen. Wir müssen dem Unglauben (auch dem eigenen, nicht nur dem der anderen) ins Auge sehen, jener merkwürdigen Gemütswandlung auf den verschiedensten Ebenen, die unsere (west)europäischen Gesellschaften in den Schwellenjahren nach 1945, 1968 und 1989 von Grund auf verändert hat und mit ihr jeden einzelnen.
Was wissen wir denn über unsere Zukunft?
Mir scheint dies zuletzt eine viel wichtigere Aufgabe zu sein als noch ein weiteres und noch ein weiteres Studienprogramm aufzulegen, das dann doch wieder nur von zwei oder drei Studenten belegt wird. Wir sind das nicht nur der Kirche, wir sind das unserer Gesellschaft und dem Schweizer Staat bzw. dem Kanton Freiburg schuldig (immerhin finanzieren diese uns auf großzügige Weise – und sie haben mit Recht Erwartungen an uns). Was jene merkwürdige Gemütswandlung auf den unterschiedlichsten Ebenen der Gesellschaft anlangt, so ist ja folgendes unhintergehbar: Wir sind längst nicht mehr nur kirchlich oder religiös in hohem Maße unserer ideologischen Sicherheit entblößt; sondern in all dem ist noch eine viel grundsätzlichere Unsicherheit über unsere Zukunft entstanden:
Kein Mensch, völlig unabhängig von seinen weltanschaulichen oder intellektuellen Überzeugungen, weiß, wie sich in den kommenden Jahrzehnten das Verhältnis von Individualität, Selbstbestimmung und Gemeinschaft in gesellschaftlichen Lebensformen wie zum Beispiel der Ehe entwickeln wird (Stichwort „Gender“); kein Mensch weiß, ob und wie sich ein Wahrheitsbegriff unter unseren pluralen Gesellschafts- und Erkenntnisverhältnissen durchhalten oder neu gewinnen läßt (Stichwort „Postmoderne“, „Alternative Fakten“); kein Mensch weiß, wie er sich auf Dauer definieren wird in Hinsicht auf Arbeit und Freizeit (Stichwort „Berufliche Lebensgestaltung“); kein Mensch weiß, wie es auf Dauer weitergehen wird mit dem Zusammenhang von Industrialisierung und Ökologie (Klimakatastrophe), internationaler Zusammenarbeit und Sicherheit (Ukrainekrieg und Migrationsbewegung), mit der Zukunft der Demokratie (ich nenne nur die Namen Donald Trump, Giorgia Meloni, Marine Le Pen).
Das Unüberschaubare ansehen
Das alles spielt auch für uns als Theologische Fakultät eine eminente Rolle. Denn wir sind Teil der Gesellschaft. Was die Gesellschaft befällt, befällt auch die Kirche; was die Kultur befällt, befällt auch die Religion. Wer hätte sich vor drei Jahren auch nur im Traum vorstellen können, daß eine Pandemie unser Leben auf Monate stillstellen würde?
Für eine Theologische Fakultät, die sich von diesen Fragen beunruhigen und inspirieren läßt, gibt also viel zu tun, vielleicht mehr als vor 60 Jahren, als das Zweite Vatikanische Konzil seinen Anfang nahm – denn die Konzilsväter lebten zuletzt dann doch in einer immer noch irgendwie überschaubaren Welt, zumindest bildeten sich viele von ihnen dies ein.
Seitdem ist religiös wie kulturell kaum noch etwas so, wie es im Oktober 1962 war; nicht nur der gesellschaftlichen Anerkennung, die wir über Jahrhunderte wie selbstverständlich in Anspruch nehmen konnten, sind wir in weiten Teilen entblößt – und dies wohl auch mit gutem Grund; auch unsere dogmatische Sicherheit ist uns in weiten Teilen abhandengekommen. Aber vielleicht gibt uns diese Entblößung ja den Mut und die Wut, das Unglaubliche der christlichen Botschaft neu zu entdecken: dass Gott und Mensch nicht zu trennen sind, weil in dem Menschen Jesus von Nazareth der Ewige Logos sich unauflöslich in die Menschengeschichte hineingegossen hat. Dass sich schlechterdings alles änderte – in Kirche wie Gesellschaft, für Kultur wie Religion –, wenn man dies zu glauben begänne, das liegt auf der Hand.
[1] Allocutio Ioannis XXIII PP. In solemni SS. Concilii Inauguratione [Art. 1]: „Mutter Kirche freut sich, daß durch ein einzigartiges Geschenk der göttlichen Vorsehung nun der ersehnte Tag angebrochen ist, an dem […] das Zweite Ökumenische Konzil des Vatikans feierlich beginnt.“
[2] Ebd. Nr. 6: „[…] oportet ut haec doctrina certa et immutabilis, cui fidele obsequium est praestandum, ea ratione pervestigetur et exponatur, quam tempora postulant nostra.“
[3] Veröffentlicht am 22. Oktober 2021 (Quelle: https://www.la-croix.com/Religion/Abus-sexuels-lEglise-telechargez-resume-rapport-Sauve-2021-10-22-1201181811 [aufgerufen am 11. 10. 2022]).
[4] https://fr.wikipedia.org/wiki/Abus_sexuels_dans_la_communaut%C3%A9_Saint-Jean (abgerufen am 10. 10. 2022). – https://www.arte.tv/fr/videos/078749-000-A/religieuses-abusees-l-autre-scandale-de-l-eglise/ (abgerufen ebd.).
[5] Vilma Sturm, Barfuß auf Asphalt. Ein unordentlicher Lebenslauf, Köln 1981, hier zitiert nach der DTV-Ausgabe München 1985, 463f.
—

Joachim Negel ist Professor für Fundamentaltheologie an der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg i.Ue./Schweiz. Momentan (2022-2023) steht er der Fakultät als Dekan vor.
Bild: PeeF – pixelio.de