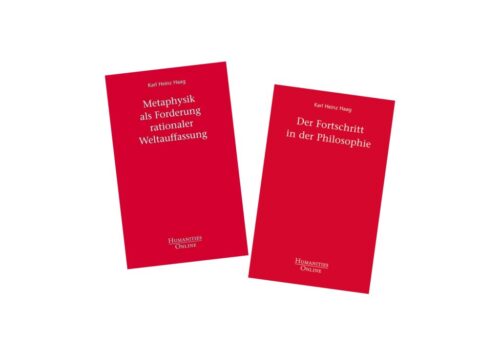Richard Q.H. Beilmann stellt das Denken des Frankfurter Philosophen Karl Heinz Haag vor und zeigt seine weitgehend ungehobene Bedeutung für die Theologie.
Wie schön wäre eine Welt, in der es Gewissheiten gibt? Insbesondere die Theologie darf sich einer Gewissheit nicht verschließen; sie würde ziellos und bedeutungslos. Diese Gewissheit ist Gott. Jedes argumentative Gerüst der Theologie führt sich ohne ihn ad absurdum und offenbart sich als eine menschgemachte Behauptung. So wurde auf feinschwarz.net vor einiger Zeit ein Buch rezensiert, das „Atheistisch glauben“ heißt und Gott als „rein innerweltliche Größe“ begreift[1] – als etwas Artifizielles. Diese Perspektive ist weit verbreitet. So erscheint der Schritt in einen sich metaphysisch begründenden Gottesglauben vielen als irrational. Gott gilt als Verklärung, nicht als Erklärung. Für Gläubige hingegen erscheint Gott als logische Kategorie ihrer Weltdeutung.
Nun leben wir in Zeiten fortschreitender Säkularisierung. Diese führt das Erbe vom toten Gott fort und verbannt die Religion ins Subjektive. Wenn aber Religion nur mehr subjektiv ist, kann Kirche nicht gesellschaftsfähig sein. Es gibt also ein Problem: Gott gilt landläufig weder als weltanschaulich objektiv noch als rational.
Dieses Problem erkennend, können wir uns seiner Lösung zuwenden. Unter den vielen Philosophen, die sich der Gottesfrage widme(te)n, gab es einen, der auf diese eine Frage sein ganzes Leben versetzte: Karl Heinz Haag. Geboren 1924 in Höchst, lehrte er später in Frankfurt und wurde früh als Nachfolger Adornos gehandelt, doch zog Haag sich wieder nach Höchst zurück und verbrachte seine verbleibenden vier Jahrzehnte in Klausur. Nun kann man der Frankfurter Schule bekanntlich keine Schwärmerei vorwerfen und auch Haag war kein philosophisch-theologischer Romantiker. Er arbeitete sich durch die Geistesgeschichte und veröffentliche schließlich zwei Bücher, die in Summe kaum dreihundert Seiten besitzen. Die darin vorgestellten Gedanken möchte ich nachfolgend skizzieren, dabei wird natürlich die Argumentation massiv verkürzt. Eine solche Reduktion wird dem Werk nicht gerecht, muss aber an dieser Stelle genügen.
Das erste Buch ist Der Fortschritt in der Philosophie. Der Text beginnt schonungslos: „Durch die Geschichte der Philosophie von der Antike bis in die Gegenwart zieht sich ein Problem (…) das aber nie gelöst worden ist. (…) Es ist das Problem der objektiven Möglichkeit von erscheinender Natur (…)“[2] Eine der Urfragen des Denkens ist darin benannt: Warum und wie ist Welt möglich? Sie bildet den Rahmen seiner Betrachtung. Er schreibt: Der moderne Positivismus, der „von transzendenten Dingen nichts wissen will (…) hat seine Vorgeschichte in der klassischen Metaphysik.“[3] Die Genese dieses Denkens, das folglich auch von Gott nichts wissen will, verfolgt er aufmerksam. Die Moderne nennt er eine „platonische Höhle – diesmal aber ohne Ausgang.“[4] Den großen Fehler, der uns in diese Höhle führte, erkennt er in dem Versuch, das Wesen der Dinge positiv zu bestimmen. Wer sagt, er habe das Wesen z. B. des Menschen in einer empirisch bestimmbaren Eigenschaft erkannt, hat es bereits verkannt. Ein Beispiel: Wer sagt, sein Wesen sei die Zweibeinigkeit, wird beim Anblick eines einbeinigen Menschen ziemlich irritiert sein (und der einbeinige Mensch empört). Auch jede andere positive Wesensbestimmung dieser Art wird scheitern.
Moderne als platonische Höhle ohne Ausgang
Infolge dieser Unmöglichkeit galt die Suche nach dem Wesen der Dinge als irrational. Nominalismus ist hier der Schlüsselbegriff. Langfristig fiel auch Gott diesem Denken zum Opfer. „Irrational ist aber auch die Forderung des Nominalismus, nämlich aus der Unmöglichkeit, das Wesen von Seiendem positiv zu bestimmen, den Schluss zu ziehen, Wesen sei ein sinnloser Begriff.“[5] Haag verlangt also, sich einer anderen Denkoption zuzuwenden: der s.g. negativen Metaphysik (negativ meint unbestimmbar). Kurz: Der Tod Gottes ist also eine Folge teilweise irrationaler philosophischer Systeme, die bestrebt waren, sich „ein Bildnis zu machen“ von dem, das hinter dem Sichtbaren ist: das Wesen des Seienden positiv zu bestimmen. Aus Haags Analyse lässt sich also auch der Vorwurf ableiten, dass die Geistesgeschichte sich insgesamt dem Bilderverbot widersetzte und Gott negierte, weil sie ihn nicht abbilden konnte.
Dass wir aber die Metaphysik brauchen, zeigt Haag daran, dass unsere Naturwissenschaft auf metaphysischen Grundlagen ruht. Zum Beispiel der Prämisse, dass die Naturgesetze, die wir in der Welt erkennen, tatsächlich ihre innere Ordnung spiegeln – andernfalls könnte man ja vermuten, dass wir in eine chaotische Welt hinein gewisse Ordnungen konstruieren, die uns helfen, mit ihr umzugehen, aber keine Rückschlüsse auf ihre eigentliche Struktur erlauben. Letzteres hieße, ihre metaphysischen Grundlagen zu durchdenken! Andernfalls befinden wir uns in „eine(r) Weltanschauung, die in allen Entschlüssen (…) eine gewisse Priorität des Irrationalismus anerkennt‘.“[6] Diesem will Haag sich nicht unterwerfen und damit gelangen wir zum zweiten Buch.
die Metaphysischen Grundlagen naturwissenschaftlichen Denkens
Es heißt Metaphysik als Forderung rationaler Weltauffassung und stellt die Fortsetzung des ersten dar. Dort zeigt er, dass von Seiten der Philosophie ein negativer Schritt in die Metaphysik Bedingung ihrer Rationalität ist – negativ ist die philosophische Entsprechung des Bilderverbots: Man muss akzeptieren, dass das Wesen der Dinge nicht positiv bestimmbar ist, aber zugleich darf man die Annahme eines Wesens nicht über Bord werfen. Warum sollen wir aber an diesem metaphysischen Denken festhalten? Weil wir andernfalls irrational denken und handeln.
Aber Haag zeigt auch, dass die Naturgesetze selbst nach einem weiteren metaphysischen Prinzip verlangen, denn: „physikalische Gesetze sind partikuläre Gesetze, die für ihr Zusammenwirken in Naturprozessen ein planendes Prinzip erfordern.“ [7] Dieses Koordinationsprinzip ist nur metaphysisch zu denken, denn es ist nicht empirisch zu ermitteln. Aber es anzunehmen ist rational. Erst daraus folgt, dass die Welt rational gestaltet ist, woraus wiederum folgt, dass auch unsere Wissenschaft rational genannt werden darf. Denn: Gäbe es ein solches Prinzip nicht, wäre die Welt nicht geordnet und wir könnten sie nicht erforschen: „Die antimetaphysische Abstraktion von [diesem Prinzip] führt nicht zu einer Natur, die sich selbst zu organisieren weiß, sondern endet in einer Kosmologie, in welcher (…) der Zufall das Absolute wäre.“[8] Die Metaphysiker können das Seiende und damit sich selbst als Produkt rationalen Willens begreifen – die anderen als Produkt des schieren Zufalls, der seinerseits an die Stelle tritt, die vormals Gott genannt wurde. Der Zufall aber kann keine Naturgesetze hervorbringen. Haag identifiziert dieses Ordnungsprinzip mit dem monotheistischen Gott.
Er fasst zusammen: „Der Weg von exakter Naturerkenntnis zu rationaler Naturerklärung ist der Weg in die Dimension des Metaphysischen. Sie besteht zutiefst in dem für Menschen unergründbaren Sein und Wirken der Gottheit [oder philosophisch-prosaisch: dem Prinzip]. Der negative Schritt in diese Dimension ist vermöge seiner gnoseologischen Basis, die er im Durchdenken kosmischen Geschehens hat, ein rationaler Schritt.“[9] Dieser Satz bildet die Essenz des Werkes. Er klingt in der Tiefe seiner Bedeutung beinahe vermessen, wäre nicht die gesamte Argumentation des Buches von einer rationalen Strenge, die die Aussage bloß noch das Produkt der vorangegangenen kritischen Untersuchung sein lässt.
Haag erarbeitet in seinen Büchern, dass die geschichtliche Verwerfung Gottes irrational und dass die Annahme Gottes – gerade im Dialog mit den Naturwissenschaften! – Bedingung ihrer Rationalität ist. Haag zeigt nicht mehr und nicht weniger, als dass Gott nicht bestimmbar ist, aber auch, dass es in die Irrationalität führt, ihn zu negieren.
Gott als unbestimmbar und zugleich um der Rationalität Willen nicht zu negieren
Haag war kein Theologe und wenn er von Gott schreibt, dann gibt es keine Offenbarung oder Glaubensinhalte. Im Gegenteil spricht er – als Philosoph – ausdrücklich von einer Entmythologisierung der Religion. Aber die Theologie ist ihm ein eigenes Kapitel wert. Dort bezeichnet er das Denken der modernen Theologen als paradox: Wenn Ratzinger vom „Abenteuer des Glaubens“[10] schreibt oder Küng sagt „Gottesglaube ist (…) meine Tat“[11], dann erkennt Haag mit Recht: Hier wird der Mensch „in Ungewissheit gelassen, ob ein Gott überhaupt existiert“ – mehr noch: „Gott ist nicht mehr der Allmächtige, sondern der Mensch ist es in seinem Belieben. Gegen die Pluralität des profanen Angebots von Sinn deklariert er Gott als den Sinn seines Lebens. Wie in Pascals berühmter Wette wird Gott zum Gegenstand eines Glücksspiels. (…) Anders argumentieren auch die modernen Theologen nicht.“[12] Damit ist Religion etwas rein Subjektives: Der einzelne Mensch soll nach eigenem Ermessen entscheiden. Aber: „Eine Theologie, die vor kritischem Denken bestehen will, braucht eine rationale Grundlage. Zumindest eines muss für sie gewiss sein: daß es einen Gott gibt.“[13] Diese Grundlage, so gut es nur geht, liefert Karl Heinz Haag. Sein langfristiges Ziel: „Was einem Denken auf nominalistischem Boden nicht gelingen kann, erscheint möglich: die geistige Überwindung des modernen Nihilismus.“[14]
So sehr sich der 2011 verstorbene Haag um kritische Rationalität bemühte, so ist das beinahe Vergessensein der Preis für die Schärfe seiner Arbeit. Was Haag fehlt, ist Wirkung. Was der Theologie fehlt, ist Haag.
—
[1]https://www.feinschwarz.net/man-meint-er-spreche-von-gott/
[2]Karl Heinz Haag: Der Fortschritt in der Philosophie, Frankfurt am Main, Humanities Online, 2005, S. 9.
[3] Karl Heinz Haag: Der Fortschritt in der Philosophie, Frankfurt am Main, Humanities Online, 2005, S. 10
[4] Karl Heinz Haag: Der Fortschritt in der Philosophie, Frankfurt am Main, Humanities Online, 2005, S. 11
[5] Karl Heinz Haag: Der Fortschritt in der Philosophie, Frankfurt am Main, Humanities Online, 2005, S. 215.
[6] Karl Heinz Haag: Der Fortschritt in der Philosophie, Frankfurt am Main, Humanities Online, 2005, S. 215.
[7]Karl Heinz Haag: Metaphysik als Forderung rationaler Weltauffassung, Frankfurt am Main, Humanities Online, 2005, S. 112.
[8] Karl Heinz Haag: Der Fortschritt in der Philosophie, Frankfurt am Main, Humanities Online, 2005, S. 215
[9] Karl Heinz Haag: Metaphysik als Forderung rationaler Weltauffassung, Frankfurt am Main, Humanities Online, 2005, S. 112
[10]Joseph Ratzinger: Einführung in das Christentum, München, Kösel, 2000, S. 17
[11]Hans Küng: Was bleibt, Kapitel 1, München, Piper, 2013.
[12] Karl Heinz Haag: Metaphysik als Forderung rationaler Weltauffassung, Frankfurt am Main, Humanities Online, 2005, S. 114.
[13] Karl Heinz Haag: Metaphysik als Forderung rationaler Weltauffassung, Frankfurt am Main, Humanities Online, 2005, S. 115.
[14] Karl Heinz Haag: Metaphysik als Forderung rationaler Weltauffassung, Frankfurt am Main, Humanities Online, 2005, S. 117.

Richard Q.H. Beilmann arbeitet im Spannungsfeld von Architektur, Literatur und Kunst. Studium der Architektur in Frankfurt, Berlin, Graz; zuletzt architekturtheoretische Arbeit über die römischen Sakralbauten um 1600.