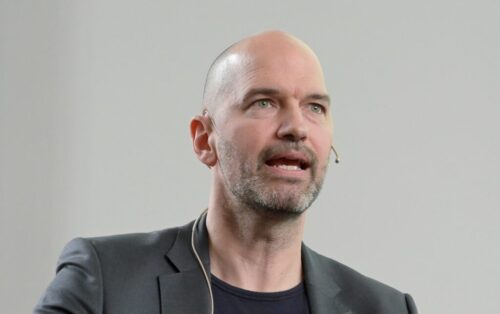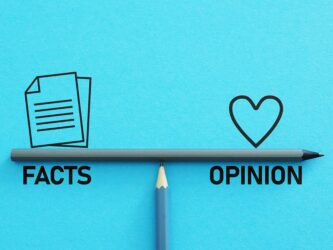Peter G. Kirchschläger (Luzern) über ein Modell, wie ethische Entscheidungen gefällt werden können. See the Reality – Analyze the Reality from a Moral Standpoint – Be the Ethical Judge – Act Accordingly, abgekürzt: SAMBA. Und er spielt dieses Modell an unterschiedlichen Fragestellungen durch.
1. Die Notwendigkeit ethischer Entscheidungen
Die Veränderungen unserer Lebenswelt eröffnen uns Menschen erweiterte Handlungsspielräume und stellen uns gleichzeitig vor neue Herausforderungen mit gesamtgesellschaftlicher Relevanz. Technologiebasierte Innovationen lassen den Teil der Realität wachsen, den Menschen erschaffen haben.[1] Für diese «Weltherstellung»[2] tragen die Menschen die Verantwortung.[3] Dabei wächst das Bedürfnis nach ethischer Orientierung in dieser komplexer werdenden Welt, die uns mit zahlreichen grundlegenden Fragen mit neuer Dringlichkeit konfrontiert: Wie begegnen wir globalen Problemen wie Armut, Pandemien oder Klimazerstörung? Wie gehen wir verantwortungsvoll mit erweiterten Handlungsmöglichkeiten in Biotechnologie um? Wie sind die berechtigten Freiheitsansprüche einzelner Menschen und jene der Gesellschaft miteinander zu verbinden?
Im Fokus steht, was Menschen tun sollen bzw. was Menschen nicht tun sollen.
Ethische Entscheidungen sind gefragt. Ethische Entscheidungen sind gefordert – sei dies auf einer individuellen Ebene (Mikro-Ebene), auf der Ebene von Organisationen (Meso-Ebene) oder auf der Ebene von Gesellschaften, Institutionen oder globaler Gesellschaft (Makro-Ebene). Im Fokus steht, was Menschen tun sollen bzw. was Menschen nicht tun sollen. Diese Sollens-Fragen stellen sich nur, wenn Menschen mit Freiheit gedacht werden. Dank der Freiheit steht Menschen die Entscheidung offen, zwischen „gut“ und „schlecht“ bzw. zwischen „richtig“ und „falsch“ zu wählen. Die Ethik als Wissenschaft charakterisiert schliesslich ihre Praxisorientierung. Ethik informiert ethisches Handeln, indem sie wie ein Kompass [4] ethische Orientierung stiftet.
Als Wissenschaft, die über Moral nachdenkt, strebt die Ethik auf rationale, logisch kohärente, methodisch-reflexive und systematische Weise nach Wissen darüber, was sein soll. Die Ethik bemüht sich um eine universell, auch generationenübergreifend begründbare Vorstellung von richtig und falsch sowie von gut und schlecht. Universalität als notwendiges Merkmal von Ethik, ethischen Aussagen, ethischen Prinzipien und ethischen Normen setzt die Erfüllung des Prinzips der Verallgemeinerbarkeit durch rationale und plausible Argumente voraus. „Gute Gründe“ sind vorzutragen. Ein Modell, wie „gute Gründe“ identifiziert bzw. Kriterien formuliert werden können, die „gute Gründe“ von anderen Gründen unterscheiden, ist das Folgende: „Gute Gründe“ bedeutet, dass es denkbar sein muss, dass alle Menschen in ihrer effektiven Freiheit und Autonomie sowie in ihrer vollen Gleichheit diesen Gründen – innerhalb eines Denkmodells und nicht innerhalb einer realen weltweiten Volksabstimmung – aus ethischen Gründen zustimmen würden.[5]
Die Notwendigkeit einer rationalen Begründung ist Ausdruck der Achtung und des Respekts vor der Freiheit und Menschenwürde jedes einzelnen Menschen, vor der Pluralität der säkularen Gesellschaft und auch der Ethik selbst.
2. Freiheit und Menschenwürde als Prinzipien aller Prinzipien
Das ethisch Gebotene sollte sich auch im Bedingten der sich verändernden Realität nicht von Tag zu Tag ändern. Dies erreicht die Ethik durch die Orientierung an ihrem Kern des vernunftbasierten Unbedingten, das von den zwei Prinzipien aller Prinzipien der Ethik, Freiheit und Menschenwürde, konstituiert wird:
- Das ethische Prinzip der Freiheit – d. h., alle Menschen mit Freiheit zu denken – initiiert Ethik und die damit verbundene Notwendigkeit ethischer Entscheidungsfindung (in Freiheit zwischen ethisch richtig und falsch – ethisch gut und schlecht zu wählen) und fundiert die Moralfähigkeit der Menschen. Freiheit bedeutet, nach den eigenen Wünschen und Plänen handeln zu können. Sie kann die Freiheit umfassen, zu wollen, was man will, und die Freiheit, zu wollen, was man nicht will. Letzteres bedeutet, dass Freiheit auch bedeuten kann, das „Gesollte“, d. h. das ethisch Gesollte, zu wollen, auch wenn dies nicht den eigenen Wünschen, Bedürfnissen, Vorlieben, Lüsten oder Interessen entsprechen mag. Damit öffnet sich der soziale Horizont der Freiheit, denn die Freiheit aller anderen Menschen sowie die Menschenwürde aller Menschen, und die damit korrespondierende Verantwortung, kommen dabei in den Blick.
- Das ethische Prinzip der Menschenwürde aller Menschen schreibt die Einzigartigkeit aller Menschen fest, das sie von materiellen Objekten und anderen Lebensformen unterscheidet und das es absolut verbietet, Menschen ein Preis-schild anzuheften und sie zu instrumentalisieren, was Ethik Basis und Rahmen zugleich verleiht. Das, worum es beim ethischen Prinzip der Menschenwürde geht, kommt in der Formulierung „everybody matters“ [6] treffend zum Ausdruck.
3. Warum braucht es ein neues Modell für ethische Entscheidungsfindung?
Kann die eben erläuterte Notwendigkeit ethischer Entscheidungen nicht mit schon vorhandenen Modellen und Instrumenten abgedeckt werden? Warum braucht es ein neues Modell ethischen Entscheidens, wenn es doch eine Fülle von Modellen und Instrumenten für ethische Entscheidungsfindung gibt? Bereits existierende Ansätze für ethisches Entscheiden erlauben es zum einen, Punkte und Aspekte zu entdecken und zu erkennen, die vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit verdienen und so in einem neuen Modell bespielt werden sollen. Zum anderen lassen sich dank der sich bereits im Umlauf befindenden Modelle und Instrumente ethischer Entscheidungsfindung Kernelemente identifizieren, in denen sich primäre Erwartungen an ethisches Entscheiden manifestieren.
Ein neues Modell soll der Komplexität der Ethik noch gezielter gerecht werden.
Bisher vorliegende Modelle und Instrumente ethischen Entscheidens lassen zum einen die Handlungsorientierung der Ethik als Wissenschaft vermissen, die sich auch in einem Modell der ethischen Entscheidungsfindung wiederfinden sollte. Dieses Desideratum soll in einem neuen Modell für ethisches Entscheiden zum Zuge kommen. Des Weiteren will ein neues Modell dem rasant voranschreitenden technischen Fortschritt in seinen möglichen Auswirkungen auf menschliches ethisches Entscheiden spezifischer Rechnung tragen. Zudem soll ein neues Modell auch der Komplexität der Ethik noch gezielter gerecht werden – unter Berücksichtigung der regelüberragenden Einzigartigkeit des Konkreten [7] in ihren Konsequenzen für ethische Entscheidungsfindung. Schliesslich kann stets der Versuch unternommen werden, noch kompakter und konziser bei gleichzeitiger argumentativer Eleganz und Leichtigkeit ethisches Entscheiden zu ermöglichen.
4. Ethik in einem globalen Kontext
Der Kontext ethischen Entscheidens ist global, denn er umfasst die Menschheit und die Welt. Verbunden mit diesem Kontext kommen zunächst in besonderem Ausmaß auch die Anforderungen an eine Ethik zum Ausdruck, Pluralität von Ethik zu achten und zu respektieren. Damit Ethik in einem globalen Kontext gelingen und überzeugen kann, erweist sich die Achtung der Freiheit und Menschenwürde aller Menschen – den zwei Prinzipen aller Prinzipen der Ethik – als notwendige Bedingung. Denn wenn alle Menschen als frei und als Träger:innen von Menschenwürde verstanden werden, dann darf man ihnen kein Sollen unbegründet vorsetzen, was eine Freiheitsverletzung oder eine Instrumentalisierung bedeuten würde. Vielmehr bedingen die zwei Prinzipien aller Prinzipen Freiheit und Menschenwürde sowie der Respekt der Pluralität der Ethik eine ethische Begründung – „gute Gründe“.
Pluralität von Ethik weder zu Beliebigkeit, Willkür noch zu einem Relativismus oder einem „anything goes“ führt
Gleichzeitig bilden die zwei Prinzipien aller Prinzipen, Freiheit und Menschenwürde, Bedingungen der Möglichkeit einer Wahrnehmung, Berücksichtigung, Reflexion und eines ethisch begründbaren und legitimen Umgangs mit der Pluralität von Ethik, da bereits das Denken der, die Rede von, sowie eine Praxis der Pluralität von Ethik von der Voraussetzung der Quellen der Pluralität von Ethik leben: Freiheit und Menschenwürde aller Menschen. Denn wie sollten sonst überhaupt – insbesondere in einem globalen Kontext – all die Stimmen, welche die Pluralität von Ethik ausmachen, zur Geltung kommen, wenn ihnen ihre Existenz bzw. ihre Existenzberechtigung abgesprochen werden würde? Wie sonst sollte eine Anerkennung der Vielfalt von Stimmen erfolgen, wenn diese Stimmen weder zum Erklingen kommen noch gehört würden? Wie sonst sollte überhaupt Pluralität von Ethik entstehen und gelebt werden können, wenn Zwang und Unterdrückung ihren Ursprung auslöschen sowie anstatt eines so inklusiv wie möglich und gleichberechtigt gedachten Kreises moralischer Gemeinschaft – alle Menschen – ein Nadelöhr der Exklusion und Dominanz Uniformierung propagieren würde? In anderen Worten: Pluralität von Ethik – insbesondere die gleichberechtigte Anerkennung all dessen, was diese Pluralität von Ethik ausmacht – sowie ihre gelebte Theorie und Praxis stützen sich auf die zwei Prinzipien aller Prinzipen, Freiheit und Menschenwürde, als Bedingungen ihrer Möglichkeit.
Bereits darin ist grundgelegt, dass Pluralität von Ethik weder zu Beliebigkeit, Willkür noch zu einem Relativismus oder einem „anything goes“ führt, sondern sehr wohl ethische Aussagen und Positionsbezüge mit Verbindlichkeit kennt und anstrebt – schon allein deswegen, weil sich die Pluralität von Ethik sonst den Ast abschneiden würde, auf dem die Pluralität von Ethik selbst sitzt.
Schließlich kommen Relativismus und „anything goes“ an die Grenzen ihrer argumentativen Überzeugungskraft, wenn wir uns konkret vor Augen führen, wofür sie eigentlich in letzter Konsequenz stehen: Relativismus oder „anything goes“ wären gleichbedeutend damit, dass auch Positionen, Aussagen oder Handlungen, die – auch vor dem Hintergrund von unterschiedlichen ethischen Traditionen, Kulturen, Glaubensüberzeugungen, Ansätzen, Modellen, Schulen und Strömungen – eindeutig als ethisch falsch oder ethisch schlecht zu bezeichnen sind (z. B. einzelne oder gewisse Menschen nicht als Menschen zu verstehen, sexuelle Gewalt an Kindern), vermeintlich als ethisch richtig und gut zu verstehen wären, weil ja dann alles als ethisch richtig und gut gelten können müsste. Für eine ethische Gutheissung solcher Positionen, Aussagen oder Handlungen fehlen aber „gute Gründe“.
Die geografischen Kategorien rufen aus mehreren Gründen Zweifel in Bezug auf ihre epistemische Bedeutung hervor.
Im Zuge ethischer Entscheidungsfindung stösst man immer wieder auf geografische Kategorien (wie West/Ost, global/lokal…), die eine normative Rechtfertigung für eine Aussage oder eine Position suggerieren, die sich auf einen bestimmten geografisch definierten Ort oder ein bestimmtes Gebiet bezieht, z. B. entweder für oder gegen die Freiheit und die Menschenwürde aller Menschen. Diese Kategorien rufen jedoch aus folgenden Gründen Zweifel in Bezug auf ihre epistemische Bedeutung hervor:
- Die Frage stellt sich, welche Relevanz geografischen Kategorien in einem ethischen Diskurs zukommen darf. Natürlich haben historische Hintergründe, Kontext, Ort und Zeit usw. einen Einfluss auf Denkweisen und Meinungen. Letzteres ist jedoch – wenn im Zuge ethischer Entscheidungsfindung die Argumentation nur auf Ort oder Zeit der Entstehung beruht – in seiner normativen Gültigkeit und Argumentationskraft zu hinterfragen.
- Diese geografischen Kategorien bleiben immer relativ zum Ausgangspunkt, was deshalb relevant ist, weil sie ihrem Inhalt nach geografische Kategorien sind. Es stellt sich die Frage, von welchem Punkt aus dieser Blickwinkel eingenommen wurde und wie festgestellt wurde, dass ein Ort im „Osten“ und ein anderer im „Westen“ liegt. Zum Beispiel liegt Wien „östlich“ von Luzern, aber im normalen Gebrauch der beiden Kategorien im Menschenrechtsdiskurs würde man Wien wohl dem „Westen“ zuordnen.
- Kategorien wie z. B. Ost/West beruhen auf der Annahme oder Konstruktion von angeblich definierbaren, greifbaren, monolithischen, homogenen, ewig bestehenden, unveränderlichen, gegensätzlichen und getrennten Welten. Es scheint klar zu sein, was der so genannte „Westen“ oder „Osten“ umfasst und auf welchen Traditionen, Prinzipien und Werten diese beiden Teile der Welt beruhen.
- Es stellt sich heraus, dass es schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist, diese Kategorien – zum Beispiel den sogenannten „Osten“ und „Westen“ – und ihre jeweiligen Werte, auf denen diese beiden Kategorien beruhen, zu verstehen. Wenn man versucht, eine umfassende Definition des sogenannten „Westens“ und „Ostens“ zu entwickeln und anzunehmen, dass man die Werte kennt, auf denen sie beruhen, muss man angesichts der vorherrschenden Pluralität, Heterogenität und Dynamik im „Osten“ oder „Westen“ Vorsicht walten lassen. Ein erkenntnistheoretischer Ansatz würde wahrscheinlich scheitern, weil diese Kategorien nicht endgültig definiert werden können, abgesehen von ihrer Bezeichnung als geografische Positionen. Die Realität ist viel komplexer, und die vermeintlich kategorisierenden Werte – etwa im geografischen „Osten“ und „Westen“ – erweisen sich aufgrund der religiösen und weltanschaulichen Pluralität und Heterogenität, der normativen Vielfalt und der unterschiedlichen Rechts- und Politiksysteme sowie wegen grosser Unterschiede in der Wirtschaftskraft als unzugänglich.
- Die in diesen Kategorien enthaltene Schematisierung, die auf der Annahme und Konstruktion von angeblich definierbaren, umfassenden, monolithischen, homogenen, ewigen, unveränderlichen, getrennten und widersprüchlichen Welten (z. B. „Osten“ – „Westen“, …) beruht, ist eine zu starke Vereinfachung. Sie reduziert die Vielfalt, die in solchen Kategorien enthalten ist und die für die Gestaltung der Diskussion sehr wichtig ist. Die beiden vermeintlichen Pole erweisen sich in ihrer inneren Struktur als vielfältig und heterogen und enthalten verschiedene Strömungen (z. B. konservativ, liberal, etc.). Dies wäre für die Subjekte des jeweiligen Diskurses bei der Verwendung dieser Kategorien wichtig. Diese Art der Schematisierung unterdrückt mit der Vorstellung von monolithischen, definierbaren, umfassenden, homogenen, ewigen und unveränderlichen inneren Strukturen die epistemisch notwendige Wahrnehmung und Berücksichtigung unterschiedlicher Grundlagen, Entwicklungen und der Dynamik des Wandels.
- Auf dieser Grundlage werden die Kategorien „Osten“ oder „Westen“ in der Argumentation verwendet, zum Beispiel in folgendem Satz: „Weil Freiheit und Menschenwürde im ‚Westen’ entstanden sind, gelten sie nicht im ‚Osten’“. Abgesehen von der Relevanz zeitlicher und lokaler Gegebenheiten für die Geltung universeller Normen, die im folgenden Abschnitt diskutiert wird, begründen die Kategorien „Osten“ und „Westen“ eine normative Aussage („Freiheit und Menschenwürde gelten nicht im ‚Osten’“). Ein Argument, das sich auf diese Kategorien stützt, geht von der unzutreffenden Annahme aus, dass der „Westen“ über eine bestimmte überlegene Qualität verfügt, die dem „Osten“ fehlt. Die Aussage „weil Freiheit und Menschenwürde im ‚Westen’ entstanden sind…“ enthält auch die Annahme, dass der „Westen“ angeblich über eine Innovations- und Schaffenskraft verfügt, die der „Osten“ angeblich nicht hat.[8]
- Inhalte einem bestimmten geografischen Ort oder Gebiet zuzuordnen, ist nicht überzeugend, denn ein bestimmter Inhalt A oder eine Tendenz B kann sowohl in dem, was wir „Osten“ nennen, als auch in dem, was wir „Westen“ nennen, gefunden werden, und die widersprechende Position C oder Tendenz D kann ebenfalls überall gefunden werden.[9] Diese Argumentationsmuster, auf denen Positionen oder Trends beruhen, hängen nicht primär von ihrer geografischen oder zeitlichen Herkunft ab, wie eine solche Schematisierung suggerieren möchte. Vielmehr handelt es sich um eine liberale Position, die an allen Orten und in allen Himmelsrichtungen zu finden ist, ebenso wie ihre Gegenposition. Liberale und illiberale Positionen existieren unabhängig von Längen- und Breitengraden.
- Wenn ein geografischer Bezug zu einem bestimmten Ort hergestellt wird – etwa in Aussagen wie „im Osten denkt man so“ oder „im Westen macht man das so“ –, besteht die Gefahr, dass „im Osten“ oder „im Westen“ zu einem Argument wird, das alles andere, insbesondere die wirklichen Gründe und Faktoren, ausblendet. Dabei kann das Argument die Prüfung der wirklichen Gründe und Faktoren auf ihre Qualität als „gute Gründe“ behindern – was bedeutet, dass es denkbar sein muss, dass alle Menschen in ihrer tatsächlichen Freiheit und Autonomie sowie in ihrer vollen Gleichheit diesen Gründen (innerhalb eines Denkmodells und nicht innerhalb eines realen weltweiten Referendums) aus ethischen Gründen zustimmen würden.[10] Diese kritische Prüfung wäre jedoch im Hinblick auf die normative Gültigkeit und Argumentationskraft der realen Gründe und Faktoren notwendig.
- Diese Kategorien scheinen auf rassistischem Gedankengut zu beruhen, denn sie suggerieren, dass sich Menschen in einem bestimmten Kontext in Freiheit und Menschenwürde grundlegend von Menschen außerhalb dieses Kontexts unterscheiden – und dass es bei Freiheit und Menschenwürde nur um wahrnehmbare Unterschiede geht.
5. Delegation ethischer Entscheidungen an Maschinen?
Der rasant vorangehende technologische Fortschritt drängt die Frage auf, ob ethische Entscheidungen nicht zur Entlastung von Menschen an sogenannte „künstliche Intelligenz“ delegiert werden könnten.[11] Im Folgenden wird die Möglichkeit der Delegation ethischer Entscheidungen von Menschen an Maschinen aus ethischer Sicht kritisch untersucht.
Das Fehlen des Prinzips der Verletzbarkeit ist ein erstes Argument gegen die Moralfähigkeit von Maschinen und KI.
5.1 Verletzbarkeit
„Moralische Technologien“ und „ethische künstliche Intelligenz“ sind zunächst mit einer der Besonderheiten der Moralfähigkeit des Menschen konfrontiert, die den Menschen von Maschinen und künstlicher Intelligenz unterscheidet: die Verletzbarkeit des Menschen in Verbindung mit seiner „Erste-Person-Perspektive“ und seinem „Selbstverhältnis“. Der Begriff „Verletzbarkeit“[12] umfasst die Möglichkeit, angegriffen oder verletzt zu werden, und gleichzeitig die fehlende Fähigkeit oder die fehlenden Mittel, sich aus dieser Situation zu befreien und sich vor Verletzungen zu schützen.[13] Die Verletzbarkeit hat ihren Ursprung in der physischen und psychischen Hilflosigkeit des Menschen gegenüber sich selbst, seinen Mitmenschen[14], seinem Umfeld und seiner Umwelt[15] sowie in seiner Abhängigkeit von der Welt.
Die Bewusstwerdung der eigenen Verletzbarkeit ist ein Selbstwahrnehmungsprozess des Menschen. Während dieses Prozesses, wenn sich ein Mensch seiner eigenen Verletzbarkeit bewusst wird, erkennt er ex negativo die „Erste-Person-Perspektive“ [16]. Dies umfasst das Bewusstsein der Menschen, dass sie als singuläre Personen Subjekte der Selbsterfahrung sind, durch die sie Zugang zu ihrer eigenen Verletzbarkeit haben. Andererseits erfahren sie diese anthropologische Grundsituation der Verletzbarkeit als Subjekt (d. h. in der ersten Person Singular). Die Handlungen, Entscheidungen, Leiden und das Leben von Menschen gehen von ihnen als Subjekte aus. Darüber hinaus interpretieren sie diese anthropologische Grundsituation der Verletzbarkeit als Subjekt.[17] Der Mensch ist in der Lage, mit sich selbst in ein „Selbstverhältnis“ zu treten.
Da die Menschen sich ihrer Verletzbarkeit bewusst sind, aber gleichzeitig nicht wissen, ob und wann sich diese Verletzbarkeit manifestiert und in eine konkrete Verletzung oder Übertretung umschlägt, sind sie bereit, allen Menschen die „Erste-Person-Perspektive“ und das „Selbstverhältnis“ auf der Grundlage der Gleichheit aller Menschen zuzugestehen, weil dies für sie die rationalste, vernünftigste und vorteilhafteste Lösung darstellt. Das heißt, allen Menschen Rechte – also Menschenrechte – zuzugestehen, um sich selbst und allen anderen die Freiheit und Menschenwürde zu schützen. Der Mensch ist also nicht deshalb Träger:in von Menschenrechten, weil er verletzbar ist, sondern wegen des Prinzips der Verletzbarkeit, das zum Genuss der Menschenrechte für alle Menschen führt.
Das Fehlen des Prinzips der Verletzbarkeit ist ein erstes Argument gegen die Moralfähigkeit von Maschinen und „künstlicher Intelligenz“ und somit gegen die Delegation ethischer Entscheidungen an Maschinen.
Das Fehlen des Gewissens bildet ein zweites Argument gegen die Moralfähigkeit von Maschinen.
5.2 Gewissen
Eine zweite Infragestellung der Moralfähigkeit von Maschinen basiert auf dem Konzept des Gewissens[18], das für den Menschen und seine Moral von zentraler Bedeutung ist. Das Gewissen vereint das, was objektiv geboten ist, und das, was subjektiv in einer spezifischen und konkreten Situation, in einem spezifischen Kontext, bei einer einzigartigen Begegnung mit einzigartigen Menschen erlebt wurde. Das Gewissen schafft in einer Person eine Autorität, die sich a priori, aber auch a posteriori auf eine Handlung auswirkt. Aber das Gewissen handelt nicht selbst.[19] Das Gewissen übernimmt die Rolle einer inneren Stimme des Menschen in moralischen Fragen und Entscheidungen.[20]
Das Gewissen verbindet die Moral mit den verschiedenen Ebenen des Menschen und seiner Existenz. Letztere sind von unterschiedlicher Qualität und Intensität und werden durch individuelle Entwicklung oder gesellschaftliche Einflüsse geprägt.[21]
Die Möglichkeiten, die Technologien in Bezug auf ethische Entscheidungen und Handlungen besitzen, reichen bei Weitem nicht an das menschliche Gewissen heran. Das Fehlen des Gewissens bildet ein zweites Argument gegen die Moralfähigkeit von Maschinen und gegen die Delegation ethischer Entscheidungen an Maschinen.
Freiheit ist ein drittes Argument gegen die Moralfähigkeit von Maschinen.
5.3 Freiheit
Ein drittes Fragezeichen hinsichtlich der Moralfähigkeit von Maschinen ergibt sich aus der Freiheit. Freiheit ist eine conditio sine qua non für die Moral, denn erst die Freiheit eröffnet die Möglichkeit, sich für oder gegen das Gute bzw. das Richtige zu entscheiden. Als formale Relation kann Freiheit als „Freiheit von…“ und „Freiheit zu…“ beschrieben werden. Freiheit bedeutet, nach den eigenen Wünschen und Plänen zu handeln. Sie kennt gleichzeitig auch einen sozialen Horizont, wenn die Freiheit und die Menschenwürde aller Menschen in den Blick kommen.
Darüber hinaus ist die Freiheit der Ursprung von Wissenschaft, Forschung und Technologie. [22]. Dieser Aspekt muss in einer Zeit hervorgehoben werden, in der manche Stimmen aus der Wissenschaft die Existenz der Freiheit gänzlich leugnen.[23]
Maschinen haben keine Freiheit. Technologien werden von Menschen entworfen, entwickelt und gebaut, das heißt, sie werden heteronom produziert. Daher wird auch das Erlernen von ethischen Prinzipien und Normen von Menschen geleitet. In letzter Konsequenz würden Maschinen immer von aussen gesteuert werden. Bildlich gesprochen: Maschinen – auch selbstlernende Maschinen – gehen auf eine erste Codezeile zurück, die immer vom Menschen stammt. Freiheit ist ein drittes Argument gegen die Moralfähigkeit von Maschinen und gegen die Delegation ethischer Entscheidungen an Maschinen.
Maschinen können kein Verantwortungssubjekt darstellen, weil ihnen die Freiheit fehlt.
5.4 Verantwortung
Die Freiheit zu wollen, was man nicht will, zeichnet Verantwortung aus.[24] Verantwortung gelingt es, die eigene Freiheit mit der Freiheit aller anderen Menschen zu verbinden und die Menschenwürde aller Menschen zu achten. Verantwortung ermöglicht die Freiheit, über die eigenen Bedürfnisse und Interessen hinaus den Horizont für die Freiheit aller anderen Menschen und für gesellschaftliche Aufgaben und Ziele zu entdecken.[25]
Verantwortung kennzeichnet das Bewusstsein, dass man jemand „Antwort zu geben“ hat, was zum Begriff der Verantwortung führt. Man legt gegenüber einer Instanz – z. B. anderen Menschen, bei rechtlicher Verantwortung dem Gericht, als sich religiös verstehender Mensch Gott, einem Göttlichen, einem Transzendenten – in Bezug auf eigene Entscheidungen und Handlungen Rechenschaft ab und steht für die eigenen Entscheidungen und Handlungen gerade. Um Verantwortung tragen, um also ein Subjekt der Verantwortung sein zu können, sind Freiheit und Rationalität notwendig. Maschinen können kein Verantwortungssubjekt darstellen, weil ihnen die Freiheit fehlt – ein viertes Argument gegen die Moralfähigkeit von Maschinen und gegen die Delegation ethischer Entscheidungen an Maschinen.
Maschinen scheitern an dem Prinzip der Verallgemeinerbarkeit.
5.5 Autonomie
Eine fünfte grundsätzliche Frage bezüglich der Zuschreibung von Moralfähigkeit an Maschinen ergibt sich aus der vom Menschen für sich proklamierten Autonomie. Die Würde des Menschen „als vernünftiges Wesen, das keinen anderen Gesetzen gehorcht als denen, die er sich selbst gegeben hat“[26], beruht auf der Fähigkeit des Menschen, sich selbst Vernunftregeln zu setzen. Das bedeutet, dass moralische Regeln und Prinzipien, die der Mensch in seiner Autonomie formuliert, den folgenden Anforderungen einer kritischen, rationalen Moral genügen müssen, was ihre Universalität garantiert: Universalität setzt die Erfüllung des Prinzips der Verallgemeinerbarkeit durch die Vorlage rationaler und plausibler Argumente voraus.
Hinsichtlich des Begriffs „Autonomie“ besteht eine Kluft zwischen Technologien und Ethik.[27] Während der Mensch allgemeine moralische Regeln und Prinzipien für sich selbst erkennen, sie für sich selbst festlegen und sein Handeln daran ausrichten kann, ist dies bei Technologien nicht möglich. Technologien können als selbstlernende Systeme Regeln aufstellen, z.B. um ihre Effizienz zu steigern. Aber diese Regeln enthalten keine ethische Qualität. Maschinen scheitern an dem oben erwähnten Prinzip der Verallgemeinerbarkeit. Diese Negation ist ein fünftes Argument gegen die Delegation ethischer Entscheidungen an Maschinen. Verstärkt wird diese Verneinung noch dadurch, dass Technologien ohne Freiheit keine Autonomie haben können.
5.6 Ethische Entscheidungen von Menschen
Die obige Reflexion führt zu der Hauptkonsequenz, dass der Mensch dafür verantwortlich ist und bleibt, ethische Entscheidungen zu treffen.[28] Nur der Mensch weist Verletzbarkeit, Gewissen, Freiheit, Verantwortung, Autonomie und Moralfähigkeit auf.
Ethik und ethische Entscheidungen zeichnen sich durch ihre Sensibilität für die regelüberragende Einzigartigkeit des Konkreten aus.
6. Die regelüberragende Einzigartigkeit des Konkreten
Um der Komplexität der Ethik gerecht zu werden, muss ein Modell ethischen Entscheidens Sensibilität für die regelüberragende Einzigartigkeit des Konkreten [29] praktizieren. Folgendes Denkbeispiel vermag dies zu veranschaulichen: Stellen wir uns eine Situation in der Nazi-Zeit vor, in der wir bei uns Zuhause eine jüdische Familie vor den Nazis verstecken. Plötzlich klopfen die Nazis an die Tür und fragen uns, ob wir einer jüdischen Familie bei uns Unterschlupf gewähren. Wenn wir dem Wahrheitsgebot folgen, schicken wir die jüdische Familie in den sicheren Tod. Streben wir nach der Rettung der Leben der jüdischen Familie, müssen wir die Nazis anlügen. Was ist nun das ethisch Richtige in dieser konkreten Situation, in dieser konkreten Begegnung mit konkreten Menschen? Hier wäre die Rettung der Leben der jüdischen Familie höher zu gewichten als das Wahrheitsgebot und demzufolge das ethisch Richtige, die Nazis anzulügen. Ethik und ethische Entscheidungen zeichnen sich durch ihre Sensibilität für die regelüberragende Einzigartigkeit des Konkreten aus.
Entscheidend ist dabei erstens, dass dieser Regelbruch nicht geschieht, um sich selbst zu bereichern oder ein Eigeninteresse, eine Präferenz, einen Wunsch oder eine Lust zu bedienen, sondern um ein in dieser konkreten Situation, in dieser konkreten Begegnung mit konkreten Menschen höheres ethisches Gut zu erreichen. Zweitens werden ethische und rechtliche Normen sowie ihre Gültigkeit dadurch nicht in Frage gestellt. Sie werden drittens durch dieses Streben nach dem ethischen Richtigen und Guten bekräftigt.[30] Viertens dienen so ethische und rechtliche Normen dem Menschen und nicht umgekehrt.[31] Fünftens ist damit auch keine Infragestellung der Sinnhaftigkeit und Existenzberechtigung von ethischen Normen im Sinne eines Aufrufs zur Anarchie verbunden.
SAMBA soll klar ersichtlich werden lassen, warum man wie entscheidet.
7. Ethik-SAMBA
Einem solchen Modell für das ethische Entscheiden soll nun in der Folge auf der Basis des bisher Erarbeiteten und innerhalb der bereits gezogenen Linien die Aufmerksamkeit gehören. Das Modell SAMBA verfolgt das Ziel, eine konkrete Anleitung zur ethischen Entscheidungsfindung mit Leichtigkeit und argumentativer Eleganz in vier Schritten wirksam werden zu lassen. Dieses Modell soll Ethik-Student:innen, Student:innen aller wissenschaftlichen Disziplinen, Menschen in ihren beruflichen als auch privaten ethischen Entscheidungsfindungsprozessen sowie Entscheidungsträger:innen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft konkret und praxisbezogen einen praktisch anwendbaren Rahmen zur Strukturierung von ethischen Argumenten, ethischen Diskussionen sowie ethischer Entscheidungsfindung bieten. SAMBA soll klar ersichtlich werden lassen, warum man wie entscheidet, und dazu befähigen, konkrete ethische Entscheidungen auch wirklich zu fällen und entsprechend ethisch fundiert effektiv ins Handeln zu kommen.
Das Modell SAMBA verfolgt das Ziel, eine konkrete Anleitung zur ethischen Entscheidungsfindung in vier Schritten wirksam werden zu lassen.
SAMBA setzt sich aus den folgenden vier Schritten zusammen:
1. See and Understand the Reality
2. Analyze the Reality from a
Moral Standpoint
3. Be the Ethical Judge!
4. Act Accordingly!
Zu allen vier Schritten stiften jeweils fassbare und erreichbare Ziele Orientierung. Darüber hinaus stehen jeweils einige Leitfragen zur Verfügung, die den konkreten praxis- und zielorientierten Vollzug der vier Schritte erleichtern sollen.
-
See and Understand the Reality
LEITFRAGE:
A. What is your own horizon of knowledge, understanding, thought, language, and belief?
ZIEL:
Ziel ist es, sich selbst den eigenen Wissens-, Verstehens-, Denk-, Sprach- und Glaubens-/Weltanschauungs-Horizont sowie darauf basierende bzw. damit verbundene Annahmen zu vergegenwärtigen.
Im Zuge eines ethischen Entscheidungsprozesses gilt es, nach einer kritischen Distanz zu streben – sei es zur Realität, sei es zur Moral –, um möglichst objektiv eine ethische Entscheidung zu fällen. Der erste diesbezügliche Schritt in die richtige Richtung umfasst, sich den eigenen Wissens-, Verstehens-, Denk-, Sprach- und Glaubens-/Weltanschauungs-Horizont sowie darauf basierende bzw. damit verbundene Annahmen vor Augen zu führen und sich damit selbstkritisch zu befassen.[32] Diesen Wissens-, Verstehens-, Denk-, Sprach- und Glaubens-/Weltanschauungs-Horizont kann u. a. der heutige Stand der Forschung (Wissenshorizont), aktuelle Hermeneutik (Verstehenshorizont), gegenwärtige Grenzen menschlicher Vernunft (Denkhorizont), gegenwärtige Sprache mit ihren Wortschöpfungen, Formulierungen, Satzkonstruktionen, Ausdrucksformen, Bildern (Sprachhorizont) und eine Verbundenheit mit und/oder Verankerung in einer Religions-, Glaubens- oder Weltanschauungsgemeinschaft (Glaubens-/Weltanschauungs-Horizont) oder dem bewusst gewählten Gegenteil, nämlich einer bewusst gewählten Distanzierung von einer oder jeglicher Religions-, Glaubens- oder Weltanschauungsgemeinschaft, bilden.
LEITFRAGE:
B. What is the current reality?
ZIEL:
Ziel ist es, die Wirklichkeit möglichst objektiv und neutral zu beschreiben. Dabei können auch Studien von anderen thematisch passenden und adäquaten wissenschaftlichen Disziplinen herbeigezogen werden. Teil dieser Bestimmung und Absteckung der Realität bilden auch die geltenden rechtlichen Regelungen und Normen, die ebenfalls die Wirklichkeit ausmachen.
Die Basis dieser Wirklichkeitsbeschreibung sollten nicht subjektive und persönliche Eindrücke bilden, sondern (empirische) Studien von Wissenschaften, die kompetent etwas dazu beitragen können, zu einer möglichst objektiven und neutralen Wahrnehmung der Realität zu gelangen. So wären z. B. rechtswissenschaftliche Darlegungen über die rechtliche Situation, soziologische Analysen zu gesellschaftlichen Aspekten oder psychologische Untersuchungen hinsichtlich des menschlichen Verhaltens, Erlebens und Erfahrens herbeizuziehen. Selbstverständlich ist keineswegs die damit verbundene Erwartung, selbst „Expert:in“ dieser Wissenschaftszweige zu werden, sondern sich auf der Basis der Kernaussagen aus den entsprechend relevanten Wissenschaften ein adäquates Bild der Realität zu machen.
Der eigene Wissens-, Verstehens-, Denk-, Sprach- und Glaubens-/Weltanschauungs-Horizont prägt die Wahrnehmung der Wirklichkeit, sodass ein Dialog mit der Realität beginnt. Es handelt sich um einen Dialog, weil einerseits der eigene Wissens-, Verstehens-, Denk-, Sprach- und Glaubens-/Weltanschauungs-Horizont die Wahrnehmung der Realität beeinflusst, andererseits die Wirklichkeitsperzeption den Wissens-, Verstehens-, Denk-, Sprach- und Glaubens-/Weltanschauungs-Horizont zu verändern vermag.
-
Analyze the Reality from a Moral Standpoint
LEITFRAGE:
A. Where do you suspect an ethical question/challenge/problem?
ZIEL:
Ziel ist es, die vermutete ethische Frage/die vermutete ethische Herausforderung/das vermutete ethische Problem zu erfassen.
Es handelt sich vorerst nur um eine Vermutung, da sich die präzise Identifizierung einer ethischen Frage/einer ethischen Herausforderung/eines ethischen Problems bereits selbst an einem ethischen Referenzpunkt orientiert und auf diesen abstützt. Dieser ethische Referenzpunkt muss bzw. diese ethischen Referenzpunkte bzw. müssen aber zunächst identifiziert und anschließend ethisch begründet werden, um dann – und erst dann – die ethische Frage/die ethische Herausforderung/das ethische Problem präzise bestimmen zu können.
LEITFRAGE:
B. Is there really an ethical question/challenge/problem?
ZIEL:
Ziel ist es, nochmals zu überprüfen und sich zu vergewissern, ob es sich wirklich um ein/e ethische Frage/ethische Herausforderung/ethisches Problem, oder um ein/e anderweitig gelagerte/s Frage/Herausforderung/Problem (z. B. praktisch, pragmatisch, wirtschaftlich) handelt.
Während ein praktisches Problem eine praktische Lösung erfordert, sucht ein pragmatisches Problem eine pragmatische Lösung „für etwas“, die „jemand“ dient, und eine wirtschaftliche Lösung eine wirtschaftliche Antwort verlangt, die eine rationale und kluge Eigeninteressenverfolgung charakterisiert, erweist sich die ethische Frage ausgerichtet auf eine Antwort, die „an sich“ richtig oder gut bzw. falsch oder schlecht bzw. „in sich“ richtig oder gut bzw. falsch oder schlecht ist, d. h. bedingungslos und voraussetzungslos ethisch überzeugt. Es ist zu überprüfen, ob es sich wirklich um eine ethische Frage/eine ethische Herausforderung/um ein ethisches Problem handelt. Damit soll das Risiko adressiert werden, dass man möglicherweise etwas in die Wirklichkeit hineinliest, das man dort nicht so vorfindet. Im Zuge einer erneuten Überprüfung der ethischen Qualität der Frage/der Herausforderung/des Problems sowie ihres bzw. seines Realitätsbezugs soll sichergestellt werden, dass real eine ethische Frage/eine ethische Herausforderung/ein ethisches Problem besteht, die bzw. das zu adressieren ist.
LEITFRAGE:
C. Which ethical principles/norms/theories/approaches could provide orientation?
ZIEL:
Ziel ist es, sich in der Pluralität von Ethiken einen Überblick zu verschaffen, welche ethischen Prinzipien (z. B. Menschenwürde)/Normen (z. B. Menschenrechte)/Theorien (z. B. Tugendethik, Pflichtenethik, Konsequenzialismus [u. a. Utilitarismus][33], Diskursethik)[34]/Ansätze (z. B. Verantwortungsprinzip mit seinen acht Dimensionen; omni-dynamische soziale Gerechtigkeit) bei dieser ethischen Frage/dieser ethischen Herausforderung/diesem ethischen Problem ethische Orientierung stiften können.
Ethisches Entscheiden im Sinne normativer Ethik, dies bedeutet im Rahmen einer Ethik, die im Unterschied zur Metaethik (kritische Theorie der Ethik, welche die Struktur ethischer Reflexion analysiert) und im Unterschied zur deskriptiven Ethik (empirische Beschreibung moralischer Vorstellungen und Überzeugungen, die also nicht normativ urteilt) nach allgemein gültigen, argumentativen Begründungen für das moralisch Gute und Richtige sowie für moralische Verbindlichkeiten strebt und ethische Bewertungen vornimmt, kann tugendethisch oder normethisch erfolgen. „Tugenden erweisen sich als „Haltungen oder […] Seinsweisen, von denen angenommen wird, dass sie gut sind sowohl für den einzelnen als auch für das Gemeinwesen. […] Die Tugenden gelten also zugleich für den einzelnen als moralische Empfehlungen und letztlich sein Glück und Wohlsein besorgend wie auch als Ermöglichung des Gemeinwohls“[35].Tugendethik bewertet Charaktereigenschaften und Haltungen aus einer Erste-Person-Perspektive – und somit einer Teilnehmenden-Sicht als menschlich gut oder schlecht.[36]
Normethische Zugänge, die aus einer Dritte-Person-Perspektive – und dementsprechend aus einer Beobachtenden-Perspektive – konkrete Handlungen als menschlich richtig und falsch[37] beurteilen, umfassen u. a.:
- Autoritative Ansätze[38]
- Naturrecht[39]
- Diskursethik[40]
- Teleologie, Konsequenzialismus[41]
- Utilitarismus[42]
- Deontologie (Pflichtenethik)[43].
Gerechtigkeit – Verantwortung – Menschenrechte
Das angedachte Zusammenspiel zwischen Pflichten und Folgen sowie einer individuellen als auch sozialen Perspektive konkretisieren die ethischen Prinzipien „Gerechtigkeit“, da es dabei auch um eine Balance zwischen individuellen und kollektiven Interessen geht, „Verantwortung“ – hier kommt das handelnde Subjekt in seiner bzw. ihrer Freiheit als eines der Prinzipien aller Prinzipien der Ethik in Bezug auf die Folgen ihrer bzw. seiner Entscheidungen in den Fokus, da „Verantwortung“ nicht nur retrospektiv, sondern auch prospektiv zu denken ist – und „Menschenrechte“, denen der Schutz der Menschenwürde als eines der Prinzipien aller Prinzipien der Ethik anvertraut ist. Die ethischen Prinzipien „Gerechtigkeit“, „Verantwortung“ und „Menschenrechte“ sind natürlich nicht die einzigen ethischen Prinzipien, die bei der Suche nach ethischen Leitlinien für ethische Entscheidungsfindung hilfreich sein könnten. Sie stellen keine erschöpfende Liste dar. Diese drei ethischen Prinzipien helfen in besonderem Masse weiter,
- da ihre normative Gültigkeit ethisch begründet werden kann;[44]
- weil sie wesentlich relevant für bzw. eng mit den zwei Prinzipien aller Prinzipien der Ethik Freiheit und Menschenwürde verbunden sind;
- da sie fundamental sind.
LEITFRAGE:
D. How can you ethically justify the ethical points of reference you have chosen?
ZIEL:
Ziel ist es, aus Achtung und Respekt vor der Pluralität von Ethiken rational und ethisch zu begründen, warum man diese/n ethischen Referenzpunkt/e ausgewählt hat und warum man andere ethischen Prinzipien/Normen/Theorie/Ansätze nicht berücksichtigt.
Die Auswahl des/der ethischen Referenzpunkte/s sollte sich Willkür, Beliebigkeit, Sympathien, Emotionen sowie dem Bauchgefühl entziehen, sondern rational begründbar und plausibilisierbar erfolgen.[45] Bei der Begründung der Auswahl des/der ethischen Referenzpunkte/s ist grundsätzlich das Prinzip der Verallgemeinerbarkeit zu erfüllen, indem rationale und plausible Argumente – „gute Gründe“ – dafür aufgeführt werden. „Gute Gründe“ bedeutet, dass es denkbar sein muss, dass alle Menschen in ihrer effektiven Freiheit und Autonomie sowie in ihrer vollen Gleichheit diesen Gründen – innerhalb eines Denkmodells und nicht innerhalb eines realen weltweiten Referendums – aus ethischen Gründen zustimmen würden.[46]
LEITFRAGE:
E. How would you define the ethical question/challenge/problem?
ZIEL:
Ziel ist es, mit Hilfe des/der ethisch begründeten ethischen Referenzpunkte/s die ethische Frage/die ethische Herausforderung/das ethische Problem zu definieren.
Die rational und ethisch begründete Klarheit hinsichtlich des/der ethischen Referenzpunkte/s erlaubt es nun, die ethische Frage/die ethische Herausforderung/das ethische Problem sorgfältig, gewissenhaft und präzis zu identifizieren. Die sich dabei herauskristallisierende ethische Frage/die sich dabei herauskristallisierende ethische Herausforderung/das sich dabei herauskristallisierende ethische Problem gilt es im Zuge der ethischen Entscheidungsfindung zu beantworten bzw. zu meistern bzw. zu adressieren.
- Be the Ethical Judge!
LEITFRAGE:
A. What is your ethical assessment?
ZIEL:
Ziel ist es, von einem ethischen Standpunkt aus Position zu beziehen und eine ethische Bewertung vorzunehmen. Diese ethische Position und ethische Bewertung können sowohl zunächst eine Antwort und eine Meisterung der Herausforderung sowie des Problems als auch anschliessend einen konkreten ethischen Lösungsvorschlag beinhalten.
Bei einer ethischen Urteilsfindung handelt es sich um eine anspruchsvolle Aufgabe. Innerhalb der kategorischen Verwendung des Sollens und somit der ethischen Bewertung kann man von folgenden Grundkategorien ausgehen, was beim ethischen Entscheiden weiterhelfen kann: „Grundkategorien der moralischen Bewertung von Handlungen sind die Kategorien des moralisch Verbotenen, des moralisch Erlaubten und des moralisch Gebotenen sowie die zugehörigen Subkategorien. Basal sind diese Kategorien deshalb, weil die moralische Beurteilung von Handlungen immer schon voraussetzt, dass sich das moralisch Verbotene vom moralisch Erlaubten und moralisch Gebotenen abgrenzen lässt – unabhängig davon, welchen inhaltlichen Maßstab moralischer Richtigkeit sie anlegt, welche Gründe für moralisches Sollen sie annimmt und welche normative Ethik ihr zugrunde liegt“[47].
Ebenso soll hier die Sensibilität des ethischen Entscheidens für die oben eingeführte „regelüberragende Einzigartigkeit des Konkreten“ zum Tragen kommen.
LEITFRAGE:
B. How can you justify your ethical assessment?
ZIEL:
Ziel ist es, die ethische Position und die ethische Bewertung rational und ethisch zu begründen.
Bei dieser Begründung ist das Prinzip der Verallgemeinerbarkeit zu erfüllen, indem „gute Gründe“ dafür aufgeführt werden. „Gute Gründe“ bedeutet, dass es denkbar sein muss, dass alle Menschen in ihrer effektiven Freiheit und Autonomie sowie in ihrer vollen Gleichheit diesen Gründen – innerhalb eines Denkmodells und nicht innerhalb eines realen globalen Referendums – aus ethischen Gründen zustimmen würden.[48]
- Act Accordingly!
LEITFRAGE:
A. How can this ethical assessment be concretely addressed and implemented?
ZIEL:
Ziel ist es dabei, konkret und praxisnah aufzuzeigen, wie die ethische Position und die ethische Bewertung handlungswirksam adressiert und eine ethische Lösung umgesetzt werden können. Die der ethischen Entscheidung entsprechende Handlung bzw. ethische Lösung sollte eine Kohärenz mit der ethischen Entscheidung und ihrer Begründung auf-weisen.
Der Hauptfokus von „Act Accordingly“ liegt auf der konkreten und praktischen Realisierung einer ethischen Lösung. Diese sollte jedoch im Einklang mit den ethischen Referenzpunkten (z. B. Verantwortungsprinzip, Gerechtigkeitsprinzip, Menschenrechtsprinzipien) stehen, welche der ethischen Entscheidungsfindung eine ethische Basis und Ausrichtung gestiftet haben, und sich an diesen orientieren. Allenfalls notwendige Kontextualisierung im Zuge der Realisierung dieser ethischen Prinzipien in konkreten Kontexten darf jedoch weder eine Verwässerung noch eine Unterwanderung der ethischen Prinzipien beinhalten. So darf beispielsweise eine an den Menschenrechten orientierte ethische Lösung keine Diskriminierung von Menschen kennen. Wie die ethische Entscheidung muss in diesem Fall auch die Lösung menschenrechtsbasiert sein.
LEITFRAGE:
B. Ethics Beyond Rules: How is the rule-transcending uniqueness of the concrete considered?
ZIEL:
Ziel ist es, sicherzustellen, dass sowohl die Identifizierung der ethischen Frage/der ethischen Herausforderung/des ethischen Problems, deren bzw. dessen ethische Bewertung sowie die rationale und ethische Begründung dieser ethischen Position als auch die ethische Lösung der regelüberragenden Einzigartigkeit des Konkreten gerecht werden.
Die regelüberragende Einzigartigkeit des Konkreten bedeutet, dass das ethisch Richtige und ethisch Gute in einer konkreten Begegnung mit konkreten Menschen in einer konkreten Situation umfassen kann, im Dienste des ethisch Richtigen und ethisch Guten ein ethisches Prinzip bzw. eine ethische Norm bzw. einen ethischen Wert zu missachten.
SAMBA bewirkt ein „Empowerment“, Indifferenz zu überwinden oder ihr keine Chance zu lassen sowie ethisch begründet Position zu beziehen.
8. Ethik-SAMBA. Mit Leichtigkeit und argumentativer Eleganz in 4 Schritten ethisch entscheiden
SAMBA will dabei unterstützen, sorgfältig informiert und begründet zu einer ethischen Entscheidung zu gelangen, eine ethische Entscheidung konzis und kompakt auf den Punkt zu bringen, präzis Klarheit über die Gründe zu erlangen, die einer ethischen Entscheidung und einem damit korrespondierenden Handeln zugrunde liegen, sowie ermutigt und selbstbewusst konkret zu handeln und eine ethische Lösung zu realisieren.
Diese genaue Kenntnis der Gründe für eine ethische Entscheidung erlaubt es auch, aus Respekt vor der Freiheit und Menschenwürde aller Menschen sowie ihrer Autonomie und Selbstbestimmung und damit verbunden vor der Pluralität von Ethiken nicht nur die ethische Entscheidung sowie damit korrespondierendes Handeln zu kommunizieren, sondern diese Mitteilung jeweils mit der Angabe von Argumenten und Gründen zu verbinden, da man sich dann über diese Argumente und Gründe austauschen und diese diskutieren kann. Diese Argumente und Gründe sollten danach streben, „gute Gründe“[49] zu sein.
Schliesslich bewirkt SAMBA ein „Empowerment“, Indifferenz zu überwinden oder ihr keine Chance zu lassen sowie ethisch begründet Position zu beziehen und durch entsprechendes ethisch ausgerichtetes Handeln einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten – geprägt von den zwei Prinzipien aller Prinzipien Freiheit und Menschenwürde sowie von den diese schützenden Menschenrechten.
Literatur
Achtner, W. (2010). Willensfreiheit in Theologie und Naturwissenschaften: Ein historisch-systematischer Wegweiser. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt.
Anderson, M. & Anderson, S. (2011). General Introduction. In: M. Anderson & S. Anderson (Hrsg.). Machine Ethics. Cambridge University Press. Cambridge, 1–4.
Appiah, K. A. (2007). Der Kosmopolit. Philosophie des Weltbürgertums. C. H. Beck. München.
Bauer, E. J. (Hrsg.). (2007). Freiheit in philosophischer, neurowissenschaftlicher und psychotherapeutischer Perspektive. Wilhelm Fink. München.
Bentham, J. (1975). Eine Einführung in die Prinzipien der Moral und der Gesetzgebung. In: O. Höffe (Hrsg.). Einführung in die utilitaristische Ethik. UTB. München, 35–58.
Bloch, W. (2011). Willensfreiheit? Neue Argumente in einem alten Streit. Hodos – Wege bildungsbezogener Ethikforschung in Philosophie und Theologie 11. Peter Lang. Frankfurt am Main.
Butler, J. (2004). Le pouvoir des mots. Politique du performatif. Éditions Amsterdam. Paris.
Fellsches, J. (2010). Tugend. In: H. J. Sandkühler (Hrsg.). Enzyklopädie Philosophie. Felix Meiner. Hamburg, 2781–2783.
Fink, H. & Rosenzweig, R. (Hrsg.). (2006). Freier Wille – frommer Wunsch? Gehirn und Willensfreiheit. Mentis. Paderborn.
Fleischer, M. (2012). Menschliche Freiheit – ein vielfältiges Phänomen: Perspektiven von Aristoteles, Augustin, Kant, Fichte, Sartre und Jonas. Karl Alber. Freiburg im Breisgau.
Frezzo, M. (2015). The Sociology of Human Rights: An Introduction. Polity Press. Cambridge.
Guckes, B. (2003). Ist Freiheit eine Illusion? Eine metaphysische Untersuchung. Mentis. Paderborn.
Habermas, J. (1983). Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln. Suhrkamp. Frankfurt am Main.
Hersch, J. (1992). Im Schnittpunkt der Zeit. Benzinger. Zürich.
Holderegger, A. (2006): Verantwortung. In: J. Wils & C. Hübenthal (Hrsg.). Lexikon der Ethik. Schoeningh. Paderborn, 394–403.
Honnefelder, L. (2012). Theologische und metaphysische Menschenrechtsbegründungen. In: A. Pollmann & G. Lohmann (Hrsg.). Menschenrechte. Ein interdisziplinäres Handbuch. J.B. Metzler. Stuttgart, 171–178.
Jennings, B. (2010). Enlightenment and enchantment: Technology and ethical
limits. Technology in Society 32 (1), 25–30.
Joas, H. (2015). Sind die Menschenrechte westlich?. Koesel. München.
Johnson, D. (2006). Computer Systems: Moral Entities but not Moral Agents. Ethics and Information Technology 8 (4), 195–204.
Kant, I. (1974). Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Weischedel, W. (Hrsg.). Werkausgabe 7. Suhrkamp. Frankfurt am Main.
Keenan, J. F. (2010). A History of Catholic Moral Theology in the Twentieth Century: From Confessing Sins to Liberating Conscience. Continuum. New York.
Kirchschläger, P. G. (2013a). Wie können Menschenrechte begründet werden? Ein für religiöse und säkulare Menschenrechtskonzeptionen anschlussfähiger Ansatz (ReligionsRecht im Dialog 15). LIT-Verlag. Münster.
Kirchschläger, P. G. (2013b). Gerechtigkeit und ihre christlich-sozialethische Relevanz. Zeitschrift für katholische Theologie 135 (4), 433–456.
Kirchschläger, P. G. (2014a). Human Rights and Corresponding Duties and Duty Bearers. International Journal of Human Rights and Constitutional Studies 2 (4), 309–321.
Kirchschläger, P. G. (2014b). Verantwortung aus christlich-sozialethischer Perspektive. ETHICA 22 (1), 29–54.
Kirchschläger, P. G. (2017a). Gewissen aus moraltheologischer Sicht. Zeitschrift für katholische Theologie 139 (2), 152–177.
Kirchschläger, P. G. (2017b). Die Rede von ‘moral technologies’: Eine Kritik aus theologisch-ethischer Sicht. feinschwarz.net, March 20. Online unter: https://www.feinschwarz.net/die-rede-von-moral-technologies/ (Aufruf 11.02.2025).
Kirchschläger, P. G. (2021). Digital Transformation and Ethics. Ethical Considerations on the Robotization and Automation of Society and the Economy and the Use of Artificial Intelligence. Nomos. Baden-Baden.
Kirchschläger, P. G. (2023). Ethisches Entscheiden. Nomos. Baden-Baden.
Kottow, M.H. (2004). Vulnerability: What kind of principle is it?. Medicine, Health Care and Philosophy 7 (3), 281–287.
Marschütz, G. (2014). Theologisch und ethisch nachdenken. Band 1. Echter. Würzburg.
Mieth, D. (1992). Gewissen. In: J. Wils & D. Mieth (Hrsg.). Grundbegriffe der christlichen Ethik. Ferdinand Schoeningh. Paderborn, 225–242.
Ong-Van-Cung, K.S. (2010). Reconaissance et vulnérabilité: Honneth et Butler. Archives de Philosophie 73 (1), 119–141.
Pieper, A. (2017). Einführung in die Ethik. 7. Auflage. UTB. Tübingen.
Pritchard M., Engelhardt, E., Archer C., Hartmann L. P. & Werhane P. H. (2013). Obstacles to Ethical Decision-Making. Mental Models, Milgram and the Problem of Obedience. Cambridge University Press. Cambridge.
Runggaldier, E. (2003). Deutung menschlicher Grunderfahrungen im Hinblick auf unser Selbst. In: G. Rager, J. Quitterer & E. Runggaldier (Hrsg.). Unser Selbst – Identität im Wandel neuronaler Prozesse. Schoeningh. Paderborn, 143–221.
Scherer, B. (2022). Der Angriff der Zeichen. Denkbilder und Handlungsmuster des Anthropozäns. Matthes & Seitz Berlin. Berlin.
Schlögl-Flierl, K. (2016). Die Tugend der Epikie im Spannungsfeld von Recht und Ethik. In: P. Chittilappilly (Hrsg.). Horizonte gegenwärtiger Ethik. Festschrift Josef Schuster. Herder. Freiburg im Breisgau, 29–39.
Schmitt, H. (2008). Sozialität und Gewissen. Anthropologische und theologisch-ethische Sondierung der klassischen Gewissenslehre. Studien der Moraltheologie 40. LIT-Verlag. Wien.
Schroeder, D. & Gefenas, E. (2009). Vulnerability: Too Vague and Too Broad?. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 18 (2), 113–121.
Schmücker R., Tetens H., Düwell M., Werner M. H., Pauer-Studer H., Schroth J., Schmidt T., Raters M. L., Iorio M., Scheule R. M., Talabardon S., Eich T., Schlieter J. & Döring O. (2011). Der moraltheoretische und religiöse Hintergrund der Angewandten Ethik. In: R. Stoecker, C. Neuhäuser, & M. L. Raters (Hrsg.). Handbuch Angewandte Ethik. J. B. Metzler. Stuttgart, 13–86.
Werner, M. H. (2021). Einführung in die Ethik. J.B. Metzler. Stuttgart.
Wolbert, W. (2008). Gewissen und Verantwortung: Gesammelte Studien. Studien zur Theologischen Ethik 118. Herder. Freiburg im Breisgau.
Yampolski, R. V. (2013). Artificial Intelligence Safety Engineering: Why Machine Ethics Is a Wrong Approach. In: V. C. Müller (Hrsg.). Philosophy and Theory of Artificial Intelligence. Springer. Cham, 289–296.
Fußnoten:
[1] Jennings 2010.
[2] Scherer 2022.
[3] Kirchschläger 2014a.
[4] Pieper 2017, S. 98.
[5] Vgl. Kirchschläger 2021.
[6] Appiah 2007, S. 144.
[7] Vgl. Kirchschläger 2021.
[8] Vgl. Frezzo 2015.
[9] Vgl. Joas 2015, S. 78.
[10] Vgl. Kirchschläger 2021.
[11] Vgl. Anderson & Anderson 2011, S. 1–4.
[12] Vgl. Kirchschläger 2013a, S. 241–267.
[13] Schroeder & Gefenas 2009, S. 113–121; vgl. Kottow 2004.
[14] Butler 2004, S. 77.
[15] Vgl. Ong Vang Cung 2010, S. 119.
[16] Vgl. Runggaldier 2003.
[17] Vgl. Honnefelder 2012, S. 171–172.
[18] Vgl. Kirchschläger 2017a.
[19] Wolbert 2008, S. 170.
[20] Mieth 1992, S. 225.
[21] Schmitt 2008.
[22] Vgl. Hersch 1992, S. 60–61.
[23] Vgl. Fink/Rosenzweig 2006; Fleischer 2012; Bloch 2011; Bauer 2007; Achtner 2010; Guckes 2003.
[24] Vgl. Kirchschläger 2014b.
[25] Vgl. Holderegger 2006, S. 401.
[26] Kant 1974, S. 67.
[27] Vgl. Kirchschläger 2017b.
[28] Johnson 2006; Yampolski 2013.
[29] Vgl. Kirchschläger 2021.
[30] Vgl. Keenan 2010, S. 155.
[31] Vgl. Schlögl-Fierl 2016, S. 39.
[32] Pritchard et al. 2013, S. 125.
[33] Vgl. Bentham 1975, S. 35–38.
[34] Vgl. Habermas 1983.
[35] Fellsches 2010, S. 278ff.
[36] Vgl. Marschütz 2014, S. 145–156.
[37] Vgl. Marschütz 2014, S. 175–179.
[38] Vgl. Marschütz 2014, S. 179–199.
[39] Vgl. Marschütz 2014, S. 199–215.
[40] Vgl. Marschütz 2014, S. 215–223.
[41] Vgl. Marschütz 2014, S. 223–232.
[42] Vgl. Marschütz 2014, S. 232–238.
[43] Vgl. Marschütz 2014, S. 223–229.
[44] Vgl. Kirchschläger 2013a; Kirchschläger 2014b, S. 54; Kirchschläger 2013b.
[45] Vgl. Werner 2021, S. 239f.
[46] Vgl. Kirchschläger 2021.
[47] Schmücker et al. 2011, S. 13–14.
[48] Vgl. Kirchschläger 2021.
[49] Vgl. Kirchschläger 2021a.
—

Peter G. Kirchschläger ist Ordinarius für Theologische Ethik und Leiter des Instituts für Sozialethik ISE an der Theologischen Fakultät der Universität Luzern sowie Gastprofessor an der ETH Zürich. Er ist u. a. Präsident der Eidgenössischen Ethikkommission für Biotechnologie im Ausserhumanbereich (EKAH).