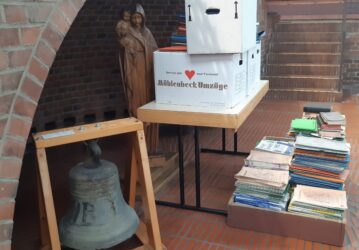Gregor M. Hoff zur Generalkritik des kürzlich verstorbenen Philosophen Herbert Schnädelbach.
Alle fünfundzwanzig Jahre begeht die katholische Kirche eine Art Schaltjahr: Sie feiert ein heiliges Jahr. Millionen Gläubige pilgern nach Rom. Sie suchen die Orte auf, an denen der Ursprung des Christentums handgreiflich wird. Es handelt sich um eine Rückvergewisserung des Glaubens. Ablass der Sünden wird on top angeboten. So erscheint durchaus konsequent, dass Papst Johannes Paul II. seiner Kirche vor einem Vierteljahrhundert ein umfassendes Schuldbekenntnis vorlegte. Der kürzlich verstorbene Philosoph Herbert Schnädelbach nahm dies damals zum Anlass, eine Generalkritik des Christentums zu veröffentlichen.[1] Das Fazit seiner kulturgeschichtlichen Abrechnung: Das Christentum stellt einen Fluch dar, weil es seine „Geburtsfehler“ nicht loswird. Als da wären: die Erbsünde, die Vorstellung vom Sühnetod Christi am Kreuz als einem „blutigen Rechtshandel“, der unselige Missionsauftrag, der fatale Antijudaismus der Kirchen, die gewaltstrotzende Vorstellung vom Ende der Zeiten, nicht zuletzt der Einkauf platonischer Philosophie als intellektuelles Rüstzeug mitsamt leibfeindlichen Folgen. Das Schlussstück und zugleich das Eingangsportal der Kritik bildet der korrupte Umgang mit der Geschichte: Was nie geschehen sei, werde durch falsches Zeugnis zur Tatsache erklärt.
Das Christentum stellt einen Fluch dar.
Die Resonanz auf den Artikel war stark. Christliche Apologien folgten. Vor allem ein Merkwort hallte nach: die Rede von einer „alt gewordenen Weltreligion“. Alt, das klingt bei Schnädelbach nicht ehrwürdig, sondern todgeweiht. Sollte man trauern? Was bleibt von einer Religion, die aus Gewalt (der Hinrichtung Jesu) geboren und sie nie los wurde, weil sie ihre Vorstellungswelt bestimmt? Der Gewaltvorwurf schneidet an einem Punkt sogar noch tiefer in das kirchliche Gewebe ein, als sich dies Schnädelbach vor fünfundzwanzig Jahren vorzustellen vermochte. Denn seitdem ist klar, dass zur Geschichte des Christentums eine sexualisierte Gewalt gehört, die systemische Ausmaße besitzt.
Die Geschichte des Christentums als Geschichte von Gewalt und Machtmissbrauch.
Kritik christlicher Gewalt setzt im 21. Jahrhundert beim Missbrauch kirchlicher Macht an. Sie wirkt im Zugriff der Amtsträger: als Verfügungsmacht über die Glaubenswahrheit, als disziplinarische Macht über die Gläubigen, als Heilsmacht, die ein Leben nach dem Tod verbürgt. Je offener Missbrauchsmuster kirchlicher Macht liegen, desto radikaler fragt sich, ob dies mit jenen Kirchenanfängen zusammenhängt, die Schnädelbach kulturgeschichtlich analysierte. Jesus von Nazareth durchbricht Erwartungen an eine messianische Revolution, die das römische Imperium von der politischen Landkarte des antiken Israels fegen sollte. Sein Reich ist nicht von dieser Welt, wie das Johannesevangelium einschärft. Reich Gottes wächst heran, wo die schöpferische Lebensmacht Gottes verwandelt, was tödlich wirkt: soziale Ausgrenzung, wirtschaftliche Ausbeutung. Dazu zählt auch politischer Machtmissbrauch, kurzum: Sünde gegen Gott und die Menschen. Jesus predigt Friedfertigkeit, doch sein Heilsdrama kennt auch das Gericht. Die Evangelien inszenieren es mit Bildern, die aus den Kriegen ihrer Zeit stammen und nicht zuletzt der Zerstörung Jerusalems durch die Römer im Jahr 70 n. Chr. abgelesen sind. Also doch: die Geburt des Christentums aus dem Geist der Gewalt?
Gott bestimmt. Doch wer bestimmt, was Gott bestimmt?
Hier greift eine Unterscheidung, die Macht und Gewalt unter einen christlichen Dauervorbehalt stellt: Gott bestimmt. Doch wer bestimmt, was Gott bestimmt? An diesem Punkt trifft die Frage nach den Geburtsfehlern des Christentums den sensiblen Kirchennerv. Die Bischöfe aller Zeiten beanspruchen als Nachfolger der Apostel, dass sie die Botschaft Jesu authentisch weitergeben. Sie fordern Vertrauen ein. Im Missbrauchskomplex zerbricht es, und zwar nicht nur aktuell. Kann man nämlich im Rückblick auf die christlichen Anfänge ausschließen, was als Kirchenwahrheit unabweisbar ist – dass die Nachfolger der Apostel Missbrauch von Macht praktiziert und verschleiert haben? Liegt, und das spitzt Schnädelbachs Kritik zu, der Geburtsfehler der Anfänge etwa in der apostolischen Fassung des Evangeliums?
Wie kann man der Botschaft jener vertrauen, die Vertrauen nicht verdienen?
Dem steht etwas entgegen: das Evangelium selbst. Seine Botschaft. Dass es ohne die frühe Gemeinde, ohne die Überlieferungsgeschichten der Apostel und eines Paulus nicht durch die Jahrhunderte hätte tradiert werden können, stellt mehr als nur eine historische Einsicht dar. Ohne die Schrift keine Kirche und umgekehrt. Die apostolische Tradition bleibt im Spiel – auch und gerade als Kritik an allem, worin sie dem Missbrauch von Macht verfällt. Trotzdem steht der Vorbehalt im Raum: Spielt Korruption im Eigeninteresse eine entscheidende Rolle bei der Kirchenbildung? Wie kann man der Botschaft jener vertrauen, die Vertrauen nicht verdienen – und das, wer weiß, von Anfang an? Man kann es nicht wissen. Der Hermeneutik des Verdachts entkommen die Kirchen nicht mehr so leicht, nachdem sie sich den Missbrauch von Menschen einmal aufs Gewissen geladen haben.
Geburtsfehler des Christentums
Der Geburtsfehler der Gewalt ist, Schnädelbach folgend, mit einem anderen verbunden: dem Umgang mit geschichtlicher Wahrheit. Beim christlichen Missbrauchskomplex rückt er ins Blickfeld, weil die Kirchen sich schwertun, anzuerkennen, dass es nicht um Einzelfälle, sondern um die Organisation kirchlicher Macht geht. Allzu leicht lässt sie sich als Ohnmacht tarnen, weil sie im Dienst Gottes steht. Die Verschleierung der Eigeninteressen kirchlicher Akteure wirkt umso gewaltförmiger, weil ihre Macht von Gott gegeben sein soll. Sie hat ein politisches Drehmoment, und das macht die Frage nach dem Geburtsfehler des Christentums so aktuell. Hardcore-Katholik:innen in den USA wählen und unterstützen Donald Trump beim Umbau der amerikanischen Demokratie zur Freihandelszone eines Narzissten; moskau-treue Orthodoxe verwandeln sich in nationalreligiöse Putin-Kämpfer; pentekostale und evangelikale Bewegungen vertreten ein fundamentalisiertes Christentum, das auf den globalen Religionsmärkten Gewinne verzeichnet und mit biblizistischen Überzeugungen nicht nur Bildungspolitik macht. Sie unterstützen Vorstellungen autoritärer Herrschaft.
Im Widerstreit unterschiedlicher christlicher Kulturen entscheidet sich an Menschenrechtsagenden, was von zweitausend Jahren Christentumsgeschichte bleibt.
Schnädelbachs Fluch des Christentums spiegelt sich im 21. Jh. in der Aufnahme von Menschenrechtsthemen. Die Abtreibungsfrage wird nicht nur in den USA gegen den Lebensschutz von Migrant:innen ausgespielt. Widersprüchlicher Einsatz für Menschenrechte gehört zur Kulturgeschichte dieser Religion, von Sklavenbefreiung bis Feminismus und LGBT-Bewegung. So beklagt Papst Franziskus als Oberhaupt der größten christlichen Kirche zwar die ökologischen und sozialen Folgen neoliberaler Wirtschaft; so tritt er für die Ärmsten der Armen, für Migrant:innen, für „überflüssige Menschen“ (Zygmunt Bauman) ein – beseitigt aber nicht die rechtliche und soziale Marginalisierung von Frauen und homosexuellen, queeren Menschen in seiner Kirche. Das katholische Beispiel führt zum heißen Punkt von Schnädelbachs Kritik: Im Widerstreit unterschiedlicher christlicher Kulturen entscheidet sich an Menschenrechtsagenden, was von zweitausend Jahren Christentumsgeschichte bleibt: was fasziniert und abstößt, was Wert behält und was zu überwinden ist.
Fünfundzwanzig Jahre nach dem „Fluch des Christentums“ haben sich die religionskulturellen Herausforderungsmuster verändert. Die Kirchen erledigen zunehmend selbst, wofür es einmal wehrhafte Religionskritik brauchte. Der religiöse Plausibilitätswandel vollzieht sich wie ein bestelltes Urteil. Während alle Welt Hoffnungsbedarf anmeldet, schläft das Christentum seinem Ende entgegen? So eindeutig verhält es sich nicht. Immerhin gewinnen Kirchen weltweit an Mitgliedern, auch das katholische Christentum. Aber das nimmt der Notwendigkeit, sich mit der christlichen Fluchgeschichte auseinanderzusetzen, nicht Anlass noch Dringlichkeit. Denn in globalpolitischen Krisenzeiten besteht die Chance einer Erneuerung.
In globalpolitischen Krisenzeiten besteht die Chance einer Erneuerung.
Sie findet am Zentrum der christlichen Botschaft ihr Maß: an der Menschwerdung Gottes. Dieser Gedanke verliert sich in aller Schuld nicht, die Kirchen auf sich laden und die das Christentum belastet. Menschwerdung bildet als Glaubensmotiv den Ausgangspunkt, jeden Fluch des Christentums zu bearbeiten. Es haftet am Schöpfungsglauben: an der Überzeugung, dass sich auch in einer Welt voller Zerstörung ihr Sinngehalt nicht verliert. Es vermittelt sich in der solidarischen Verpflichtung, den anderen Menschen als Bruder und Schwester wahrzunehmen, weil man in ihnen Gott begegnet. „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“, gibt Jesus seinen Jünger:innen im Matthäusevangelium mit auf den Weg. Diese Vorstellung leitet Praxis an. Sie verwandelt Gleichgültigkeit, Ablehnung, Isolation – zumindest als Forderung. Es handelt sich um eine schöpferische Glaubensenergie. Selbst wenn sie schwach werden sollte – sie verschwindet so wenig wie eine Hoffnung, die sich im Weiterleben und Weitergeben von Leben Ausdruck verschafft. In der Sehnsuchtsgestalt von Liebe meldet sich an, was Volker Gerhardt als „Sinn des Sinns“ buchstabiert. Die Vulnerabilität menschlicher Existenz vermittelt den Anerkennungsbedarf allen Lebens – kein Hass, kein Krieg schafft ihn ab. Insofern stellt das Menschwerdungsmotiv christlichen Glaubens das 21. Jahrhundert auf die Probe. Der Gott Jesu Christi, so glauben Christ:innen seit zweitausend Jahren, steht gegen jede Entmenschlichung und die Vernichtung der Schöpfung. So umstritten dieser Einspruch im Anwendungsfall sein mag, er widersetzt sich den Zugriffen instrumenteller Vernunft, die alles verfügbar macht – woran mit Theodor W. Adorno, dessen Assistent Schnädelbach war, zu erinnern ist. Aufmerksamkeit für Unverfügbares, Sinn für das, was in dieser Welt nicht aufgeht – das ist das Gegenteil eines Fluchs.
[1] H. Schnädelbach, Der Fluch des Christentums. Die sieben Geburtsfehler einer alt gewordenen Weltreligion. Eine kulturelle Bilanz nach zweitausend Jahren, in: Die ZEITT v. 11.5.2000: online abrufbar auf: https://www.zeit.de/2000/20/200020.christentum_.xml.

Prof. Dr. Gregor M. Hoff ist Professor für Fundamentaltheologie und Ökumenische Theologie an der Universität Salzburg.
Beitragsbild: Phil Botha, unsplash.com