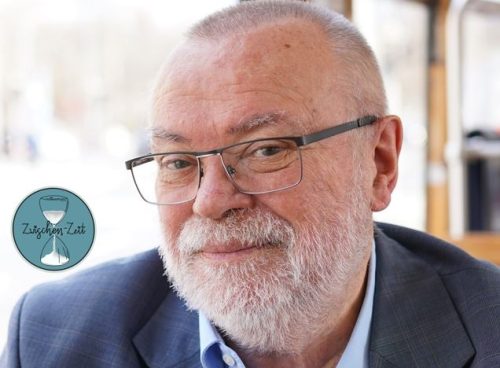Ottmar Fuchs beschreibt in seiner „Zwischenzeit“, welche Kernhoffnungen des Glaubens sich bei ihm im Alter als unverzichtbar erweisen.
„Lass Liebe gelten, da gering der Glaube“ (Annette von Droste-Hülshoff)[1]
Es ist gar nichts Ungewöhnliches, wenn sich bei älteren Menschen der religiöse Glaube immer mehr reduziert oder auch konzentriert auf das, was die je persönliche Kernhoffnung ausmacht, nicht selten schon an der Grenze zum Schwächerwerden bisheriger Glaubenseinstellungen, ja sogar zu ihrem fast lautlosen und schmerzlosen Verschwinden. Seit geraumer Zeit befinde ich mich in dieser Phase, und möchte, sozusagen als Zwischenetappe, formulieren, welche Kernhoffnung ich nicht aufgeben möchte.
Es wäre für mich nicht auszuhalten, dass Liebe spurlos zugrunde geht, dafür habe ich zu viel Liebe erfahren und bei anderen erlebt, gerade wenn Liebe nichts festhalten konnte, vor allem nicht geliebte Menschen, die gestorben sind, auch wenn Solidarität oft „vergeblich“ erscheint. Und es wäre für mich ebenfalls nicht auszuhalten, dass Lieblosigkeit und Leidzufügung konsequenzlos geschehen können, weil es keine Verantwortung vor einer unausdenklichen, unerschöpflichen Macht gibt, in der Liebe und Freiheit zu unvorstellbarer Gerechtigkeit verschmolzen sind.
Das hat zunächst wenig mit Religion zu tun. Es ist die Sehnsucht, die die Wissenschaftlerin Dr. Brand im Sci Fi Film „Interstellar“ (2014) ahnt, bis ins Kosmische hinein: „Dann hör mir doch zu. Wenn ich sage, dass Liebe etwas ist, das wir nicht erfunden haben, sie ist wahrnehmbar, kraftvoll, sie muss etwas bedeuten ….Liebe hat Bedeutung.“ Ihr Kollege antwortet: „Ja, sozialen Nutzen, zwischenmenschliche Bindung, Kindererziehung.“ Brand entgegnet: „Wir lieben Menschen, die tot sind, welcher soziale Nutzen liegt darin?“ – „Keiner!“ – „Vielleicht bedeutet sie noch etwas Anderes, etwas, das wir nicht, noch nicht, verstehen können. Vielleicht ist sie irgendein Beweis, ein Artefakt einer höheren Dimension, die wir gar nicht bewusst wahrnehmen können. Ich fühle mich quer durchs Universum zu jemandem hingezogen, den ich zehn Jahre nicht gesehen habe, wohl wissend, dass er wahrscheinlich sogar tot ist. Liebe ist das einzige, was für uns spürbar ist und die Dimension von Raum und Zeit überwindet. Vielleicht sollten wir darauf vertrauen, auch wenn wir es noch nicht verstehen können.“
Ich habe mich in den letzten Monaten mit den Gedichten des „Geistlichen Jahres“ von Annette von Droste Hülshoff (1787-1848) beschäftigt.[2] Dabei gibt es viel Faszinierendes zu entdecken, besonders aber: Bei Droste ist es die Liebe, die vor allem Glauben erlebbar und notwendig ist. Die Liebe ist es auch, die Sühne und Auferstehung begründet:
Zur Sühne: Der Glaube ist nichts wert, wenn er nicht die Liebe begründet. Und wenn die Liebe einmal die Macht haben wird, kann die Lieblosigkeit nicht übersehen werden, sondern sie lässt die Sühne aus der empfangenen Liebe heraus explodieren. Unvorstellbar ist die unerschöpfliche Verbindung von Schmerz und Glück, der sich die Menschen als unendlich Geliebte angesichts ihrer Geschichte aussetzen dürfen. Warum der diesseitige leidvolle Vorlauf sein „muss“, das wissen wir nicht. Hier beginnt das Recht der Geschöpfe zu klagen und anzuklagen. Auch diese damals höchst kriminalisierte Form der Gottesbeziehung aktiviert Droste nicht zu knapp.
Auch die Auferstehung gibt es nicht wegen egobezogener Existenzsicherung, sondern um weiterhin lieben zu können und geliebt zu werden. Es geht primär nicht darum, dass die Menschen weiterleben, sondern dass der Raum der Liebe Macht bekommt, ja jene Allmacht bekommt, in der es gar nicht anders denkbar ist, als dass Leben nicht vernichtet wird. In ihrem Gedicht Letzte Worte vertieft Droste die Einsicht, dass der Tod die gegenseitige Solidarität nicht trennt:
Geliebte, wenn mein Geist geschieden,
So weint mir keine Träne nach;
Denn, wo ich weile, dort ist Frieden,
Dort leuchtet mir ein ew’ger Tag!
Wo aller Erdengram verschwunden,
Soll euer Bild mir nicht vergehn,
Und Linderung für eure Wunden,
Für euern Schmerz will ich erflehn.[3]
Es ist die Sorge um die Geliebten, die sie über den Tod hinaus weiterleben lässt. Theodor Storm, der bereits jede Art von religiösem Glauben verabschiedet hat, hängt gleichwohl immer noch an dieser Sorge: „Dass ich nichts mehr werde von euch wissen, nicht mehr für euch sorgen dürfen, das ist schrecklich!“[4]
Liebe kann niemals ohne die Anderen existieren, und wenn ein Pfarrer sagt, er möchte unbedingt zu denen gehören, die auferstehen dürfen und in den Himmel kommen, im Gegensatz zu denen, die diese Rettung nicht bekommen (vor allem, weil sie nicht an Christus glauben), dann hat dies nichts mit dem Wesen der Liebe zu tun, die immer unbegrenzt angelegt ist. Es geht nicht um das Überleben des bürgerlichen oder siegergewöhnten bzw. fundamentalistischen Ichs und Überichs im Jenseits. Es geht um die Auferstehung einer neuen Schöpfung, in der die Menschen im Horizont einer unerschöpflichen Liebe weder sich noch die anderen aufgeben müssen, sondern für sich und füreinander gerettet sind.
Wenn das alles einmal nicht wahr sein sollte, wofür viele religiöse Vorstellungen und viele Sehnsüchte stehen, wenn die Liebe zugrunde geht und die schlimmsten Taten ohne Konsequenzen bleiben, sei es mit, sei es ohne Gott, dann schreie ich, gerade weil ich so viel Liebe erleben durfte (und wofür ich sehr dankbar bleibe, aber wem gegenüber?, dem Schicksal, was ist das?), schon jetzt mit meinem Tod einen Protest in das unendliche Universum hinein, den dann allerdings weder ich noch irgendjemand hören wird. Der Protest ist dann ebenso absurd wie unerlässlich.
__________________
Ottmar Fuchs war Professor für Praktische Theologie in Bamberg und Tübingen.
Bild: privat
Grafik: Juliane Maiterth
[1] Annette von Droste-Hülshoff, Sämtliche Gedichte. Mit einem Nachwort von Ricarda Huch, Frankfurt a. Main 1988, 460.
[2] Vgl. Ottmar Fuchs, Subkutane Revolte. Annette von Droste-Hülshoffs „Geistliches Jahr“. Eine theologische Entdeckung, erscheint Ostfildern im Januar 2021.
[3] Droste, Gedichte 380-381.
[4] Zitiert bei: Thomas Mann, Nachwort, in: Theodor Storm, Werke in einem Band, (Knaur Klassiker), München 1954, 1023-1038,1037.