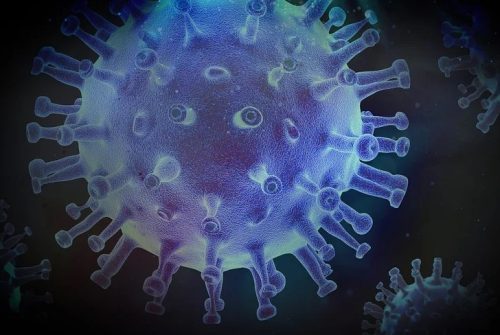In der Stille des Karsamstags lädt Alois Halbmayr zu einer aktuellen kirchlichen Bestandsaufnahme ein.
Normalerweise äußere ich mich öffentlich nicht zu kirchlichen Entwicklungen. Zum einen sind andere dazu berufener und gewiss auch näher an der Sache, zum anderen erspart es Ärger und Frustration. Meine Hoffnung auf eine Reformierbarkeit der Kirche ist in weiten Teilen zum Erliegen gekommen. Ich sehe nicht, wie die verschiedenen Veränderungsimpulse auf fruchtbaren Boden fallen könnten. Re-Klerikalisierung, institutionelle Fixierung und Milieuverengung schreiten munter voran, eine Trendwende kann ich derzeit nicht erkennen.
Ekklesiologische Fragen diskutiere ich normalerweise mit Kolleg*innen bei Zusammenkünften und mit Studierenden im Hörsaal. Das ist mir derzeit nur sehr begrenzt möglich, deshalb formuliere ich an dieser Stelle einige Aspekte, die aus meiner Sicht in den derzeitigen kirchlichen Debatten, die ja immer implizit auch theologische sind, etwas zu kurz kommen:
1. Die Unangebrachtheit der Strafmetapher. Es hat sich bereits recht hurtig so etwas wie eine eigene Coronatheologie entwickelt. Sie stellt sich der Frage, wie die Coronakrise theologisch zu deuten sei. Qualität und Überzeugungskraft der beigebrachten Argumente sind, wie immer in solch erhitzten Zeiten, sehr unterschiedlich. Neben lautem Getöse, nerviger Besserwisserei und moralischem Überlegenheitsgestus finden sich auch nachdenkliche Analysen, die ihre Ratlosigkeit bekennen und im Urteil sehr abwägend sowie zurückhaltend sind. Interessanterweise taucht in diesen Diskursen relativ häufig das Strafargument auf, natürlich in verwandelter und zeitgemäßer Form. Die Diktion geht in etwa so: Corona ist keine Strafe Gottes (offensichtlich muss man das immer noch betonen), aber es fordert uns auf, unseren Lebensstil zu ändern. Denn, so diese Logik, wir haben die Natur ausgebeutet, ungerechte Gesellschaftsordnungen geschaffen, den Kapitalismus nicht gehemmt und ökonomische Verwerfungen zugelassen. Covid-19 ist in gewisser Weise die Rache der Natur bzw. unserer entfremdeten Lebensart, letztlich also die Strafe für unser Verhalten oder zumindest dessen Konsequenz. Logisch und pragmatisch funktioniert dieses Argument exakt so wie das Argument der Gottesstrafe, nur ist es nicht ein Gott, der uns die Plage schickt, damit wir umkehren, sondern die Natur, die als säkularisierte Strafinstanz erscheint.
Die entscheidende Herausforderung liegt darin, die Streuung des Virus zu begrenzen
Vor solchen Argumenten wird sich der aufgeklärte Zeitgeist geflissentlich hüten. Denn er weiß: Pandemien hat es immer gegeben und sie würden wohl auch in der gerechtesten und ökologischsten aller Welten vorkommen. Pandemien gibt es, so sagt es die historische Zunft, seit es Menschen gibt und sie treten immer dort auf, wo hohe Bevölkerungsdichten existieren und damit ausreichend Möglichkeiten der Streuung vorhanden sind – und diese erweitern sich nun einmal in einer globalisierten Welt. Die entscheidende Herausforderung liegt deshalb immer darin, die Streuung des Virus so gut es geht zu verhindern bzw. zu begrenzen. Mit Rache, Strafe, Schuld hat sein Aufkommen nichts zu tun.
2. Das Eingestehen des Nichtwissens und die Perspektive des Hiob. Im öffentlichen Diskurs spielen theologische Interpretationen keine große Rolle. Und, man muss es sagen, das ist auch gut so. Denn es gibt keine theologische Erklärung oder Deutung dieser Pandemie. Sie ist eine medizinische, politische, ökonomische und wohl auch psychologische Frage, aber sie ist keine unmittelbar theologische. Woher stammt eigentlich die Überzeugung, als Theologe*in zu allem Stellung beziehen, zu allem eine theologische Deutung vorlegen zu müssen? Könnte es sein, dass die Pandemie gar keiner solchen fähig ist? Hier gilt, was in vergleichbaren Situationen grundsätzlich gilt: In theologischer Perspektive führt über die klassische Antwort des Buches Hiob keine weiterreichende Erklärung hinaus: Wir wissen nicht, warum die Welt so ist, wie sie ist, warum die einen leiden und die anderen nicht, die einen ein hartes Schicksal trifft und die anderen von allen möglichen Gefährdungen verschont bleiben. Wir würden es gerne wissen, möchten es gerne wissen, sollten es auch wissen, aber es ist uns einfach nicht möglich. Wir können uns darüber ärgern, enttäuscht sein und auch unseren Protest erheben, aber am Ende des Tages ist die Antwort immer die gleiche: Wir wissen es einfach nicht.
Allein im Modus der Hoffnung
3. Die berechtigte Zuversicht des Glaubens. Was lässt sich dann aber theologisch begründet überhaupt sagen? Im Grunde genommen nur das, woran sich die Glaubensgeschichte seit Anfang an abarbeitet und wozu sie sich nach so vielen leidvollen, traurigen, aber auch hoffnungsvollen und erfreulichen Erfahrungen durchgerungen hat: Zwar wissen wir nicht, warum die Welt so ist wie sie ist, aber wir dürfen mit guten Gründen auf Gottes Zusage vertrauen, dass er unser Leben in der Hand hält, es begleitet und führt, auch im größten Unglück und Elend gegenwärtig und treu ist, ja letztlich auch das verlorenste, bitterste und viel zu früh beendete Leben zur Vollendung führt (vgl. Jes 43,1-7; Röm 8,31-39). Diese Zuversicht ist uns nicht im Modus des Wissens, sondern allein im Modus der Hoffnung zugänglich.
4. Das Entwickeln von Hoffnung als eine Kernaufgabe. Was wäre nun kirchlicherseits zu tun? Im Grunde das weiterzuentwickeln bzw. zu verstärken, was in vielen Diözesen, Gemeinden, Initiativen mit beeindruckendem Engagement bereits versucht und angeboten wird: Menschen in ihren Ängsten und Sorgen, Nöten und Verzweiflungen zu begleiten, konkret zu helfen, wo es nötig ist, und gemeinsam Hoffnung und Vertrauen zu stärken, damit der Finsternis, die derzeit so nahe erscheint, nicht das letzte Wort zukommt, sondern nur das vorletzte. Ein solches Handeln zwingt zu einer Verschiebung der Perspektiven. Dieses könnte im besten Falle dazu führen, dass die gesetzten Initiativen letztlich nicht von der Angst getrieben sind, als Kirche im Wettkampf der Aufmerksamkeiten nicht unterzugehen, sondern aus der tiefen Überzeugung heraus erwachsen, in der absichtslosen Zuwendung und Unterstützung der Menschen, in ihrer Stärkung und Ermutigung dem eigenen Grundauftrag zu folgen.
Vorrangige Option für die Benachteiligten und Gefährdeten
5. Die Zuwendung zum Nächsten als höchste Form des Gottesdienstes. In dieser Krise zeigt sich erneut: Die wichtigste, ursprünglichste und höchste Form des Gottesdienstes – hin und wieder wird in Kommentaren darauf hingewiesen – ist die Nächstenliebe, die Solidarität mit den Bekümmerten und Notleidenden. Dieser Gottesdienst ist derzeit besonders gefragt – und er wird in bewundernswerter Weise auch von sehr vielen Menschen (Gläubigen und Nichtgläubigen) gefeiert, von all den Menschen, die Not lindern und Hoffnung geben, von all den Engagierten im Gesundheitswesen, im Infrastruktur- und Versorgungsbereich, in den zivilgesellschaftlichen Initiativen. Das gibt Hoffnung und Zuversicht.
Gerade in Zeiten einer Krise, wo die ohnehin vorhandenen gesellschaftlichen und sozialen Spaltungen besonders offensichtlich werden und sich zugleich vertiefen, gewinnt das Hinausgehen an die Ränder, das Papst Franziskus auch in Zeiten der Coronakrise immer wieder einmahnt, eine neue Dringlichkeit. Denn die marginalisiertesten, verletzlichsten und gefährdetsten Gruppen, die derzeit durch alle möglichen sozialen Netze zu fallen drohen, brauchen am dringendsten unsere Hilfe. Genau darin wird die vorrangige Option für die Benachteiligten und Gefährdeten konkret.
Überhöhung und Ideologisierung
6. Ein verkürztes Eucharistieverständnis und ein problematisches Priesterbild. Blickt man auf die derzeit breit geführte Eucharistiedebatte, so stellt sich auch hier ein besonderes Unbehagen ein. Die intensiven Diskussionen über die Möglichkeiten einer Eucharistiefeier ohne Beteiligung der Gläubigen („Geistermessen“) offenbaren bedenkliche Schieflagen, die sich ins Grundsätzliche erweitern, wenn etwa gesagt wird, dass „jeder Priester, egal welchen Alters, selbst in der gegenwärtigen Ausnahmesituation das Recht habe, persönlich die Osterliturgien zu feiern“ (so im Newsletter der ED Salzburg vom 27. März). Man staunt nicht nur über die Selbstverständlichkeit, mit der die Priester aus ihrer Einbindung in das Volk Gottes herausgenommen und ihnen zusätzliche sakramentale Aufgabe zugesprochen wird. Die Priester sollen nun nicht mehr nur Christus und das Gegenüber zur Gemeinde repräsentieren, sondern gleichzeitig auch noch das Volk Gottes verkörpern.
Eine größere Überhöhung und Ideologisierung, die mit einer eigentümlichen Entweltlichung einhergeht, ist eigentlich nicht mehr denkbar. Hier wird ein Rückfall in ein Eucharistie- und Priesterverständnis offensichtlich, wie es das Zweite Vatikanische Konzil so nachdrücklich überwinden wollte. Solche Rückwärtsorientierung treibt die kirchliche Selbstmarginaliserung weiter voran. Wer im Fernsehen oder Internet manche Übertragungen von Eucharistiefeiern sieht, mit einer Handvoll ausgewählter Personen, buchstäblich hinter verschlossenen Türen – wen deprimiert ein solches Bild nicht und wer sieht es nicht als Vorboten der Zukunft?
Bedauerlich, aber durchaus verschmerzbar
7. Die soziale Dimension des „eucharistischen Hungers“ und die vielfältigen Formen der Realpräsenz Christi. Diese Rückwärtsorientierung zeigt sich auch in der Debatte über den „eucharistischen Hunger“. Wenig überraschend wird er auf die Frage nach den Möglichkeiten des Kommunionempfangs reduziert. Nun gibt es keine verlässlichen Daten darüber, wie groß dieser Hunger ist, aber es könnte durchaus sein, dass er sich in Grenzen hält, dass es für viele Menschen zwar bedauerlich aber durchaus verschmerzbar wäre, zu Ostern einmal keine Kommunion empfangen zu können.
Aber gibt es nicht auch einen eucharistischen Hunger nach Gemeinschaft, nach dem sprichwörtlichen Miteinanderfeiern, nach den Zeichen des Getragen-, Zusammen- und Aufgehobenseins? Diese soziale Dimension des eucharistischen Hungers kommt kaum in den Blick. Vielleicht zeigt sich der eucharistische Hunger gegenwärtig in neuen Formen, in der Sehnsucht nach Verständnis, Sinndeutung, Zugehörigkeit, Gemeinschaft, Hoffnung und Zuversicht. Vielleicht zeigt er sich im Wunsch nach echtem Trost, im hoffnungsvollen Blick in die Zukunft, und ja, auch im Wunsch nach der Nähe Gottes, der oft so fern erscheint.
Um das zum Ausdruck zu bringen, zu feiern, zu klagen und zu erbitten, gibt es aber mehr Formen als nur die Eucharistiefeier. Man denke an die altbewährten Rituale der Tagzeitenliturgien, an die Traditionen der Hauskirche, an den Reichtum der liturgischen Gesänge oder an die Elemente der strukturierten Unterbrechungen. In diesen verschiedenen liturgischen Formen ist Christus ebenso – und zwar ganz und gar – gegenwärtig, wie das Konzil in einer seiner schönsten Passagen überhaupt formuliert, im Artikel 7 der Liturgiekonstitution. Und nur nebenbei: Wenn an der Eucharistiefeier und am Kommunionempfang alles hängt, warum werden diese dann jenen Menschen, die in Regionen leben, in denen es nur sehr wenige Priester gibt, so selbstverständlich verwehrt? Anderen Weltregionen wird (auch im Nachklang zur Amazonassynode und Querida Amazonia) achselzuckend zugemutet, was hierzulande als unzumutbar erscheint. Diese Logik erschließt sich nicht.
Zeichen der Zeit erkennen und im Licht des Evangeliums deuten
8. Statt einer Prognose der bleibende Blick auf die großen und kleinen Herausforderungen. Ich schließe mit einer Überlegung zur Frage, worin der größte Dienst der Theologie gegenwärtig und wohl auch in naher Zukunft liegen könnte. In einem ersten Schritt könnte es darum gehen, auf jegliche Spekulationen darüber, was sich alles verändern und wie die Gesellschaft in Zukunft aussehen wird, restlos zu verzichten. Es ist deprimierend zu sehen, welch breiter Raum den Sterndeuter*innen, Prognostiker*innen und Hellseher*innen derzeit in den Feuilletons eingeräumt wird. Dabei gilt auch hier: Niemand kann doch wissen, wie die weitere Entwicklung verläuft, was noch alles kommt. Vielleicht erwächst ein solidarisches Umdenken, vielleicht ist die Gesellschaft am Ende aber auch völlig erschöpft und sind große Teile so traumatisiert, dass erst recht ein harter Verteilungskampf ausbricht und die gesellschaftliche Spaltung sich vertieft. Was kommt, wissen wir einfach nicht, gestehen wir uns es offen und ehrlich ein.
Was ist uns dann aber noch möglich? Das, was auch bisher gegolten hat, nämlich die Zeichen der Zeit zu erkennen und im Lichte des Evangeliums zu deuten (GS 4), aufmerksam und kritisch die gesellschaftlichen Prozesse zu beobachten, zu begleiten und sich einzubringen. Jetzt geht es vordringlich darum, die Pandemie zu beenden, alles zu tun, dass im wahrsten Sinne des Wortes niemand zurückgelassen wird, also eine optimale Versorgung für jeden Menschen, der sie braucht, gewährleistet bleibt. Es ist eine Errungenschaft des modernen Sozialstaates und unbestrittener Teil seines Selbstverständnisses, dass kein utilitaristisches Denken einzieht, sondern sich die medizinische Versorgung allein nach den Erfordernissen der Patient*innen richtet.
Spannend wird es nach überwundener Krise. Denn schon heute ist absehbar, dass sich viele grundlegende Fragen stellen werden: Werden die (derzeit gewiss notwendigen) Einschränkungen der Grundrechte wieder vollständig aufgehoben? Wem werden die entstandenen Kosten aufgebürdet, wie können diejenigen, die derzeit die großen Verlierer*innen in sozialer und ökonomischer Hinsicht sind, wieder Perspektiven entwickeln? In welcher Weise braucht es den Umbau unserer Gemeinwesen und Ökonomien? Wie kann es uns gelingen, fairere Lohn- und Besitzverhältnisse zu schaffen und mehr Menschen von einem nachhaltigeren Lebensstil zu überzeugen?
… allemal wichtiger als Glasperlenspiele in der eigenen Filterblase
Denn vieles ist ja mit der Coronakrise nicht fundamental anders geworden. Es war auch bisher nicht in Ordnung, dass mit großer Selbstverständlichkeit der eigene Ressourcenverbrauch externalisiert und der Allgemeinheit aufgebürdet wurde, dass die Schieflagen in Einkommen und Vermögen nicht mehr begründet, sondern nur mehr zur Kenntnis genommen werden konnten. Diese Debatten um die Zukunft unserer Gesellschaften werden unweigerlich an Fahrt gewinnen. Vielleicht schaffen es unsere Demokratien, im Zuge dieser kommenden Auseinandersetzungen einige der großen Schieflagen zu korrigieren, wieder mehr soziale Gerechtigkeit zu ermöglichen, den Ressourcenverbrauch zu drosseln und, man sollte immer wieder mal daran erinnern, endlich eine adäquate Besteuerung der großen (Internet)Konzerne und Kapitalgesellschaften zu erreichen. Dass die Hauptlast in der Krisenbewältigung nicht wieder die breiten Mittelschichten (durch erhöhtes Steueraufkommen) und die ärmeren Segmente (durch Kürzungen der Transferleistungen) tragen müssen, darin wird die große Herausforderung bestehen. Hoffentlich fehlen dann nicht die qualifizierten Beiträge aus den theologischen Wissenschaften, denn zu diesen Fragen hätten religiöse Traditionen eine Menge beizutragen. Sie sind allemal wichtiger als Glasperlenspiele in der eigenen Filterblase.
Alois Halbmayr ist ao. Professor für Systematische Theologie und Dekan der Theologischen Fakultät in Salzburg
Bildquelle: Pixabay