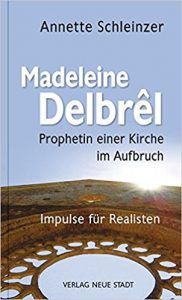Für sie musste sich der Glaube auf die Wirklichkeit einlassen, auch auf eine Wirklichkeit, in der Gott keine Rolle spielt. Von Annette Schleinzer.
„Lautlos naht der Kirche eine Grundgefahr: die Gefahr einer Zeit, einer Welt, in der Gott nicht mehr geleugnet, nicht mehr verfolgt, sondern ausgeschlossen, in der er undenkbar sein wird; einer Welt, in der wir seinen Namen herausschreien möchten, es aber nicht können, weil uns kein Platz bleibt, um unsere Füße hinzustellen.“
Madeleine Delbrêl[1]
Bereits Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts hat Madeleine Delbrêl, eine Situation voraus gesehen, die mittlerweile etwa in ostdeutschen Bundesländern alltägliche Erfahrung ist. Über 80 Prozent der Menschen gehören dort keiner Konfession an. Sie scheinen nicht nur Gott vergessen zu haben: Sie haben sogar „vergessen, dass sie Gott vergessen haben“.[2]
Prophetin
Zu diesen Erfahrungen kommt der Wandel hinzu, in dem sich die Kirche selbst befindet: innerkirchlich z.B. durch den Mangel an Priestern, an GottesdienstbesucherInnen und überhaupt an Mitgliedern, nach außen hin im Verlust an Bedeutung in der heutigen Gesellschaft. Gerade hauptamtlich Tätige neigen dann manchmal dazu, sich solchen Mangel-Erfahrungen fatalistisch zu ergeben. Dahinter verbirgt sich nicht selten ein „Gefühl der Niederlage, das uns in unzufriedene und ernüchterte Pessimisten mit düsterem Gesicht verwandelt“, wie Papst Franziskus schreibt. [3]
Einen ganz anderen Grundton schlägt Madeleine Delbrêl (1904-1964) an, die nicht nur als eine Vorläuferin des Zweiten Vatikanischen Konzils gilt, sondern auch als eine „Prophetin der Nachkonzilszeit“. Sie ist davon überzeugt, dass das „Abenteuer des Glaubens“ zwar in einer Zeit spielt, in der es kaum Wegmarken gibt – dass aber Gottes Heiliger Geist von „unerschöpflicher Fantasie“ ist.
Madeleine Delbrêl wurde 1904 in Mussidan im Südwesten Frankreichs geboren. In ihrer Jugend war sie eine überzeugte Atheistin. Eine Lebenskrise und der damit verbundene intensive Suchprozess löste in der Zwanzigjährigen eine Erfahrung aus, die sie als „überwältigende Bekehrung“ (OC X 212) bezeichnete: die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Im Evangelium Jesu Christi hat sie eine Form dafür gefunden, aus diesem „unerhörten Glück“ zu leben und es mit anderen zu teilen.
Biographische Streiflichter
Nachdem sie sich zur Sozialarbeiterin hatte ausbilden lassen, lebte sie über dreißig Jahre lang mit ein paar Gefährtinnen im kommunistisch geprägten Arbeitermilieu in Ivry, einer Stadt in der Pariser Banlieue. Dort versuchten sie gemeinsam, den Menschen nahe zu sein und so die Liebe Gottes zu bezeugen.
Schon in den vierziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurden all diejenigen auf sie aufmerksam, die nach neuen pastoralen Möglichkeiten in der zunehmend entchristlichten Kirche Frankreichs suchten. Mit zahlreichen Arbeiterpriestern – allen voran Jacques Loew – war sie zeitlebens freundschaftlich verbunden. Vor allem in ihren letzten Lebensjahren wurde sie immer häufiger zu Vorträgen eingeladen und um Erfahrungsberichte gebeten, bis hin zur Bitte um Mitarbeit bei den Vorbereitungen des Zweiten Vatikanischen Konzils.
Als sie am 13. Oktober 1964 ganz plötzlich starb, hinterließ sie trotz alledem nicht viel: ein Buch und zahlreiche unveröffentlichte Texte und Manuskripte; einen Freundeskreis, der kaum weiter reichte als über die Grenzen einer kirchlichen Minderheit hinaus. Doch die Ausstrahlung ihrer Botschaft begann.
Für Madeleine Delbrêl wurde die kommunistisch regierte Stadt Ivry zur „Schule angewandten Glaubens“ (vgl. OC X 210). Denn die Menschen, unter denen sie lebte, forderten sie dazu heraus, sich auf die Grundlagen des Glaubens zu besinnen und diese von zeitbedingten Vorstellungen und Traditionen zu unterscheiden. Madeleine Delbrêl spricht dabei oft von einer Verwechslung zwischen Glauben und „christlicher Mentalität“.
Eine besonders günstige Bedingung für die Umkehr zum lebendigen Gott
„Dann hängt man sich an besondere Moralvorstellungen, bekennt sich zu politischen Optionen und nimmt einen bestimmten Lebensstil an…; all das betrachtet man aber als Verpflichtungen des christlichen Lebens, all das verwechselt man mit dem Glaubensleben“ (OC VIII 122f.).
Dann ist es aber auch kein Wunder, wenn sich Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche nicht davon angesprochen fühlen. Sie können kaum erkennen, was das mit ihrem Leben zu tun hat und wozu der Glaube gut sein soll. Die Suche nach Gott und nach Ausdrucksformen des Glaubens muss deshalb immer wieder neu unternommen werden.
„Wenn wir stattdessen versuchen, einfach nur den Glauben zu bewahren, einfach nur Christen zu bleiben, verkümmert unser Glaube meist, und meist bleiben wir gerade dann keine echten Christen mehr. Denn der Status quo scheint uns, von nahem betrachtet, die tödlichste Einstellung zu sein – vielleicht, weil er in Bezug auf den Glauben sozusagen gegen die Natur ist“ (OC VIII 101).
Damit wird es auch notwendig, eine neue religiöse Sprache zu finden. Für viele Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche ist sie eine Fremdsprache geworden. „Religiöse Vokabeln sind für sie deshalb wie Chinesisch. Sie sind ihnen unverständlich und werden nicht mehr als Hilfe zur Lebensdeutung und Lebensbewältigung erfahren“.[4]
Wie soll man dann z.B. einem Menschen, für den Gott keine Rolle spielt, erklären, was Beten heißt? Wie kann man einem Kind, das areligiös aufgewachsen und dessen Großmutter gestorben ist, die Hoffnung auf Auferstehung vermitteln, nachdem der Vater dem Kind erklärt hat, „dass die Oma jetzt zu Humus wird?“[5] Hier ist eine immer neue, sensible Übersetzungsarbeit vonnöten. Man wird das „Unübersetzbare umkreisen, sich ihm annähern, es zusammenfassen, erahnen lassen müssen“ (OC VIII, 141f.).
Letztlich ist es, so Madeleine Delbrêl, die Sprache Jesu, die das Herz eines Menschen am tiefsten erreichen kann. In der Schule Jesu „lernen wir, mit dem eigenen Herzen auf die Herzen der anderen und auf ihr Hoffen zu lauschen“ (OC XII 308). Wenn Jesus von Gott sprach, war das meist mit einer Geste der Zuwendung verbunden: Er hat die Menschen geheilt, er hat sie aufgerichtet, er gab ihnen Ansehen. Solche Gebärden der Liebe – Madeleine Delbrêl nennt es „Herzensgüte“ – zu vollziehen, wird für sie zur Lebensaufgabe. Sie ist davon überzeugt, dass alle Menschen gott-fähig sind. Diese Fähigkeit kann allerdings geleugnet werden, sie kann unbewusst sein oder atrophiert wie ein Muskel, der nicht trainiert wurde. Doch die Herzensgüte vermag daran anzuknüpfen.
Auf das Hoffen der Menschen lauschen.
„Die Herzensgüte, die von Christus herkommt, von ihm geschenkt wurde, … hat für ein ungläubiges Herz … den unbekannten Geschmack Gottes und macht es fühlsam auf die Begegnung mit ihm hin… Sie verbündet sich mit dem, was im Herzen eines Ungläubigen sowohl das Einsamste wie auch das am meisten Geeignete ist, sich ganz im Innern zu Gott als einer Möglichkeit hinzuwenden“ (OC VIII 150).
Solche Begegnungen erfordern eine große Behutsamkeit. Es gilt, auf das Hoffen der Menschen zu lauschen, ohne sie vereinnahmen oder „verkirchlichen“ zu wollen. „Die Kirche muss diese unfassbare Freiheit des Wortes akzeptieren“.[6]
Sie muss dann auch akzeptieren, dass Menschen kommen und wieder gehen, und dass es immer wieder Menschen geben wird, die sich nicht angesprochen fühlen. Ja, mehr noch: sie muss akzeptieren, in dieser Welt ein „Fremdkörper“ zu sein.
„Für ihre Freunde, Nachbarn, Mitbürger werden Christen nicht aufhören zu existieren; sie können geliebt und geachtet und mit schwierigen Aufgaben betraut werden; aber sie sind oder werden zu Fremden… In ihrer Geistesart gibt es etwas, das anderen Menschen nicht angepasst werden kann“ (OC XI 186).
Fremdheit und Einsamkeit aushalten
Dieses Fremdsein ist gar nicht unbedingt an eine Minderheitensituation gebunden. Auch unter volkskirchlichen Bedingungen können Christen und Christinnen eine solche Erfahrung machen, „sobald sie von Gott als einer Wirklichkeit berührt worden sind“.[7] Wenn sie dann der Spur ihrer eigenen Berufung folgen, können sie in ihrem Freundeskreis, in ihrer Gemeinde, ja selbst für ihre eigene Familie zu „Fremdlingen“ werden.
Für Madeleine Delbrêl folgt dies notwendigerweise aus dem Glauben. Sie spricht sogar vom „normalen Gewaltzustand des Glaubens“.[8] Denn wer sich auf den lebendigen Gott einlässt, gerät immer wieder in Situationen, in denen es um Entscheidungen und Unterscheidungen geht: um eine „Wahl zwischen ‚Welt‘ und Reich Gottes“ (OC X 116). Der Glaube, der doch in der Welt gelebt werden will, trifft dann immer wieder auf etwas, was im Widerspruch zu ihm steht. Und das keineswegs nur dort, wo Menschen Gott leugnen oder wo er für sie überhaupt keine Rolle spielt. Vielmehr trifft der Glaube auch auf die Ambivalenz, die sich inmitten der Kirche befindet und damit auch im Herzen eines jeden Christen und einer jeden Christin.
Der Glaube ist deshalb an eine immer neue Bekehrung gebunden. Sie ist es dann auch, die hellsichtig dafür macht, die Fremdheit, die in der Natur des Glaubens liegt, nicht mit einer religiösen Sonderwelt zu verwechseln. Die Erfahrung, fremd zu sein, ist für Madeleine Delbrêl vielmehr ein Anstoß, die Art und Weise zu hinterfragen, wie der Glaube gelebt wird: ob man sich nicht aus lauter Sorge, dem „Zeitgeist“ zu verfallen, zu wenig auf die Wirklichkeit einlässt und sich dadurch vom Leben der Menschen in verkehrter Weise abhebt. Es ist jedoch unsere Berufung, „den Menschen dieser Welt als Blutsbrüder und Schicksalsgefährten verbunden sein <zu> wollen“ (OC X 172).
Mission in der Dichte – oder: Eine Insel göttlicher Anwesenheit sein
Zur Schicksalsgefährtenschaft gehört es, sich auch stellvertretend für diejenigen zu Gott hinzuwenden, die nicht an ihn glauben oder für die er keine Rolle spielt. Madeleine Delbrêl war davon überzeugt, dass gerade darin eine große missionarische Fruchtbarkeit liegen kann.
Diese „Mission in der Dichte“ (OC XI 148) vollzieht sich in der Fürbitte und vor allem auch in der Anbetung, die nicht nur ein „Akt elementarer Gerechtigkeit“[9] gegenüber Gott ist, sondern zugleich auch „die größte Wohltat, die man der Welt erweisen kann“.[10]
Es macht den Kern der Spiritualität Madeleine Delbrêls aus, sich in diesem Sinne als Verbindungsglied zwischen Gott und den Menschen zu verstehen. Wer versucht, sich dem lebendigen Gott auszusetzen und sich zugleich die „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen“ zueigen zu machen, wird zu einer „Insel göttlicher Anwesenheit“ (OC XIII 169). Das kann überall geschehen, auch und gerade an scheinbar ganz profanen Orten wie einem Pariser Szene-Café:
„Weil deine Augen in den unsren erwachen, weil dein Herz sich öffnet in unserm Herzen“, ist dieses Café „nun kein profaner Ort mehr… Wir wissen, dass wir durch dich ein Scharnier aus Fleisch geworden sind, ein Scharnier der Gnade, die diesen Fleck Erde dazu bringt, sich mitten in der Nacht, fast wider Willen, dem Vater allen Lebens zuzuwenden. In uns vollzieht sich das Sakrament deiner Liebe…“ (OC III 65).
In dieser Weise „Gott einen Ort zu sichern“ erschien Madeleine Delbrêl und ihren Gefährtinnen schließlich als Mittelpunkt ihres Lebens. Sie verstanden sich dabei als eine kleine Zelle von Kirche, die das Feuer des Glaubens hüten möchte und gerade deshalb immer in Bewegung bleiben muss.
„Wir sind zu jedem Aufbruch bereit, weil unsere Zeit uns so geformt hat, und weil Christus im heutigen Tempo mitgehen muss, um mitten unter den Menschen zu bleiben“.[11]
Annette Schleinzer ist Ordinariatsrätin und theologische Referentin des Bischofs von Magdeburg, zudem Exerzitienbegleiterin und eine der anerkanntesten Delbrêl-Kennerinnen im deutschen Sprachraum.
[1] Madeleine Delbrêl, Œuvres Complètes VIII, 119f. Im Folgenden werden die gesammelten Werke im fortlaufenden Text zitiert als OC I-XIII.
[2] Vgl. Karl Rahner, Meditation über das Wort Gott, Freiburg: Verlag Herder 2013, 27.
[3] Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii Gaudium 85.
[4] Bischof em. Joachim Wanke, Interview mit der Tageszeitung „DIE WELT“ vom 3.5.2012.
[5] So hat es mir ein zehnjähriges Kind aus meiner Nachbarschaft in einem Dorf in Sachsen-Anhalt erzählt.
[6] Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii Gaudium 22.
[7] Reinhard Körner, Gott. 95 Thesen, Leipzig: St. Benno Verlag 2016, These 31.
[8] Vgl. dazu Annette Schleinzer, Madeleine Delbrêl – Prophetin einer Kirche im Aufbruch, Impulse für Realisten, München: Verlag Neue Stadt 2017, 157ff.
[9] Madeleine Delbrêl. La joie de croire, Paris 1968, 160.
[10] Dies., Gebet in einem weltlichen Leben, Einsiedeln: Johannes Verlag 51993, 56.
[11] Dies., Frei für Gott, Einsiedeln: Johannes Verlag 1976, 71.