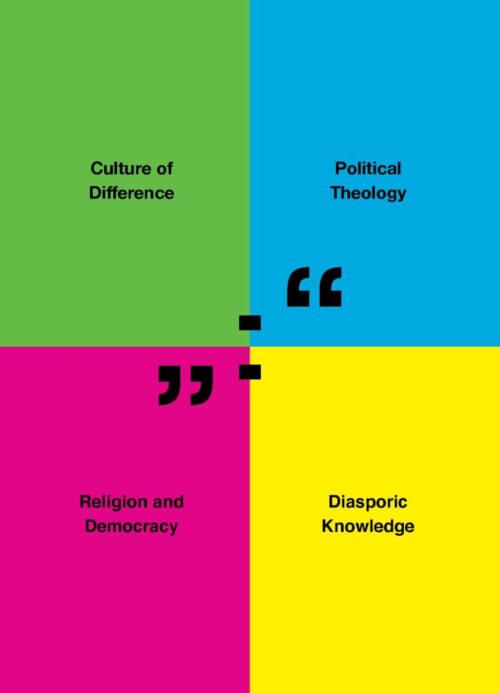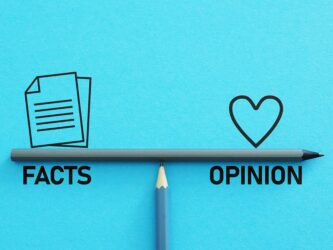Als Privatdozent für „Geistesgeschichte des Abendlandes“ an der Universität Wien war Friedrich Heer eine der schillerndsten Gestalten katholischer Intellektualität nach 1945. Stephan Steiner erörtert an einem Beispiel die Muster religiös-intellektueller Diaspora.
Zunächst setzt Heers beeindruckendes Werk die durch den Universalgelehrten und „genialen Dilettanten“ Egon Friedell begründete große Tradition österreichischer Kulturgeschichtsschreibung fort. In einer Zeit, als die Verstrickungen der christlichen Kirchen im Nationalsozialismus ein dunkles Licht auf sie warfen, war sich Friedrich Heer nicht zu schade, sich leidenschaftlich als Katholik zu bekennen – und gleichzeitig die Verfehlungen der Kirche deutlich zu benennen. Ausgezeichnet als erster Preisträger mit der Buber-Rosenzweig-Medaille 1968 für seine wegweisende historische Streitschrift „Gottes erste Liebe. 2000 Jahre Judentum und Christentum. Genesis des österreichischen Katholiken Adolf Hitler“ scheute er vor keiner Konfrontation zurück. Als Patriot, Europäer und Aufklärer, aber auch als glühender Bewunderer Maria Theresias oder des christlichen Mittelalters vereinigte er eine Vielzahl von Gegensätzen in seiner Person. Für das christlich-jüdische Gespräch wurde er mit unbequemen Interventionen regelmäßig zum wichtigen Impulsgeber.
Ein jüdisch-katholisches Beziehungsgeflecht
Die Begegnung mit Friedrich Heer lenkt den Blick auf Wien und den geistigen wie geistlichen Horizont Mitteleuropas – eine meist vergessene Landschaft mit einem enorm reichhaltigen jüdisch-katholischen Beziehungsgeflecht, das bis heute prägend bleibt. Lässt man sich auf eine solche geistesgeschichtliche Spurensuche ein, begegnet plötzlich eine lange Reihe markanter wie vergessener Gestalten: sei es Monsignore Österreicher als Zelebrant beim Begräbnis von Joseph Roth, die „einsame Zwiesprache“ zwischen Martin Buber und Hans Urs von Balthasar oder die schillernde Geschichte jüdischer Michelangelo-Verehrung und Italiensehnsucht, für die Sigmund Freuds Reflexionen über den Mann Moses nur das prominenteste Beispiel sind. Selbst der mythenumrankte Jacob Taubes, schillernder Vertreter jüdischer Intellektualität in den Debatten der Bundesrepublik, ist als Sprössling ganzer Generationen bedeutender jüdischer Gelehrter aus Osteuropa ohne diese geistige wie geistliche Landschaft seiner Geburtsstadt kaum zu verstehen.
Friedrich Heer wie Jacob Taubes stehen exemplarisch für die leidenschaftliche Arbeit an den Konflikten zwischen Judentum und Christentum. Nach der Katastrophe der Schoah suchten sie die Annäherung nicht durch Harmonie, sondern den Mut zur Artikulation von Differenzen. Ihr Wirken zeigt Religionsgespräche im Zeichen intellektueller Redlichkeit, die Brüche nicht verschweigen. Jüdisch wie katholisch begegnet die Moderne bei ihnen als radikale Infragestellung religiöser Lebensführung. Paradoxerweise überschreitet das Feld des Religiösen damit den Bereich theologischer Kontroversen und verwandelt sich zu einer transformierenden Macht in den Feldern von Politik, Gesellschaft und Kultur.
Politische Theologie – jüdisch und katholisch
Die Erfahrung der Kulturkämpfe des 19. Jahrhunderts wie die „Fortdauer des Theologisch-Politischen Problems“ bilden für Friedrich Heer, aber auch für Jacob Taubes das Herzstück der konfliktreichen Beziehungsgeschichte von Judentum und Christentum. Dennoch markierte die Berufung des Philosophen und ordinierten Rabbiners Jacob Taubes an die Freie Universität Berlin ein zentrales Ereignis der intellektuellen Gründungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland nach 1945. Als die Freie Universität Berlin Jacob Taubes 1965 auf eine Professur berief – betraut mit der Aufgabe, die stolze Tradition der Wissenschaft des Judentums aus dem 19. Jahrhundert fortzusetzen, die 1942 gewaltsam beendet wurde –, ignorierte er nicht nur solche dissonanten Erwartungen, sondern begann stattdessen ein Gespräch mit Carl Schmitt, dem berüchtigten „Kronjuristen des Dritten Reiches“. Bis heute bleibt an dieser jüdisch-katholischen Faszination für politische Theologie die Frage irritierend: Warum muss sich Taubes ausgerechnet mit Schmitts politischer Theologie befassen? Gibt es nicht ein angenehmeres und weniger widerwärtiges Thema für kluge und vielversprechende junge Intellektuelle, die sich für Religion und Politik interessieren?
Das Nachdenken über Alternativen zum Liberalismus und seinen Sackgassen ist dringlich!
Es steht vollkommen außer Frage, dass jede jüdische – oder christliche – Rezeption durch den Antisemitismus Carl Schmitts belastet ist. Ebenso wenig kann beschönigt werden, dass Carl Schmitts Theorie einen Feind hat – und der ist jüdisch. Umso bemerkenswerter ist die fortdauernde Präsenz und Rezeption seines Werkes in Israel, Frankreich, Italien oder den USA. Offenbar gibt es einige beunruhigende Fragen, die sich mit dem Fortbestehen der politischen Theologie Carl Schmitts stellen. Zunächst einmal ist es einfach die Tatsache seines anhaltenden Einflusses und seiner Faszination. Was zieht die Menschen zum Werk von Carl Schmitt? Und was macht es weiterhin so einflussreich? Angesichts einer neuen Dringlichkeit des Nachdenkens über Alternativen zum Liberalismus und seinen Sackgassen sollten wir nicht versäumen, auch nach Alternativen zu Schmitts Werk zu fragen. Schließlich könnte die Rezeption von Schmitts politischer Theologie spezifische Unterschiede zwischen seinen jüdischen und christlichen Bewunderern – oder Kritikern – aufzeigen. Angesichts der zunehmenden Polarisierung innerhalb von Religionsgemeinschaften und der Wiederkehr neuer Kulturkämpfe – christlich wie jüdisch – scheint die Frage lohnenswert, was sich aus dieser Rezeptionsgeschichte über Typologien von jüdischen und christlichen Konservativen – und ihre Unterschiede – lernen lässt. Solche Spuren erkundet das Berliner Zentrum für intellektuelle Diaspora als jüdisch-katholisch inspiriertes Forum für Diskussionen, Begegnungen und Debatten zu Fragen der zeitgenössischen Politik, Religion, Gesellschaft und Kultur.
Intellektuelle Diaspora und Interreligiöser Dialog
Angesichts der grundlegenden religiösen Veränderungen, die wir heute erleben, geraten zahlreiche unverrückbar wirkende Gewissheiten in Bewegung – selbst Verhältnisse von Mehrheiten und Minderheiten. In einer solchen Situation mag die bislang eher exotische Erfahrung der Diaspora – die Katholik*innen in Berlin oder im Osten Deutschlands durchaus wohlvertraut ist – möglicherweise sogar zu einem Lernort der Kirche zu werden. Nicht zuletzt mit jüdischen Gesprächspartner*innen sorgt es freilich für Erstaunen, und weckt vielleicht den Verdacht der Anmaßung, wenn ausgerechnet der Katholizismus sich als Diaspora beschreibt. Die diasporische Erfahrung ist allerdings kein Berliner Spezifikum und eröffnet gerade auch weltkirchlich Resonanzräume. Zugleich mag sie den Austausch auf Augenhöhe mit anderen religiösen Traditionen erleichtern und verfeinert vielleicht sogar die Wahrnehmung für Veränderungen im interreligiösen Gespräch, wenn sie den Austausch mit anderen Traditionen der intellektuellen Diaspora sucht – etwa der islamischen oder anderen christlichen Konfessionen sowie afrikanischen und anderen transnationalen Gemeinschaften.
Wonach fragt man in der Diaspora?
Das spezifische Fragen intellektueller Diaspora – sei sie jüdisch, katholisch oder muslimisch – bleibt der Fokus auf die Gestaltung von Gesellschaft, auf das Freilegen von theologischen Glutkernen der politischen Problemlagen und auf die kulturelle Prägekraft religiöser Lebensführung. Die historische Erkundung jüdischer und katholischer theopolitischer Konstellationen ist schließlich mit dem Desiderat verbunden, katholische wie jüdische Akteure zu versammeln, um einen regelmäßigen Austausch mit Interventionen und Debatten zur gegenwärtigen Rolle der Religion in der säkular-pluralistisch geprägten demokratischen Kultur Europas anzustoßen – und eine Weitergabe an die nächste Generation sicherzustellen.
Als Beispiel für die tiefgreifenden Veränderungen und Herausforderungen des interreligiösen Dialogs in Deutschland sei auf ein Gespräch mit dem Historiker Dan Diner über religionspolitische Engführungen postkolonialer Diskurse verwiesen. Zugespitzt formuliert Diner: „Wenn Churchill nur ein Rassist war, hat es Hitler nicht gegeben.“ Postkoloniale Bilderstürmerei, die Churchills Leistung für die Befreiung Europas vom Hitler-Faschismus unterschlägt, entwertet grundlegende politische Differenzen. Aus einer universalgeschichtlichen Position der Distanz weist er zudem auf blinde Flecken des Kolonialdiskurses hin. Wie ist beispielsweise mit dem Osmanischen Reich umzugehen, das zugleich Vertreter des kolonisierten Orients wie kolonisierender Eroberer war? Anhand historischer Konstellationen macht Diner damit auf Konflikte der Gegenwart aufmerksam, die theologische Semantiken für das politische Kraftfeld instrumentalisieren.
Mitmachen
Vor mittlerweile zwei Jahren wurde das Berliner Zentrum für intellektuelle Diaspora gegründet (https://intellectualdiaspora.org/). Dessen Anliegen ist es, das christlich-jüdische Gespräch durch die gemeinsame Arbeit an ideengeschichtlichen Konstellationen sowie in Auseinandersetzung mit politisch-theologischen Konflikten der Gegenwart neu zu verlebendigen und eine junge Generation für die kontroverse wie inspirierende Kraft christlich-jüdischer Verständigung zu begeistern. Regelmäßig finden Veranstaltungen zum Kulturkampf, zur politischen Theologie in Israel und Europa, zu Talmud und politischer Theorie sowie eine transatlantische Frühlingsschule „Religion and the Culture of Democracy“ statt. Interessent*innen können sich gerne melden unter: steiner@katholische-akademie-berlin.de
—
![Stephan2 [2] Stephan2 [2]](https://www.feinschwarz.net/wp-content/uploads/2023/04/Stephan2-2.jpg)