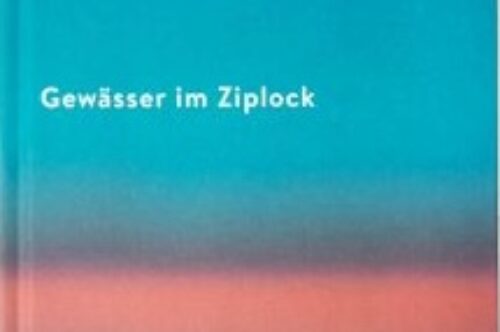Als junge literarische Stimme kartografiert Dana Vowinckel den Facettenreichtum jüdischen Lebens heute. Christoph Gellner stellt ihr vielfach ausgezeichnetes Romandebüt «Gewässer im Ziplock» vor.
Ein Sommer zwischen Chicago, Berlin und Jerusalem: Die 15-jährige Margarita verbringt wie immer die Sommerferien bei den amerikanischen Großeltern Selma und Dan in Chicago, lieber will sie zurück nach Deutschland zu ihren Freund:innen und ihrem israelischen Vater Avi, der alleinerziehend mit ihr in Berlin lebt und als Kantor in der Synagoge die Gebete leitet. Die US-amerikanische Mutter Marsha verließ beide, als Margarita laufen gelernt hatte, nun hat sie als Linguistikprofessorin ein Fellowship in Jerusalem. Damit sie einander kennenlernen, organisieren Grandma, Marsha und Avi ein Treffen in Israel, wo Margarita noch nie war. An vielen Stellen von Dana Vowinckels am 20. August 2023 erschienenem Debütroman brechen die Konfliktlinien jüdischer Gegenwart auf, die seit den Terroranschlägen der Hamas am 7. Oktober neu debattiert werden. Bei Lesungen in Deutschland erhält Dana Vowinckel Polizeischutz, wie sie bei einer Buchpräsentation in der Schweiz erzählte.
Deutsch-amerikanisch-israelisches Beziehungsgeflecht
Mit den ersten 25 Seiten ihres Romans gewann die 25-Jährige 2021 beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt den Deutschlandfunk-Preis. Fokussiert auf Avis liturgisch-musikalische Tätigkeit als Chasan entfalten sie ein kompliziertes familiäres deutsch-amerikanisch-israelisches Beziehungsgeflecht. «Sein Verhältnis zu Gott war nie so friedlich wie dann, wenn er an ihn dachte als Freund, als Begleiter seiner Stimme, ruhig und sanft», wird der 45-Jährige als frommer Jude eingeführt, dem die Rituale seiner Religion Halt geben, zugleich wird vom großen Sicherheitsaufwand erzählt, den die Berliner Gemeinde benötigt. «Er liebte seinen Beruf nicht nur, weil er anleiten konnte, das Heiligste in Worte zu fassen, sondern auch wegen der literarischen Fülle der Gebete. Etwas, was die Deutschen nie verstehen würden, egal wie oft sie sich durch die Synagogen des Landes führen ließen, die noch standen, die ihre Großeltern nicht abgebrannt hatten.» Der rätselhafte Romantitel kombiniert Psalm 93 – «Mehr als die Stimmen großer Gewässer, mächtiger als die Meeresbrandung ist der Ewige mächtig in der Höhe» – mit dem Ziplock-Beutel, der Grandmas Reiseproviant für Margarita enthält.
«Ich komme aus einer Familie, wo meine Großeltern und Urgroßeltern väterlicherseits amerikanische Juden sind und meine Urgroßeltern mütterlicherseits Nazis.»
Als Tochter eines säkularen US-amerikanischen Juden und einer deutschen Protestantin wuchs Dana Vowinckel in Berlin-Kreuzberg zweisprachig auf, durch ihre Großeltern kennt sie das konservative Judentum der USA und trat mit elf Jahren zum jüdischen Glauben über. Für Kinder sei es «sprachlich sehr spannend, viel Zeit in Synagogen zu verbringen. Da sind sie umgeben von einer Sprache, die sie oft nicht oder nur teilweise verstehen», verdeutlicht sie im Interview mit der Jüdischen Allgemeinen. «Ich komme aus einer Familie, wo meine Großeltern und Urgroßeltern väterlicherseits amerikanische Juden sind und meine Urgroßeltern mütterlicherseits Nazis.» Doch handelt es sich bei Gewässer im Ziplock um keine literarische Autofiktion, sie wolle nicht mit einer ihrer Figuren verwechselt werden, warnt die Autorin, für Avi habe sie die Perspektive eines Menschen eingenommen, der sehr viel religiöser ist als sie selbst. Das Buch ist Vowinckels Großvater väterlicherseits gewidmet, einem namhaften Judaisten. Seine aus der Ukraine stammenden Eltern lernten sich kennen, nachdem sich ihre Familien wie Tausende andere jüdische Einwanderer im Nordosten Chicagos niedergelassen hatten. Eigens bedankt werden die Schriftstellerinnen Julia Frank, Katharina Hacker und Olga Grjasnowa, sie haben eine biografische Nähe zum Judentum und unterstützten ihr Romanprojekt.
In Deutschland jüdisch sein
Vowinckel wechselt in der Erzählung zwischen Margaritas und Avis Perspektive, in einem Glossar sind einige, längst nicht alle im Text verwendete religiöse Begriffe erläutert. «Alle fremdelten mit ihm», bilanziert Avi Fuchs, «die Deutschen, die Juden, auch die wenigen Israelis in Hannover, denn entweder waren sie keine Juden oder sie waren keine Israelis, oder sie waren keine alleinerziehenden Väter, und er fremdelte auch, er fand sie fremd, fand sich fremd […] je mehr man fremdelte, desto mehr fremdelten die Menschen mit einem, und man wurde seltsamer und seltsamer. Nur am Klavier, nur im Gesang und am Ende im Gebet wurde er sich selbst weniger fremd.»
Die zionistischen Eltern seiner deutschstämmigen Mutter und seines türkischstämmigen Vaters hatten Alija gemacht, so war Avi in Tel Aviv aufgewachsen, er wollte Kampfpilot werden, machte dann eine Ausbildung zum Chasan «mit dem Gefühl, sein ganzes Leben als eine konservative Rebellion gegen seine Eltern zu führen». Als er mit Marsha und dem Baby nach Deutschland zog und Kantor in Hannover wurde, war er «weniger gefestigt in allem Religiösen». Im Rückblick erschien ihm sein Leben als «ein Wanken zwischen den Welten, zwischen den Sprachen». Wie schön die Sprache ist, die uns Gott gegeben hat, dachte Avi. Dieses Hebräisch des Volkes Israel ist «ein Regenmantel aus Sprache, ein Regenmantel aus kehligen Lauten, an dem alles abperlte, der alles überstand. Gut und schön, dieses Wort, für immer und ewig.»
Seine Tochter war eine Deutsche. Sie verstand die Sprache der Täter so viel besser als er.
Obwohl Margarita Avis Angst und Überbesorgtheit nie verstand, erfuhr auch sie Ausgrenzung als Jüdin. Ihr deutscher Freund Nico fängt im Zusammenhang mit Israel sofort von «Kolonialismus» an zu reden. Selbst in der Neuen Synagoge an der Oranienburger Straße hatte sie «immer das Gefühl, alle würden sie schief von der Seite anschauen, weil sie alleine, ohne Eltern, dort war, so oft sie auch sagte, dass ihr Vater lediglich in einer anderen arbeitete». Als Margarita bei einer Freundin im Fernsehen den antisemitischen Anschlag auf die Synagoge in Halle am Versöhnungstag Jom Kippur 2019 verfolgte, begriff ihr Vater: «Seine Tochter war eine Deutsche. Sie verstand die Sprache der Täter so viel besser als er, dass sie sich darin bequem bewegte. Margarita gehörte zu der winzigen übriggebliebenen Schnittmenge von deutschen Juden nach 1945, über die er in seinem Leben zwar schon nachgedacht hatte, zu der er sein israelisch-amerikanisches Kind aber nie gezählt hatte.»
Konfliktreiche Gemengelage
Mutter und Tochter verpassen sich, da Marsha Markovitz sich über ihre Ankunft in Jerusalem irrt. Alleingelassen folgt die Pubertierende dem 17-jährigen Israeli Lior, den sie im Flugzeug kennenlernte, nach Tel Aviv. Sie haben Sex und kommen ins Gespräch über Politik: Lior nimmt an Demonstrationen gegen «Bibi» Netanjahu teil, ihre Forderungen kritisiert Margarita scharf: «Denkst du nicht, dass die Hamas die Leute ermordet, indem sie sie zu Märtyrern erzieht, wenn es die Israelis nicht tun?» Margarita erfährt, wie sehr Avis Eltern Marsha hassten: «War ganz egal, dass ich Jüdin bin, für sie war die Hauptsache Israelin», erzählt sie ihrer Tochter. «Ihre Leben haben in Israel angefangen, klar waren sie traumatisiert, wie alle hier.» Damit Margarita nicht in Israel zum Militärdienst muss, zogen sie nach Deutschland, doch dort war für sie als säkulare Jüdin kein Platz: «man ist Jude oder man ist es nicht». Margarita will wissen, wie sie sich kennenlernten und stellt sich ihren Vater als jüngeren Mann vor, in Israel, zuhause in der Sprache, kein Außenseiter. Plötzlich schämt sie sich, dass sie ihn so häufig triezte, sich über ihn lustig machte, weil er ihr peinlich war wegen seines Akzents.
Ich bin nicht weniger jüdisch, nur weil ich an Jom Kippur Schinken esse.
Mutter und Tochter kommen sich auf einem gemeinsamen Roadtrip ans Rote Meer und zurück näher, Margarita will mehr «über den Konflikt» zwischen Israelis und Palästinensern lernen, am Jordan überkommt sie Furcht: «Vielleicht tötet mich eine Bombe im Schlaf». Nach der Tour ist sie noch verwirrter, nicht zuletzt wegen der brisanten innerjüdischen Fronten: «Ich bin nicht weniger jüdisch, nur weil ich an Jom Kippur Schinken esse», gibt ihr Marsha zu verstehen, die kein Problem hat, an Schabbat Auto zu fahren. «Es gibt kein Jüngstes Judengericht und keinen Beichtstuhl. Wir sind keine Christen.» Parallel dazu macht Avi Urlaub auf Spiekeroog, wo ihn die Jüdin Hannah «in diesem aufgeregten deutschen Ton» fragt: «Glaubst du an die Evolution? […] im Ernst, die spinnen doch, die Haredim. Das sind Fundis, genau wie Islamisten und diese Spinner-Christen».
In Marshas Ungebundenheit empfindet Margarita eine Freiheit, die sie bisher nicht kannte: «eine Gemeinsamkeit. Etwas Verbotenes, diesem Vater gegenüber, ja, die Idee davon, wie ein Leben mit der Mutter wäre, ein Leben ohne ständiges Feilschen, wie lange sie ausbleiben durfte». Vollends verwirrt sie das Familiengeheimnis, das Marsha ihr eröffnet: «deine Großmutter ist adoptiert. Ihre Adoptivmutter war natürlich Jüdin, aber ihre leibliche Mutter war nicht jüdisch. Deine biologischen Urgroßeltern waren Katholiken.» Das habe Grandma ihr schon als Kind erzählt: «Es war nie ein Thema, wir sind Juden, zumindest in Amerika, wen interessiert da die Halacha.»
Sie wollte nirgendwo dazugehören, nicht zu den Tätern, nicht zu den Opfern
Jerusalem ist Margarita unsympathisch, sie will lieber in Tel Aviv im Meer schwimmen und haut zu Lior ab. Avi kommt nach Jerusalem, um sie suchen zu helfen. Als sie endlich zusammen sind, fällt Margarita auf, dass Avi die Kippa hier nicht unter einer Mütze verbarg wie in Deutschland. Bevor am Ende alle drei zur verunfallten Grandma nach Chicago fliegen, besuchen sie Yad Vaschem. Avi wähnt, Margarita weine wie eine Deutsche aus Scham, nicht aus Trauer. Doch Margarita, «wo sie einmal das Geheimnis kannte», wusste nicht, ob es sie wirklich betraf. «Immerhin die Nazis hätten sie zur Jüdin erklärt. Ob die Halacha es tat, wusste sie nicht». Internetrecherchen legen ihr nahe, schleunigst zu konvertieren: «Konvertieren zu einer Religion, die ihr eigentlich gehörte, der gegenüber sie sich Respektlosigkeiten, Freiheiten, vor allem Zweifel und Spott erlaubte und für die sie ohnehin schon diskriminiert wurde». Doch sie «wollte nirgendwo dazugehören, nicht zu den Tätern, nicht zu den Opfern, am liebsten wäre sie gar nichts.»
Dana Vowinckel, Gewässer im Ziplock (Suhrkamp-Verlag), Berlin 2023, 362 Seiten.
—

Christoph Gellner, Dr. theol., ist Experte für Literatur und (Welt-) Religion(en), Mitglied der Gesellschaft für die Erforschung der Deutschschweizer Literatur G.E.D.L. und arbeitet u.a. über Islamdiskurse in der Gegenwartsliteratur.