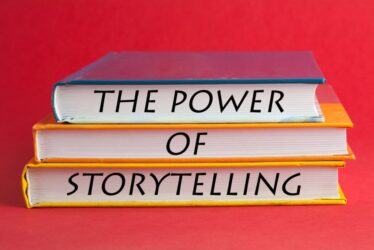Der Karfreitag ist nicht nur ein Teil der „Heiligen 3 Tage“ (Triduum Sacrum), er ist für evangelische Christ:innen ein zentraler Feiertag und identitätsstiftend. Zugleich hat er in Österreich 2019 seinen Status als Feiertag verloren. Die evangelische Theologin Cornelia Richter (Bonn) bringt biblische Hintergründe für die Theologie des Karfreitags – und den Hinweis, dass der Verlust des Karfreitags ein „Verrat an der Menschlichkeit Gottes“ und an der „Menschlichkeit des Menschen“ darstellt.
Es ist der Schrei, es ist dieser Schrei, der Menschen bis heute durch Mark und Bein geht: „Warum, warum hast du mich verlassen? Was habe ich getan? Wieso tust du mir das an?“ Es gibt ihn, diesen Schrei, bis heute, täglich: Auf den Schulhöfen, in den Familien, um die Ecke im Park, im Bahnhofsviertel, wo immer Menschen gemobbt werden, vergewaltigt, verlassen, geschlagen, getötet. Manchmal sind es einzelne, die zuschlagen. Manchmal ist es die Gang, die sich schweigend vor einem aufbaut. Und manchmal sind es die politischen Entscheidungen der einen, die die anderen in die Armut treiben, ins Lager stecken, auf offenem Meer ertrinken lassen, an Bäumen aufhängen, Kriege entfachen, während sie selbst den Cabernet Sauvignon bedächtig im Glas schwenken. Der Wein schwer, das Bouquet ledrig, die Farbe blutrot – man nennt es lieber „purpur“.
Ein Blick in die Passionserzählungen der Evangelien
Wie es wohl zugegangen sein mag, bei Jesu Kreuzigung? Wenn wir die Erzählung bei Markus und Matthäus lesen, dann haben wir im Ohr, wie schwer Pilatus die Entscheidung fällt, wir hören Folter, Spott und Hohn. Jesu Dornenkrone geht geradezu unter die eigene Haut: „O Haupt voll Blut und Wunden.“ Wir leiden mit ihm und wenn er am Ende mit Psalm 22 schreit, geht es uns durch und durch: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen!“.
Wenn wir die Erzählung bei Lukas lesen, dann schaudert es uns bei der Szene, in der Pilatus mit der Verurteilung zögert, Jesus freigeben will und das Volk drei Mal fragt, ob es wirklich Jesus am Kreuz sehen will? Jesus statt den Mörder Barabbas? Und wir hören, wie das Volk hetzt, immer lauter und lauter, wir hören, wie das Volk Jesu Tod fordert bis hin zu dem anderen Schrei: „Kreuzige ihn!“. Nirgends so eindrücklich vertont wie bei Johann Sebastian Bach.
Oder bei Johannes: Er erzählt von Jesu Todesstunde geradezu ruhig, gefasst. Jesus wird so gekreuzigt, wie es in der Schrift steht. Auch Johannes zitiert Psalm 22, aber nun einen anderen Vers: Die Soldaten zerteilen den Mantel nicht, auf dass die Schrift erfüllet würde. Das wissen zwar die Soldaten nicht, aber Johannes weiß es. Weil in der Schrift steht, was passieren wird, wenn der Messias von Menschen ans Kreuz geschlagen wird. Weil die Schrift darum weiß, dass sich das Heil Gottes dort zeigen wird, wo es niemand erwartet. Auch Pilatus hat geschrieben, was er geschrieben hat: „Der Juden König“ – und damit es wirklich alle lesen und verstehen können, schreibt er das auf Hebräisch, Latein und Griechisch. Alle sollen es wissen, dass dieser hier, der gegen Pilatus Einschätzung auf Wunsch des Volkes am Kreuz zu sterben hat, dass dieser hier der König der Juden ist. Pilatus meint das ernst. In den letzten Minuten wendet sich Jesus seiner Mutter zu und vertraut sie seinem Lieblingsjünger an. Und dann erfüllt er die Schrift ein letztes Mal: „Mich dürstet“. Er trinkt den Essig, sagt: „Es ist vollbracht“, neigt das Haupt und stirbt.
Nicht nur ein Ereignis aus der fernen Vergangenheit wird erzählt, sondern eine Menschheitsgeschichte.
Alle vier Evangelien erzählen von Jesu Tod, alle vier Evangelien setzen einen eigenen Akzent: Bei Markus und Matthäus fühlen wir mit dem Menschen Jesus seine Schmerzen, seinen Durst, sein Sterben. Bei Lukas weichen wir vor dem Hass des Volkes zurück, drücken uns an die Wand und sehen fassungslos zu, wie ihn das Volk ans Kreuz liefert. Bei Johannes folgen wir der Erzählung gefasst wie Trauernde, weil wir wissen, dass es so sein soll, dass dieser Mensch stirbt: Es geschieht alles, wie es in der Schrift steht. In allen vier Evangelien ist wichtig, was bei Markus und Matthäus gesagt wird: Jesus ist tot, der Vorhang des Tempels zerrissen, der Blick auf das Allerheiligste ist frei. Das heißt: Der Blick auf Gott selbst ist frei. Auf Gott selbst, der nirgends anders ist als bei diesem gefolterten, geschundenen und sterbenden Menschen. Auf seinem Antlitz zeigt sich Gott selbst.
Und wir? Wir stehen drum herum, wir hören die Erzählungen, wir sind selbst in der Dramatik der Ereignisse gefangen und ahnen, dass uns in diesen Evangelien nicht nur ein Ereignis aus der fernen Vergangenheit erzählt wird. Sondern eine Menschheitsgeschichte. Eine Geschichte, die immer wieder, zu allen Zeiten dort passiert, wo Menschen zu Tode gehetzt und verurteilt werden, Schmerz und Folter leiden, wo sie vor unseren Augen sterben. Denn das, was damals in Jerusalem geschehen ist, ist ein für allemal geschehen. Für uns und alle Welt.
Was passiert, wenn wir diese Erzählungen aus unserem Repertoire streichen?
Was passiert, wenn wir diese Erzählungen aus unserem Repertoire streichen? Was passiert, wenn der Karfreitag nicht mehr selbstverständlich zu unserem Leben gehört? Dann wissen wir vielleicht nicht mehr, auf wen wir schauen sollen, wenn es uns trifft. Dann haben wir in unserer Angst und unserem Schmerz, in unserem Leiden und Sterben kein Antlitz an unserer Seite, auf dem sich Gottes Nähe spiegelt. Den Karfreitag zu streichen, das ist Verrat an der Menschlichkeit Gottes.
Was passiert, wenn Menschen diese Erzählungen nicht mehr hören, weil sie am Karfreitag ihrem Geschäft nachgehen? Weil ihnen diese Erzählungen unbequem sind? Dann haben wir vielleicht nicht mehr im Ohr, wie schnell ein Volk einen Menschen in den Tod hetzt. Dann übersehen wir, dass diejenigen, die im Namen des Volkes zu sprechen meinen, eigentlich nur für sich selbst sprechen. Sie vergessen, dass es im Volk noch andere gibt. Die, die den Karfreitag am eigenen Leib erleben. Wie schnell doch eine Gruppe zur unerwünschten Minderheit werden kann. Den Karfreitag zu streichen, das ist Verrat an der Menschlichkeit der Menschen.
Was passiert, wenn Menschen nicht mehr hören und erwarten, was geschrieben steht? Wenn sie keine Orientierung mehr haben an ihrer Tradition? Wenn sie nicht mehr wissen, woher ihnen Hoffnung kommt? Dann steht ihnen vielleicht niemand mehr vor Augen, der im Vertrauen auf Gottes Beistand Angst und Verzweiflung, Schmerz und Leid, Sterben und Trauer erträgt. Dann wissen sie vielleicht von niemandem zu erzählen, der sogar in der tiefsten Tiefe menschlichen Lebens Gott anruft als den, der Rettung verheißen und zugesagt hat. Rettung ein- für allemal, für uns und alle Menschen. Den Karfreitag zu streichen, ist Verrat an der Hoffnung.
Der Karfreitag ist so wichtig, weil er die innerste Wahrheit des christlichen Glaubens symbolisiert: Dass Gott mit uns ist im Leben wie im Tod.
Der Karfreitag ist für uns nicht deshalb so wichtig, weil wir als Evangelische Christinnen und Christen so gerne auf den Gekreuzigten schauen. Weil wir nichts anderes zu sagen und zu glauben hätten als das Kreuz Jesu. Nein, der Karfreitag ist für uns alle so wichtig, weil wir durch den Gekreuzigten hindurch auf das leere Kreuz schauen. Weil wir auf ein Kreuz schauen, an dem das Leid überwunden wird. Auf das Kreuz, das aus den Trümmern ragt und das zerstörte Leben überstrahlt. Auf das Kreuz, das das zerstörte Leben in sein Licht taucht. Auf das Kreuz, das das zerstörte Leben auf dieses Licht hin tröstet und neu werden lässt. Der Karfreitag ist so wichtig, weil er die innerste Wahrheit des christlichen Glaubens symbolisiert: Dass Gott mit uns ist im Leben wie im Tod. Weil wir durch den Tod hindurch neues Leben sehen werden.
—

Cornelia Richter, Dr. theol., ist seit 2012 Professorin für Systematische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn und Co-Direktorin des Bonner Instituts für Hermeneutik. Seit 2016 ist sie ehrenamtlich in der Evang. Pfarrgemeinde Bad Goisern (AUT) engagiert und seit 2024 Universitätspredigerin an der Bonner Schlosskirche.
Beitragsbild:Patriarchal Basilica of Aquileia. Crypt of the frescoes 12th century. The crucifixion (Shutterstock)