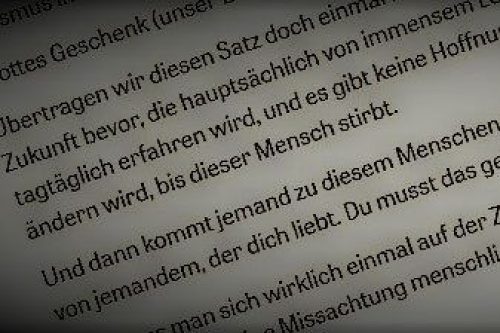Kirchen nutzen das Netz immer noch zu sehr im Modus der ‚alten‘ Printmedien. Doch das Netz verändert die Art und Weise, wie wir einander begegnen. Kristin Merle auf theologischer Entdeckungstour im alten Neuland Internet.
„[W]ie ein unentdecktes Land liegt z.T. die Religion unseres eigenen Volkes vor unseren Augen“[1], schreibt der protestantische Theologe Paul Drews in seinem programmatischen Aufsatz „‚Religiöse Volkskunde‘, eine Aufgabe der praktischen Theologie“ im Jahr 1901. Drews spricht sich für eine empirisch fundierte „Kenntnis des des gegenwärtigen religiösen Lebens“ aus: Theologie und Kirche sollen sich stärker mit den lebensweltlichen Realitäten der Menschen konfrontieren und sich mit diesen in Beziehung setzen. Es ist ein auf Dauer gestelltes Desiderat. Seine prinzipielle Aktualität verdankt es dem steten Gestaltwandel des Religiösen. Seine besondere Aktualität wird mit Blick auf die Artikulationen des Religiösen im Netz beispielhaft anschaulich. Gemeint ist damit nicht nur die Wahrnehmung und Reflexion von Phänomenen in wissenschaftlichem Interesse, sondern auch die Anerkennung des Netzes als diskursiver gesellschaftlicher ‚Raum‘, die Berücksichtigung von User-Kommunikationen und Themenentwicklungen als Bestandteil einer informierten ‚öffentlichen Theologie‘ der Kirchen.
Neue Öffentlichkeiten für Religion
Was Menschen umtreibt, liegt offen wie nie vor uns. Schien die Transformation der Religion bzw. des Religiösen in den letzten Jahrzehnten plausibel mit Stichworten wie Deinstitutionalisierung, Ausdifferenzierung, Individualisierung und Privatisierung beschrieben zu sein, unterliegen Religion bzw. Religiosität im Zusammenhang der neuen Medien einer neuen und folgenreichen Form der Entprivatisierung: Öffentlich werden Privates und Persönliches im Netz von Vielen nach gusto geteilt, Weltanschauungen diskutiert, Themen religiös traktiert. Effekte der Synkretisierung verstärken sich durch die translokale, interkulturelle u.a. Interaktion von Akteuren und Akteurinnen online. Die Digitalisierung potenziert also die Transformation des Religiösen.
Hubert Knoblauch spricht von einer „neuen Form der Religion“[2], deren zentrale Merkmale in Spiritualisierung und Popularisierung bestehen; für sie ist nicht mehr klar zwischen ‚sakral‘ und ‚profan‘, zwischen ‚transzendent‘ und ‚immanent‘ zu unterscheiden. Gütekriterium des Religiösen ist mehr und mehr die „‚Authentizität‘ der Erfahrung“[3]. Formen ‚populärer‘ Religion zeigen sich eigenständig neben religiösen Organisationsformen wie den Kirchen, sie amalgamieren jedoch auch mit der ‚organisierten‘ Religion.
Mit der Digitalisierung von Kommunikation entstehen komplexe Formen von Öffentlichkeit, die sich am ehesten anhand der Netzwerk-Metapher beschreiben lassen. Sie macht deutlich, dass kommunikative Anschlüsse verschiedener Akteure auf verschiedenen Ebenen öffentlichen Handelns möglich sind. Quellen und Publikum können über internetmediale Kommunikation direkt – ohne journalistische Vermittlung – interagieren, das vormals disperse Publikum wird in die Lage versetzt, sich zu vernetzen. ‚Das‘ Internet wertet faktisch die ‚Laienkommunikation‘ auf, indem es kleine und große Öffentlichkeiten integriert.
Das Netz wertet die ‚Laienkommunikation‘ auf.
Gerne wird darauf hingewiesen, die Kirchen hätten mit Blick auf die Gesellschaft intermediäre Funktion.[4] Institutionen- und organisationstheoretisch ist das plausibel. Darüber sollte aber nicht vergessen werden, dass es im Wesentlichen ‚die‘ Öffentlichkeit ist, die als Intermediär wirkt. Sie kann freilich, zum Beispiel als politische Öffentlichkeit, institutionalisiert sein. Sie entsteht aber auch flüchtig dort, „wo immer Menschen handelnd und sprechend miteinander umgehen.“[5] Dass sich nun eine Vielzahl der Kommunikationen, die internetmedial stattfinden, unter dem Signum der Flüchtigkeit ereignen, macht es nicht leichter, entsprechende Figurationen als Erscheinungsform des Religiösen zu identifizieren. Um genau eine solche Kenntnis des Religiösen wird es aber zukünftig mehr gehen müssen, um diskursive Anschlussstellen gestalten zu können, auch in kirchlichem Interesse.
Flüchtige Teilöffentlichkeiten dienen als Foren der Selbst- und Weltdeutung.
‚Öffentliche Theologie‘ gründet auf dem Selbstverständnis, dass die jüdisch-christliche Tradition einen wesentlichen Beitrag im Diskurs der Gesellschaft über deren Aufgaben, Ziele und Identitäten[6] leisten kann und soll. Das Interesse, „sich mit inhaltlichen und wertnormativen Positionen und Haltungen in den öffentlichen Diskurs einzubringen“[7], überhaupt im eigenen Handeln auf Öffentlichkeit ausgerichtet zu sein, speist sich in theologischer Sicht aus der Tradition prophetischer Rede (als Parteinahme für die Armen und Unterdrückten), dem öffentlichen Wirken Jesu und seiner Jünger und der eschatologischen Perspektive einer geglaubten und für alle Menschen gültigen Heils- und Befreiungszusage. Die im deutschsprachigen Diskurs oft aufgerufene Definition ‚öffentlicher Theologie‘ von Wolfgang Vögele verweist schließlich auf „die orientierend-dialogische Partizipation an öffentlichen Debatten, die unter Bürgerinnen und Bürgern […] geführt werden.“[8]
Bürger und Bürgerinnen debattieren auch im Netz über Aufgaben, Ziele und Identitäten der Gesellschaft. Die oft durch passagere Kommunikation entstehenden Teilöffentlichkeiten dienen den Einzelnen als Foren der Selbst- und Weltdeutung. Im gelingenden religiös-kommunikativen Fall vollzieht sich eine performative Anverwandlung von Weltpositionen durch Partizipation an gegenseitigen Resonanzbeziehungen – all das unter Umständen unter dem Vorzeichen der Reversibilität, aber eben nicht: bedeutungslos. Wer wissen will, was Menschen beschäftigt, kann im Netz nachlesen.
Kirchliche Stellungnahmen an den Debatten der BürgerInnen vorbei?
So konnte man im Zusammenhang der Debatte um die gesetzliche Neuregelung der Sterbehilfe bei einem Blick auf Nutzerkommentare zu Beiträgen überregionaler Zeitungen feststellen, dass das dominierende Thema für die Nutzer und Nutzerinnen die Frage der Selbstbestimmung war.[9] 50% aller Kommentare äußerten sich zu der virulenten Frage, wie nun auch am Ende des Lebens mit der Verantwortung umgegangen sein will, die dem modernen Menschen bereits für den Rest seines Lebens in der funktional differenzierten Gesellschaft überantwortet worden ist: Dass die Entscheidung für alle möglichen Belange nämlich bei ihm liegt. Kaum ist jedoch zu beobachten, dass die Kirchen in ihren öffentlichen Stellungnahmen das Thema der Selbstbestimmung konstruktiv aufgegriffen hätten.
Einig war man sich darin, dass der Mensch nicht aufgrund einer ‚falsch verstandenen Autonomie‘ über sein Leben verfügen dürfe.[10] Entsprechend begrüßten die Katholische und die Evangelische Kirche in Deutschland die Entscheidung des Bundestages zur Strafverfolgung einer geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung in einer gemeinsamen Erklärung: „Das ist eine Entscheidung für das Leben und für ein Sterben in Würde.“[11] Verstörend ist freilich nicht die Stellungnahme zum Thema, sondern das öffentliche Nicht-Eingehen auf eine offensichtlich für viele Menschen brennende Frage. Ein solcher Umgang mutet paternalistisch an – und er entspricht auch nicht dem eigenen Selbstverständnis einer ‚öffentlichen Theologie‘, die eine „orientierend-dialogische Partizipation an öffentlichen Debatten, die unter Bürgerinnen und Bürgern […] geführt werden“ vor Augen hat.
Das Netz: Resonanzfähige Öffentlichkeiten, die es weiter zu entdecken gilt.
Die Netzwerköffentlichkeit fordert gewissermaßen eine Änderung der öffentlichen Debattenkultur ein – und sie bietet vielfältige Anschlussmöglichkeiten über eine aktive Gestaltung der public relations. Die Nutzer und Nutzerinnen selbst sind, nicht nur online, vermehrt auf partizipative, interaktive und netzartige Kommunikation ausgerichtet. Dass die Zivilgesellschaft, so Jürgen Habermas, auf das Vorhandensein von resonanzfähigen Öffentlichkeiten angewiesen ist[12], kann auch für die Kirchen eine Ermunterung sein, sich einerseits mit ihren – fraglos vorhandenen – Resonanzpotenzialen an der Aushandlung zeitgenössischer Fragen diskursiv zu beteiligen. Andererseits entspräche es auch ihrem Verständnis als Großkirchen, wenn sie selbst Räume öffentlicher Deliberation eröffneten und stärkten. Online monitoring, also „organisationales Zuhören“ (Thomas Pleil) im Netz, erscheint dabei als hilfreiches Medium für ein Einüben in Kontextsensibilität wie für die Informiertheit einer an Partizipation und Dialog interessierten Kommunikation. Papst Franziskus hat vor einigen Jahren das Netz als „dono di Dio“ bezeichnet. Es wäre doch ein Jammer, wenn diese Potenzialität – als Modus einer Kultur der Begegnung (nicht des schlichten Publizierens!) – kirchlich wie theologisch nicht stärker aufgegriffen würde. Es gibt noch viel zu entdecken.
[1] Drews, Paul, „Religiöse Volkskunde“, eine Aufgabe der praktischen Theologie, in: Monatsschrift für die kirchliche Praxis 1 (1901), 1-8: 4.
[2] Knoblauch, Hubert, Populäre Religion. Auf dem Weg in eine spirituelle Gesellschaft, Frankfurt a.M. 2009, 11.
[3] A.a.O., 271.
[4] Vgl. etwa Huber, Wolfgang, Kirche in der Zeitenwende. Gesellschaftlicher Wandel und Erneuerung der Kirche, Gütersloh 1998, 267ff; vgl. im Zusammenhang seiner Ausführungen zur liquid church auch: Gabriel , Karl, Liquid Church? Organisationssoziologische Anmerkungen, in: Pastoraltheologische Informationen 34 (2014), online verfügbar unter: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6:3-pthi-2014-13200.
[5] Arendt, Hannah, Vita activa oder Vom tätigen Leben, München 92010, 251. Der Begriff des Handelns ist bei Arendt wesentlich auf den öffentlichen, nicht auf den privaten Raum bezogen.
[6] Vgl. Vögele, Wolfgang, Zivilreligion in der Bundesrepublik Deutschland, Gütersloh 1994, 421f.
[7] Könemann, Judith, Theologie, Kirche und Öffentlichkeit. Zum Öffentlichkeitscharakter von Religionspädagogik und religiöser Bildung, in: Dies./Wendel, Saskia (Hg.), Religion – Öffentlichkeit – Moderne. Transdisziplinäre Perspektiven, Bielefeld 2016, 129–152: 130.
[8] Vögele, Wolfgang, Zivilreligion in der Bundesrepublik Deutschland, Gütersloh 1994, 421f.
[9] Analysiert worden sind etwa 600 Nutzerkommentare zu Beiträgen überregionaler Zeitungen, die anlässlich der Debatte um die gesetzliche Neuregelung der Sterbehilfe in Deutschland in den Jahren 2014 und 2015 entstanden. Zusätzlich wurden zahlreiche Blogeinträge untersucht. Die Ergebnisse der Studie, die im Rahmen eines praktisch-theologischen Habilitationsprojekts an der Universität Tübingen durchgeführt worden ist, sind noch unpubliziert. Rückfragen dazu können gerne an die Autorin des Beitrags gerichtet werden.
[10] Vgl. hierzu etwa das Interview mit Kardinal Reinhard Marx in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 05.09.2014, online unter: http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/im-interview-spricht-kardinalmarx-ueber-die-sterbehilfe-13135655.html
[11] https://www.ekd.de/presse/pm208_2015_erklaerung_sterben_in_wuerde.html
[12] Vgl. Habermas, Jürgen, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt a.M. 52014, 400.
_______________
Kristin Merle ist Privatdozentin für Praktische Theologie an der Universität Tübingen. Aktuell übernimmt sie eine Vertretungsprofessur an der Universität Hamburg.
Bild: Screenshot, Kristin Merle.