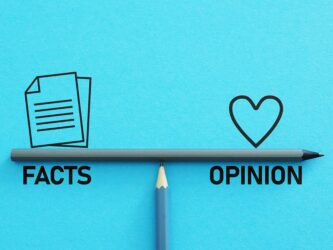Jedes Bistum, das etwas auf sich hält, „macht“ in Kirchenentwicklung. Aber wer entwickelt hier eigentlich was, wozu und für wen? Oder wird hier abgewickelt? Von Juliane Schlaud-Wolf und Christof May
In der Leitung des Ressorts Kirchenentwicklung im Bistum Limburg sind wir als Doppelspitze unterwegs. Diese innovative Leitungsform zwingt uns zu intensiver Auseinandersetzung, wenn es um Entscheidungen, konzeptionelle Auseinandersetzungen und Zukunftsfragen geht. Gerne wollen wir Einblick gewähren. Uns beschäftigt die Frage, was Kirchenentwicklung ausmacht. Sie ist als Basisprozess von Bischof Georg Bätzing ausgerollt. Jedoch rollt dieser Prozess oft noch in alten Gewohnheiten und Bahnen. Wie kommt das Neue in die Kirche?
Wenn wir von Kirchenentwicklung reden, stellen wir nicht die Frage: „Was wird aus uns?“. Vielmehr geht es um den Auftrag, als Kirche Jesus Christus sichtbar zu machen. Damit „landen“ wir zurzeit nicht wirklich. Somit braucht es Entwicklung. Aber in welche Richtung? Um als Kirche Jesu Christi heute für andere da zu sein, bedarf es einer Entwicklung in zweifacher Weise: Es geht zum einen um ein „Auswickeln“: in der kenotischen Perspektive zum Kern vorstoßen, Jesus Christus „freilegen“ und sich damit der eigenen Mitte vergewissern, die Kirche evangelisieren und mit der Botschaft bei uns selbst ernst machen. Auf der anderen Seite braucht es wirklich Neues: Es geht um ein Ermöglichen von Neuem. Das ist, theologisch gesprochen, die inkarnatorische Perspektive. Während bei der kenotischen Perspektive ein passives „sich entwickeln lassen“ fokussiert wird, geht es bei der inkarnatorischen Perspektive um ein aktives Entwickeln.
Auswickeln und Entwickeln.
Simone Weil ist für uns die Patronin unruhiger Schwellenerfahrung. Der Kirche geht es wie allen Systemen: In Stresszeiten werden alte Muster stark, man konzentriert sich auf das Gewohnte und reproduziert erprobte Wege, gelegentlich anders akzentuiert, aber letztendlich im „alten Trott“. Das ist normal, aber nicht besonders förderlich oder gar zukunftsweisend. Die französische Philosophin Simone Weil, die zeitlebens auf der Schwelle zur Kirche lebte und sich nicht zum Eintritt entschließen konnte, sieht zurecht in großen Institutionen die Gefahr einer „Verflachung“ der Ideen. In Organisationen erkennt Simone Weil das „große Tier“, das das autonome Denken des/r Einzelnen unterdrückt.1 Intellektuell versucht sie während ihres gesamten Lebens, immer mehr dieser Verflachung entgegenzugehen, um schließlich bis zum Grund ihres Daseins vorzudringen. Daran ist die „décréation“, die Entwicklung, die sie durch ihr eigenes Leben bezeugt, notwendig gebunden.
Das Begehren der Wahrheitserkenntnis lässt Simone Weil aufbrechen, um die selbstkonstruierten Wahrheitsansätze hinter sich zu lassen und in der Schönheit, der Tugend und dem Guten das Wahre zu finden. Das Leben ist für Weil an die „intellektuelle Redlichkeit“ rückgebunden, die sich durch die Indifferenz gegenüber allen Ideen auszeichnet. Diese Indifferenz hat jedoch eine eigene Lebensdynamik zur Folge. Der Mensch muss seine Ideen ständig neu in Frage stellen lassen, er kann sich nie in einer gedanklichen Sicherheit wiegen. Immer wieder muss er seine Denkkonstrukte dynamisieren und damit geistig aufbrechen, um tiefer in die letzten Wahrheiten vorzudringen.
Selbstkonstruierte Wahrheitsansätze hinter sich zu lassen!
Das, was heute unter „new work“ und agilem Organisationsmanagement labelt, zeigt solche Dynamisierungsprozesse: Veränderte Rahmenbedingungen wirken der Verflachung von Ideen, Langsamkeit, Unbeweglichkeit und Gesetztheit entgegen. Stattdessen eröffnen sie Raum für schnelle Entscheidungen, fluide Prozesse, flache Hierarchien. Die existentielle Frage nach dem Wozu, dem Purpose des eigenen Tuns und eine ergebnisorientierte Haltung des Ermöglichens und Beteiligens rücken ins Zentrum. Für Simone Weil ist es die unruhige Existenz an der Schwelle, an der Grenze, die Energie für Veränderung produziert. Solche Schwellenräume zu eröffnen und zu schützen, sehen wir als unseren Auftrag im Ressort für Kirchenentwicklung. Mit unserer Arbeit sind wir unruhig und wollen unruhig machen.
Dieses Unruhig-Kreative zeigt sich in neuen Ideen. Auf dem Weg zu sinnhaften Neuerungen braucht es den Mut zum Experiment. Neues wächst, wenn man Gelegenheiten für Zufälle schafft und Kompetenzen stärkt, diesen Zufällen nachzugehen, ihnen zu vertrauen. Dafür braucht es Schutzräume jenseits operativer Alltäglichkeiten.
Unruhige Existenz an der Schwelle.
Konkret: Ein solches Experiment verbirgt sich hinter den sogenannten dynamischen Stellen in unserem Bistum. Für fünf Jahren ermöglichen wir an verschiedenen Orten 100% Freiraum für Innovation. Dynamische Stellen brauchen eine Idee und motivierte Entdecker*innen. Sie bieten einen Raum, der nicht in Regeln und Strukturen gegossen ist, aber strukturell interessant werden kann. In Zeiten, in denen zentrale Pläne für die Zukunft missglücken, braucht es geschützte Räume für das bewusste Nutzen von Zufällen.
Wo kommen sie her die Zufälle, die Neuerungen, die Innovationen? Wir sind dabei, unseren Blick so zu verändern, dass wir innovationsfreudige Mitarbeitende aufspüren und miteinander vernetzen. Aus der Erkenntnis, dass Innovationen in den seltensten Fällen alleine am heimischen Schreibtisch entstehen, legen wir gemeinsam mit anderen Bistümern und dem Theologisch-Pastoralen Institut Mainz einen Pionier*innenkurs auf. Ziel ist es, bistums- und professionsübergreifend einen Inspirations- und Resonanzraum zu schaffen. In der Logik der Selbstwirksamkeit inspiriert dieser den Mut zum Denken und zum Handeln.
Konkret: In unseren Arbeitsprozessen „schmoren wir oft im eigenen Saft“, ein Mehr an Zeit macht die Arbeit nicht besser. Von agil agierenden Unternehmen lernen wir, durch das Begrenzen von Zeitressourcen effektiver zu arbeiten. Durch Kollaborationen in Co-working-spaces und Fokus-Räumen erhöht sich die Qualität: Gedanken und Produkte werden cokreativ entwickelt – und zwar über Ressort- und Hierarchiegrenzen hinweg. Durch solche Musterbrüche entsteht Neues. Diese Erfahrungen dürfen wir machen, weil andere Organisationen uns die Türen geöffnet haben.
Zeitressourcen begrenzen, um effektiver zu arbeiten.
Kirchenentwicklung muss exzentrisch sein. „Mehr als Du siehst“ lautet das Motto der Kirchentwicklung im Bistum Limburg. Mit der Aufforderung, über die Schwelle zu schauen, fordert es zur „décréation“ heraus. Die Kirche bildet keine Sonderwelt in der Postmoderne, Gläubige leben bereits in ihr – zugleich gilt es, immer mehr „exzentrisch“ zu sein und den gelebten Glauben auf das Spielfeld der Welt zu setzen und „mitzuspielen“; das ist mehr als Türen und Fenster öffnen und nach draußen schauen. Kirche ist in der Wahrnehmung vieler, auch der Mitglieder und Mitarbeitenden, schon lange nicht mehr die normgebende Instanz. Die spätmoderne Gesellschaft ist von Singularitäten geprägt;2 authentische Subjekte inszenieren und kuratieren ihre Lebensentwürfe in einzigartigen Räumen und geprägten Zeiten. Diese sind maßgebend und lösen das Allgemeine, Standardisierte ab, das in der Kultur der Pfarrgemeinden vielerorts überwiegt.3
In dieser spätmodernen Gesellschaft, deren Gesetzmäßigkeiten in Corona-Zeiten wie im Brennglas erscheinen, wollen wir da sein. Als Kirche anklopfen, uns einladen, formulieren können, was unser „purpose“ ist, und mit dieser Haltung „mitspielen“, offen für das, was dran ist und kommt. So klopfen wir gerade bei Unternehmen, Mitarbeitenden und Führungskräften an, um zu hören, was sie umtreibt. Und wir erleben, wie es plötzlich ernst wird mit der Grundhaltung „Für wen sind wir da?“. Wenn es um das Freisetzen von Mitarbeitenden geht, wenn Unternehmen, Filialen geschlossen und Ideen begraben werden müssen, für die man brennt. Wenn Lebensentwürfe von heute auf Morgen auf den Kopf gestellt werden, wenn Unsicherheit vorherrscht und Verletzlichkeit hautnah spürbar ist.
In diesem Tun machen wir die Erfahrungen, wie die Menschen aus Unternehmen, Kulturschaffende, Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und dem Bildungsbereich uns als Kirche entwickeln. Dafür sind wir sehr dankbar. In der Haltung der Lernenden versuchen wir, diese Spur aufzunehmen und Kraft der Erdung und Irritation nachzugehen, sie strukturell zu ermöglichen, damit Neues entsteht.
Für wen sind wir da?
Eine Kirche, die sich entwickelt, indem sie sich selbst aussetzt, schafft es auch, sich immer wieder kritisch von außen betrachten zu lassen. „In der Peripherie liegt ein beachtliches epistemologisches Potential, denn dort ist die Sicht der Dinge notgedrungen ganz anders als von der Mitte aus.“4 Die Mitte, das kenotisch „entwickelte“ Innere unseres Kirchenseins: Jesus Christus im Sakrament, im Wort und in der Begegnung macht diese Perspektive möglich und befreit zur inkarnatorischen Entwicklung. Weil bei der Kirchenentwicklung Jesus Christus der Herr ist, lassen wir uns von ihm leiten, indem wir den Menschen um des Menschen willen ins Zentrum stellen.
Weil es um Gott geht, kann Kirchenentwicklung mit der „exzentrischen Positionalität“5 ernst machen. Diese „Exzentrik“, das Entfernen von der eigenen gewohnten Mitte, wird zu Erfahrungen des Exils führen: Wer sich in das Exil begibt oder dahin gezwungen wird, weiß um seine unverbrüchliche Verbindung zur anderen Seite – zur Innenseite kirchlichen Lebens und Tuns und er/sie weiß darum, dass Aufbruch notwendig ist. Im letzten drückt sich darin der Sinn von Religion – die Rückgebundenheit – aus.
Die exzentrische Position im Exil.
So kann „exzentrische“ Kirchenentwicklung verstanden werden: in der Vergewisserung der eigenen Mitte in aller Demut und Offenheit dieses Zentrum verlassen. Weil es um Gott geht, stellen wir den Menschen ins Zentrum und lassen uns von ihm in unserem Tun leiten.
___
Text: Juliane Schlaud-Wolf, Bischöfliche Beauftragte für Kirchenentwicklung und Dr. Christof May, Bischofsvikar für Kirchenentwicklung im Bistum Limburg.
Bilder: Birgit Hoyer; Bistum Limburg.
- „Es ist ein Grundmotiv der Reflexion von Simone Weil, dass der einzelne Mensch, und nur er, das eine und einzig mögliche Subjekt des Denkens ist. Kollektivitäten, ob groß oder klein und welcher Art auch immer, Parteien, Nationen, Kirchen, denken nicht. Die von mir gedachte Zwei kann sich nicht mit der von dir gedachten Zwei zu einer Vier summieren.“ Moulakis, A.: Simone Weil und das „Große Tier“, in: Schlette, H.-R. / Devaux, A. (Hg.): Simone Weil: Philosophie – Religion – Politik. Frankfurt 1985, 254. ↩
- Vgl. Andreas Reckwitz, Die Gesellschaft der Singularitäten, Berlin, 2017. ↩
- Vgl. ebd. 7f. ↩
- Wilfried, F. / Beozzo, J. O.: Die Kunst der Grenzverhandlung. In: Conc 35 (1999), 141-147, 142. ↩
- Vgl. Plessner, H.: Philosophische Anthropologie. Frankfurt 1970, 41ff. ↩