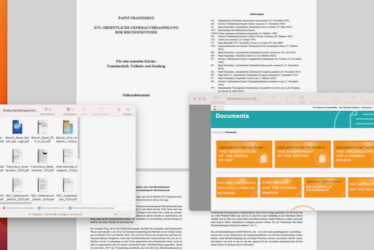Martin Stewen macht sich Gedanken darüber, wie wir mit Krisen – auch in der Kirche – umgehen und dabei nicht die Freude verlieren.
Ein Perspektivenwechsel hilft
Am zweiten Sonntag der diesjährigen Fastenzeit erzählte das Evangelium die Geschichte von der Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor. Ich habe in meiner Predigt darauf hingewiesen, dass Berg-Geschichten immer auch davon erzählen, wie Menschen zu neuen Einsichten finden können, wenn sie mal den Standort wechseln. Die Höhe eines Gipfels kann so ein Ort sein. – Die Schar der Mitfeiernden in diesem Gottesdienst war klein: Es war die eh nicht an Köpfen reiche deutschsprachige Gemeinde ‚Guter Hirte‘ in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur. Der zuständige Kollege sollte erst zwei Wochen später aus Singapur einfliegen – aber da ich am Ort der Pfarrei zu Gast war, habe ich eine Eucharistiefeier angeboten, und so fand diese kleine Feier ausserhalb der normalen Gottesdienstordnung statt.
Für mich sind solche Momente auf Reisen immer wieder Höhepunkte: Mitten in der Fremde kommen Menschen aus meiner Heimat zusammen, um in der gemeinsamen Muttersprache Glauben und Leben miteinander zu feiern.
Abstand auch zur Heimatkirche
Im Anschluss an diesen Gottesdienst wurde ausgiebig gebruncht. Und diskutiert. Und ich stellte einmal mehr fest: Nicht nur Berggipfel können neuen Einsichten dienen, auch zehntausend Flugkilometer Entfernung zur Heimat haben durchaus einen ähnlichen Effekt. Der grosse Abstand auch zur Heimatkirche liess im Gespräch Vieles in einem veränderten Licht erscheinen. Die deutschsprachige Kirche in Europa wird hier in der Fremde nicht zuerst als die Kirche im Missbrauchsskandal gesehen, sondern vor allem als eine Kirche in einer grundsätzlichen Krise, die auch in der kleinen deutschsprachigen Gemeinde Kuala Lumpurs spürbar ist.
Was ist denn das Problem?
Was aber läuft denn eigentlich schief in dieser Kirche? Krisen sind ja nicht unbedingt was Schlimmes. – Der Begriff “Krise” meint einen Wendepunkt und wohin eine Situation dann kippt, ist noch lange nicht klar: Es kann deutlich besser oder eben auch deutlich schlechter werden. Eine Krise kann durchaus eine Chance sein, die aber ungenutzt schliesslich zum Drama führt. Wird dieser Augenblick aber genutzt, ist es wie an Ostern: Das Fest der Auferstehung gibt es ohne das Dilemma des Karfreitags nicht.
Ungleichzeitigkeit von Krisen
Nun ist da aber auch diese Ungleichzeitigkeit von Krisen. Die persönliche Krisenwahrnehmung steht nur allzu oft der Perspektive einer Allgemeinheit diametral entgegen oder lässt sich zumindest oft schwer mit ihr vereinbaren. Wenn ich gerade von guten oder schlechten Entwicklungen intensiv persönlich betroffen bin, wenn ich gerade tief im Glück oder Unglück lebe, dann ist mir egal, wie andere die aktuelle Weltlage einschätzen. Mein Empfinden hat höchste Priorität und alle anderen noch so klugen Analysen zu aktuellen Situationen werden an mir wie an Teflon abperlen. Und andersherum wird meine Erfahrung noch lange nicht zur Erfahrung aller. Zwischen jenen, denen es besser geht, und jenen, die weniger Glück haben, lassen sich wohl aber Brücken bauen: Auf der Handlungsebene heisst eine dieser Brücken etwa Solidarität, auf der Gefühlsebene ist Empathie eine andere. Immer aber ist klar: Das Unglück der/des Anderen bleibt seines/ihres und wird nicht zu meinem. Alle Solidarität und alles Mitgefühl macht mich nicht zum Teilhaber einer (scheinbar) ausweglosen Situation des/der Anderen.
Soweit die Theorie.
Es geht schon schief – einfach fest dran glauben
Gerade wird immer deutlicher spürbar: Die in der Kirche angesagte Universalkrise soll nun ein Problem aller in der Kirche sein. Und allein mit dieser Ansage wird sie schliesslich zu einer self-fulfilling prophecy (Robert Merton, 1948), zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, wenn sie nur in entsprechender Weise beständig kommuniziert wird. In deren Folge ziehen sich Menschen in der Kirche dann Schuhe an, die nicht für sie bestimmt sind und die ihnen auch nicht passen: Alle leiden und viele werden zu von Krisen Betroffenen ohne jegliche Krisenerfahrung.
Missbrauch – eine Krise von desaströsem Ausmass
Natürlich: Der geistliche und sexuelle Missbrauch Tausender Menschen in der katholischen Kirche ist eine Krise von desaströsem Ausmass. Wie vielerorts Verantwortliche dieser Kirche mit Menschen der LGBTQI-Community umgehen, ist ein Skandal. Die Rolle der Frauen in der Kirche ist immer noch völlig unzureichend geklärt. – Viele andere Themen lassen sich hinzufügen.
Als Mann aber, nicht missbraucht, sind viele dieser Themen zunächst nicht meine Themen. Es wäre unehrlich, täte ich so, als wäre das anders. Eine Universalkrise der Kirche, von der alle betroffen sind, gibt es nicht. Und so habe ich dann die grosse Chance, meine Kräfte, die ich habe, weil es mir gut geht, in Mitgefühl und Solidarität für Andere einzusetzen. Das geht aber nur, wenn ich mir ein generalisiertes Leiden an der Kirche nicht einreden lasse und mich nicht meiner Kräfte berauben lasse.
Nicht nur beim Chile-Kafi: Kirche geniessen
Szenewechsel: Dekanatsversammlung in Zürich, vor ein paar Tagen. Im Bistum hat die Leitung einen Prozess des Wandels angestossen und wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden heute eingeladen, sich in diesen Prozess einzumischen. In Gruppen wird diskutiert, was dafür Schlagworte sein könnten.
Genussvolles
Sagt ein Kollege: Wir sollten Kirche mal wieder so richtig genussvoll leben. Bei mir als Hobbykoch klickt es. Ja richtig, an so vielen Stellen in den Vollzügen unserer Glaubensgemeinschaft begegnet uns doch Genussvolles: Wir feiern die Mitte unseres Glaubens mit Brot und Wein, wir verwenden in vielen Sakramenten wohlriechende Öle, wir feiern Gottesdienste mit Weihrauch – liturgisch haben wir die Sache mit dem Genuss ja raus. Aber ausserhalb des Gottesdienstes? Eine aktive Kirche mit lebendigen Vollzügen im Sinne des Evangeliums, die schmecken und Lust auf mehr machen. Eine solche Kirche ist ein Ort, wo auch Opfer von Krisen Heilung erleben können. Von einer Kirche im Zustand einer allgemeinen Depression nimmt man schon allein aus Gründen des Selbstschutzes lieber Abstand.
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne (Hesse)
Noch einmal zurück nach Kuala Lumpur. Der Brunch nach dem Gottesdienst hat gut zwei Stunden gedauert. Geschmeckt hat hier aber nicht nur das gute Essen, das da im Café des Nationalen Ökumenischen Zentrums aufgefahren wurde. Der Zustand der kleinen Gemeinde wurde durchaus kritisch gesehen, aber das, was da in dieser Gemeinschaft passiert, hat für die Menschen einen grossen Wert, so dass sie sich mit den bescheidenen Mitteln, die vorhanden sind, für ihre Kirche einsetzen und so diese Gemeinde erhalten. Das kirchliche Leben ist für sie ein kostbares Gut, das sie geniessen und das durch viele Schwierigkeiten ausserhalb der Kirche trägt, auch wenn es selbst nicht krisenfrei ist. Von depressiver Verstimmung war nichts zu spüren, auch wenn es einige Gründe dafür gegeben hätte.
Ich habe aus diesen zwei Stunden sehr viel mitgenommen.

Dr. theol. Martin Stewen (*1970 in Essen), 1997-2000 Pastoralassistent, seit 2001 Priester der Diözese Chur, 2015-2020 Auslandspriester im Apostolischen Vikariat Südarabien (Abu Dhabi (VAE), derzeit priesterlicher Mitarbeiter in der Pfarrei St. Peter und Paul in Zürich und Mitglied des Synodalrates der Katholischen Kirche im Kanton Zürich; ausserdem tätig als ausgebildeter Supervisor.
Beitragsbild: Kuala Lumpur, fotografiert von Martin Stewen