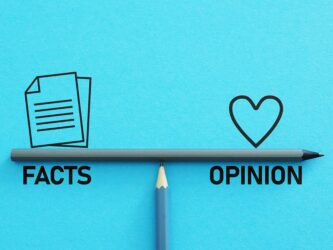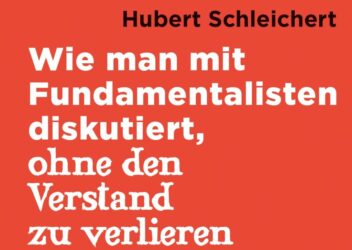Vito Alexander Vasser Santos Batista teilt seine Eindrücke zum kürzlich erschienenen pädagogischen Werk von Patriarch Kyrill.
In einer Zeit, in der Bildung, so der Eindruck, kaum noch in „in aller Munde“[1] oder im Zentrum gesellschaftlicher Debatten steht, was sich etwa im letzten Wahlkampf gezeigt hat,[2] findet in Russland, einem Land, das einen Angriffskrieg führt, und in einem Patriarchat, das diesen als heiligen Krieg verherrlicht, dennoch eine eigenartige Prioritätensetzung statt. Patriarch Kyrill veröffentlichte vor kurzem ein Buch mit dem Titel Kirche und Schule. Bildung + Erziehung = Persönlichkeit,[3] das auf den ersten Blick pädagogischen und theologischen Anspruch erhebt – in Wirklichkeit aber weder das eine noch das andere überzeugend liefert.
Kirche und Schule. Bildung + Erziehung = Persönlichkeit
Schon die erste Seite ist aufschlussreich: Anstatt mit pädagogischen oder theologischen Konzepten zu beginnen, eröffnet Kyrill mit dem Wort Ideologie. Diese, so behauptet er, sei ein kurzlebiges Phänomen, das höchstens drei bis vier Generationen überdauere (5). Damit spielt er wohl auf seine sowjetische Erfahrung mit der kommunistischen Ideologie an, die bereits in der Spätphase der Breschnew-Ära als unglaubwürdig oder gar lächerlich galt. Offen ausgesprochen wurde dies jedoch nicht, da eine ideologische Abweichung weiterhin als schweres Vergehen geahndet wurde.[4] Als Alternative propagiert er Erziehung, die angeblich für die Ewigkeit wirken soll. Doch im nächsten Satz folgt der Widerspruch: Ohne Ideen könne ein Kind nicht erzogen werden und eine Schule ohne Ideen sei gefährlich (5f.). Was denn nun? Ist Ideologie, im Wortsinn als Verbindung von ἰδέα und λόγος, also doch eine notwendige Grundlage der Pädagogik? Eine Klärung erfolgt nicht, da zentrale Begriffe diffus und nebulös bleiben und schlicht nicht definiert werden.
Behauptungen statt fundierte Analysen
Statt fundierter Analysen reiht Kyrill Behauptungen aneinander. So bezeichnet er Pädagogik als „einen Bereich der Askese“ (119), ohne dies näher zu erläutern. Dabei wäre eine inhaltliche Fundierung möglich gewesen. Schleiermacher stellte bereits eine Verbindung zwischen Erziehung und Askese her und Bokelmann schrieb in den 1960er Jahren, dass Askese „ein Grundmotiv des Erziehens“ sei,[5] da sie den Menschen lehre, sich selbst Grenzen zu setzen. Doch Kyrill bleibt vage. Statt einer reflektierten Auseinandersetzung fordert er schlicht, dass Lehrkräfte „eine Heldentat, eine Selbstverausgabung, so wie Christus sich für die Erlösung des Menschengeschlechts verausgabt hat“, erbringen müssen (119) – eine überhöhte Erwartung.
Besonders irritierend ist dabei seine Schilderung eines „komischen“ Mathematiklehrers aus der Schulzeit seines älteren Bruders: „Er war behindert, und vielleicht hatte er aufgrund dieser Behinderung eine gewisse ontologische Ablehnung des orthodoxen Glaubens, und in meinem Bruder, dem Sohn eines Priesters, sah er ein ständiges Objekt der Aggression“ (137f.). Hier wird Behinderung nicht nur als „komisch“, sondern als mögliche Ursache für Glaubensferne dargestellt – bedenkliche Zuschreibungen. Gleichzeitig ignoriert Kyrill die historische Realität: Sein älterer Bruder besuchte vermutlich, wie er selbst, eine sowjetische Schule, in einem Staat, in dem eine ablehnende Haltung gegenüber der Kirche herrschte. Warum also diese Individualisierung eines systemischen Problems?
völlig kontextlos
Ein weiteres befremdliches Beispiel ist Kyrills Erinnerung an eine Lehrerin, die er als vorbildlich beschreibt, bis sie sich scheiden ließ. „Das war ein Schock für die Kinder“, schreibt er (122). Warum eine Scheidung in einem offiziell säkularen Staat derart verstörend sein soll, bleibt unklar.[6] Dabei vertritt Kyrill in diesem Abschnitt, völlig kontextlos, die Ansicht, dass Lehrer früher noch „Erziehende“ gewesen seien, die gemeinsam mit den Eltern „die Überwindung einiger böser Neigungen“ der Schüler angestrebt hätten (122). Was sind denn nun böse Neigungen?
Noch problematischer wird das Buch im weiteren Verlauf, wenn Kyrill Bildung mit der Herausbildung einer nationalen Identität gleichsetzt. Während Bildung, so mein Verständnis, auf Autonomie und Mündigkeit abzielt, formuliert Kyrill ein anderes Ziel: „Die Grundlage für die Schaffung einer wirklich wohlhabenden Gesellschaft ist der Aufbau und die Entwicklung eines Bildungssystems, das unseren jungen Bürgern ein Verantwortungsgefühl für ihr Vaterland vermittelt“ (27). Doch woher rührt dieser Fokus auf nationale Identität bei einem Mann, der den Großteil seines Lebens in der Sowjetunion verbracht hat, einem Staat, der ein supranationales, sozialistisches Menschenbild propagierte und jede Fixierung auf Nationalität zumindest theoretisch als reaktionär betrachtete?
Bildung als Herausbildung einer nationalen Identität
Kyrill selbst begründet dies mit den „politischen, sozialen und wirtschaftlichen Umwälzungen, die das Land Ende des letzten Jahrhunderts heimsuchten“ (43). Diese hätten das russische Volk von seinem Werteparadigma abgekoppelt. Doch welche nationale Identität soll das gewesen sein? Russland existiert in seiner heutigen Form erst seit 1991. Zwar gab es bereits Ende des 19. Jahrhunderts Bestrebungen, eine russische Nation zu konstruieren, doch spätestens mit der Oktoberrevolution wurde dieser Nationalgedanke obsolet.[7]
Dennoch setzt Kyrill, und dies wieder ohne jeglichen Kontext, das Vaterland mit dem Volk gleich: „Vaterland ist hauptsächlich das Volk“ (129). Doch warum soll das Volk über dem Leben eines Individuums stehen? Wo bleibt denn hier die (Nächsten-)Liebe? Hat Jesus jemals zum Tod fürs Vaterland aufgerufen? Diese Vorstellung kulminiert in Kyrills Äußerung zum gegenwärtigen Krieg: „Unsere Leute sterben derzeit für das Vaterland“ (129). Inwiefern sterben sie in einem fremden Land für das Vaterland? Wie passt das mit Theologie oder Pädagogik zusammen?
Verknüpfung von Bildung mit Sebstaufopferung
Die Verknüpfung von Bildung mit Selbstaufopferung für ein Ideal erreicht ihren Höhepunkt, als Kyrill das christliche Menschenbild als Vorbild für sein Bildungsideal heranzieht: „Das Bild eines Menschen, der bereit ist, sich zum Wohle anderer zu opfern, ist ein christliches Bild“ (15)! Er verweist auf Joh 15,13: „Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt.“ Doch was bedeutet Selbstaufopferung im nationalstaatlichen Kontext? Nächstenliebe kann wohl kaum an nationalen Grenzen enden, gerade wenn die universelle Perspektive des Christentums ernst genommen wird. Außerdem sind Nationalstaaten eine moderne Erfindung, keine ewigen Strukturen.
Doch genau dieses Konzept scheint Kyrill zu verfolgen: Die Erziehung zukünftiger Generationen soll eine richtige Persönlichkeit formen – einen Menschen, der nicht nach Erfolg, materiellem Wohlstand, Gesundheit oder Schönheit strebt, nicht am Leben und Wohlbefinden klammert (15f.), nicht das eigene Konsumniveau steigern will (124f.) und nicht nach Fremdsprachenerwerb strebt, weil dies absurderweise mit Emigrationswünschen gleichgesetzt wird.[8]
Es bleibt offen, inwiefern hier überhaupt von Erziehung gesprochen werden kann.
Letztlich geht es hier nicht um Pädagogik oder Theologie, sondern um die Erziehung einer Generation, die bereit ist, sich für das Vaterland zu opfern. Bildung wird hier zur Indoktrination, die Selbstaufopferung zum höchsten Ideal. Es bleibt vollkommen offen, inwiefern hier überhaupt von Erziehung gesprochen werden kann, wenn die Liebe zum Vaterland nicht gelehrt, sondern als etwas quasi Natürliches und Organisches vorausgesetzt wird, als fester Bestandteil der Weltanschauung und Seele des russischen Märtyrers (129). Was Kyrill hier propagiert, hat mit christlicher Nächstenliebe wenig zu tun – und mit moderner Pädagogik noch weniger.

Vito Alexander Vasser Santos Batista ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Religionspädagogik und Katechetik der Ruhr-Universität Bochum. In seiner Promotion erforscht er die Anwendung und Anwendbarkeit dekolonialer und postkolonialer Theorien in der Religionspädagogik.
[1] Ricken, Norbert (2006), Die Ordnung der Bildung. Beiträge zu einer Genealogie der Bildung. Wiesbaden: VS Verlag, 9.
[2] Dies ist jedoch nicht überraschend. Einerseits war „die tatsächliche Lage […] weitgehend kein Gegenstand des Wahlkampfs.“ Sander, Hans-Joachim (2025), Nach der Wahl und vor einem Tsunami. Also keine Entwarnung, in: feinschwarz.net, online unter: https://www.feinschwarz.net/nach-der-wahl-und-vor-einem-tsunami/ (abgerufen am 20.03.2025); Andererseits ist Bildung bekanntlich Ländersache, ein Bereich, in den sich die Bundespolitik nur ungern einmischt.
[3] Dies ist meine Übersetzung des Buchtitels: Церковь и Школа. Образование + Воспитание = Личность. Vgl. Патриарх Кирилл (2024), Церковь и Школа. Образование + Воспитание = Личность, Москва: Издательство Московского Патриархата Русской Православной Церкви (Patriarch Kyrill (2024), Kirche und Schule. Bildung + Erziehung = Persönlichkeit, Moskau: Verlag des Moskauer Patriarchats der Russischen Orthodoxen Kirche); Alle im Folgenden genannten Auszüge aus dem Buch des Patriarchen sind ebenfalls von mir übersetzt. Um den Anmerkungsapparat nicht unnötig zu belasten, wird bei direkten oder indirekten Verweisen auf das Buch auf Fußnoten verzichtet. Stattdessen erscheinen die jeweiligen Seitenzahlen in Klammern hinter den entsprechenden Passagen.
[4] Vgl. Schattenberg, Susanne (2014), Stabilität und Stagnation unter Breschnew, in: Informationen zur politischen Bildung 323/3, 22-40.
[5] Bokelmann, Hans (1963), Askese und Erziehung. Beitrag zur anthropologischen Fundierung der Bildung, in: Bildung und Erziehung 16, 637-650, hier 648.
[6] An dieser Stelle sei angemerkt, dass Scheidung und Abtreibung, mit wenigen Ausnahmen, seit der Gründung der UdSSR fest institutionalisiert waren und zu den zentralen sozialen Maßnahmen des kommunistischen Staates zählten. Abtreibungen waren und sind bis heute erlaubt und werden auf staatliche Kosten durchgeführt. Vgl. Kosterina, Irina (2017), Ist die Genderpolitik in Russland konservativ?, in: Russland-Analysen 338, 2-5.
[7] Vgl. bspw. Tolz, Vera (2011), Russia’s Own Orient. The Politics of Identity and Oriental Studies in the Late Imperial and Early Soviet Periods, Oxford: Oxford University Press, 45 Anm. 100.
[8] Hierbei handelt es sich um einen bizarren geschichtlichen Exkurs bei Kyrill: „Warum wurden unsere Soldaten nach dem Krieg von 1812, nachdem sie in Paris einmarschiert waren und Napoleon besiegt hatten, keine Pariser, sondern kehrten in ihr Heimatland zurück? Unsere Offiziere beherrschten die französische Sprache perfekt, aber sie kehrten trotzdem zurück. Warum ist das so? Warum hat das Vaterland damals angezogen und heute nicht mehr? Stimmt etwas mit dem Vaterland nicht oder stimmt etwas mit den Menschen nicht? Die Heimat ist dieselbe […]. Es geht also nicht um das Vaterland, es geht um schlecht erzogene Menschen“ (125f.); Dann liegt es wohl doch nicht am Fremdsprachenerwerb.
Beitragsbild: Elena Olesik, pixabay.com