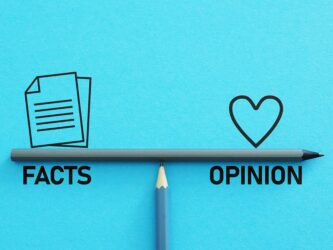Martin Ott (Potterhanworth / UK) reagiert in einem Leserbrief auf den Beitrag von Katarína Kristinová.
Katarína Kristinová meldet sich zu dem Thema Wahrheit im postfaktischen Zeitalter. Ihre Kernforderungen, um Unwahrheit, Lüge, Manipulation, Propaganda zu begegnen, sind methodische Zweifel, Selbstwiderlegungspraxis und Wahrhaftigkeit, also Appelle an die Empfänger:innen von manipulativen oder falschen Informationen, solche zu erkennen und selbst nicht zu produzieren. Aus meiner Beratungstätigkeit mit Menschen, die im öffentlichen und im beruflichen Umfeld mit ignoranten Personen zu tun haben, kann ich berichten, dass es nahezu unmöglich ist, auf diesem Wege der Unwahrheit Einhalt zu gebieten. Gerade Intellektuelle mit einer hohen Verbalitätsdichte sitzen oft dem Habermas‘schen Postulat einer herrschaftsfreien Kommunikation auf und meinen, dass sich Wahrheit durchsetzt, wenn deren Geltungsansprüche erfüllt sind: die Verständlichkeit, die Wahrheit (die tatsachentreue Darstellung), die Wahrhaftigkeit (gibt an, ob eine Aussage der Intention entspricht) und die Richtigkeit (der normative Kontext). Im rein akademischen Umfeld mag das funktionieren. Aber selbst Richard Dawkins berichtete einmal, dass er es im universitären Umfeld nur ein einziges Mal erlebt hatte, dass ein Kollege (ein Biologe) sich nach dem Vortrag eines Gastdozenten von dessen Argumenten überzeugen ließ und in aller Öffentlichkeit eine lebenslang vertretende Position widerrief.
Wenn im öffentlichen und politischen Raum, aber auch im Beruf oder in privaten Begegnungen mit der Hilfe von Fake News Unwahrheit und Propaganda verbreitet wird, ist das nicht ein Diskurs zur Herstellung von Wahrheit, sondern eine Strategie zur Herstellung und Sicherung von Macht und Dominanz. Einer Person, die Fake News verbreitet, kann und darf man solange nicht mit Argumenten begegnen, solange es eben nicht um Argumente und Wahrheit, sondern um Macht und Vormacht geht. In seinem Buch „Mit Ignoranten Sprechen“ betont Peter Modler, dass es keinen Sinn macht “einem Ochsen ins Horn zu kneifen“, da dieser das gar nicht spüre. Es kommt vielmehr darauf an, sich erst einmal seines eigenen Kommunikationsverhaltens bewusst zu werden, um zu vermeiden, dass man sich sozusagen an einem Diskurs abarbeitet, in dem der Gegner gar nicht aktiv ist und die eigene Sprachstruktur fraglos für normal oder sogar überlegen hält.
Ein konzeptioneller Hintergrund, um das zu klären, ist die Unterscheidung zwischen horizontaler und vertikaler Kommunikation, die die amerikanische Linguistin Deborah Tannen („Talking from 9 to 5. Women and men at work: language, sex und power”) eingeführt hat. In Kürze: Vertikale Kommunikator:innen streben nach Status- und Rangklärungen, horizontale Kommunikator:innen legen Wert auf Zugehörigkeit und Inhalte. Für die „Habermasgemeinde“, sprich „Horizontale“ ist es wichtig, „Vertikalen“ nicht mit moralischer Überlegenheit zu begegnen und den eigenen moralischen Empörungsreflexen nicht nachzugeben, sondern die Sprachspiele einer vertikalen Kommunikation zu verstehen und zu erlernen, wie man sich darin bewegen kann. Es kommt also darauf an, „zweisprachig“ zu sein und in beiden Systemen sicher zu agieren. Dominanten und machtbewußten „Vertikalen“ kann man dann durchaus etwas entgegensetzen, auch wenn sie mit manipulierten Halbwahrheiten daherkommen: die Klärung von Status, Rolle und Mandat, die Vermeidung emotionaler Reaktion („cool“ bleiben), Langsamkeit in Sprache und Bewegung, kein langes Argumentieren, kurze Aussagen (Basic Talk) und wenn notwendig, die gebetsmühlenhafte Wiederholung einfacher Botschaften, schließlich der Einsatz von „Move Talk“, dem bewussten Einsatz von Körpersprache, von vermeintlich kleinen Gesten bis hin zur Nutzung des Raumes als Bühne. So kann man ignoranten Personen und der Unwahrheit mit Erfolg entgegentreten und, im besten Fall, die Situation wieder auf ein Niveau bringen, in der tatsächlich das bessere Argument zählt.
Dr. Martin Ott, Potterhanworth / UK