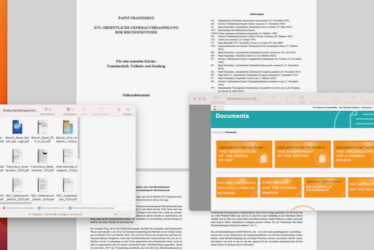Kann man Kirche und Gesellschaft wirklich nach zweierlei Maß messen, wie manche das insinuieren? Die Politikwissenschaftlerin Tine Stein fragt danach, ob die Verfassungsordnung der Kirche organisch umgestaltet werden kann und an welcher Stelle disruptive Elemente notwendig sein werden.
Was ist der Synodale Weg: ein revolutionärer Prozeß, bei dem eine gänzlich andere Kirche entstehen soll, eine Reform-Etappe auf dem Weg durch die Zeit der ecclesia semper reformanda oder doch nur ein weiterer Versuch der Bischofskonferenz, das aufgebrachte Kirchenvolk durch ein Kirchenpalaver zu befrieden, das sich aus selbst verschuldeter Unmündigkeit immer wieder täuschen lässt?
Die Kirche ist eine göttliche Stiftung. Dennoch braucht ihre irdische Seite eine menschengemachte Rechtsgrundlage.
Der Revolutionstheoretiker und Rechtshistoriker Eugen Rosenstock-Huessy hat es als das Urrecht jeder Revolution bezeichnet, „von sich aus einen neuen Rechtsgrund zu schaffen und mit allen vorhergehenden Rechtsgrundlagen zu brechen.“[1] Der Grund der Kirche im Sinne ihres Ursprungs und ihres Zwecks ist, dass sie durch Jesus Christus gestiftet ist, um der Welt Hoffnung auf Versöhnung und Heil zu bringen. Dieser Grund ist den Gläubigen unverfügbar. Der Synodale Weg ist also insofern kein verfassunggebender Prozeß, bei dem das Volk Gottes von sich aus einen neuen Rechtsgrund schaffen und aus eigener Ermächtigung einen neuen Anfang setzten könnte. Aber der Bezug auf die göttliche Stiftung sagt nichts aus über die Frage, welche Rechtsgrundlage für die irdische Seite der Kirche als Form sozialer Vergemeinschaftung angemessen ist. Der Synodale Weg kann als eine Chance verstanden werden, die Kirche aus einer Sackgasse heraus und in eine Transformation zu führen, die mit einer neuen Rechtsgrundlage und einem anderen Rechtsverständnis einhergeht.
Ein neues Recht und ein anderes Verständnis, was Recht in der Kirche bedeutet, ist bitter nötig. Das gegenwärtige Kirchenrecht ist nicht als Teil der göttlichen Stiftung vom Himmel gefallen, es ist gemacht worden von Päpsten und Bischöfen, die hier eine Ekklesiologie zementiert haben, die ohne Zukunft ist: mit der Leitidee von Bischöfen als Hirten und Gläubigen als Schafen, der Vorstellung einer sakramentalen Vollmacht des geweihten Priesters, von dessen Amt heraus umfassend die kirchliche Leitungsgewalt definiert wird, mit dem Bischof an der Spitze der Ämterordnung, eingesetzt durch den mit Primatialgewalt ausgestatteten Bischof von Rom. Die Bischöfe führen die Kirche, dem absolutistischen Staat nachempfunden, als Monarchen, im wahrsten Sinne des Wortes los-gelöst wie ein legibus absolutus, unkontrolliert durch eine unabhängige Gerichtsbarkeit, nicht rechenschaftspflichtig gegenüber denen, über die sie Macht ausüben, allein entscheidend und in ihrem Ermessen frei, ob sie Rat einholen und wie sie diesen berücksichtigen.
Macht wird nicht als Vermögen, sondern als strukturelle Ungleichheit erfahren.
Diese institutionelle Verfasstheit ist getragen von einem Verständnis von Kirche, die nicht nur Glaubens- sondern eben auch Rechtsgemeinschaft ist, wobei sich das Recht als Gehorsamsanspruch nicht nur auf äußeres Verhalten, sondern auch auf innere Übereinstimmung richtet. Macht wird so nicht als Vermögen, nicht als positive Kraft und Raum der Ermöglichung zu gemeinschaftlichem Handeln verstanden, aus dem heraus Diakonie, Prophetie und Liturgie gestaltet werden können – nach dem basalsten Kirchenverständnis als Zusammenkommen von zweien oder dreien im Namen Jesu Christi, der dann mitten unter diesen ist –, sondern als strukturelle Ungleichheit erfahren. In der sakramental begründeten kirchlichen Ämterordnung haben zwar alle Getauften Anteil am dreifachen Amt Jesu Christi und sie tragen die gleiche Würde, aber haben nicht die gleichen Rechte. Den Gläubigen als Laien kommen vor allem Pflichten zu, nämlich in ihrem Leben den sittlichen Anspruch des Evangeliums zu bezeugen und in die Welt zu tragen – allerdings nach Maßgabe der Interpretation durch das Lehramt.
Diese Rechtsgestalt der Kirche ist selbständig denkenden Gläubigen, die gewohnt sind, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen und diese vor Gott in ihrem forum internum zu rechtfertigen, nicht mehr einsichtig zu machen. Nach weltlichen Maßstäben und den durch Erfahrung gewonnenen Erkenntnissen sind Organisationen mit Machtkonzentration, ohne Kontrolle und Rechenschaftspflichtigkeit, ohne plurale Deliberationen, nicht nur unvernünftig, sondern bergen auch Gefahren des Mißbrauchs von Macht. Es ist diese Machtstruktur, die die Kirche als Institution in eine ihrer tiefsten Krisen geführt, zu einem ihrer dunkelsten Kapitel. Denn einige fühlten sich in diesem System dazu ermächtigt, ihre Macht zu demonstrieren und als Gewalt auszuleben. Und damit haben sie dem mißbrauchten Kind, der vergewaltigten Frau und auch dem sexuell genötigten Mitbruder gesagt: ich habe Macht über dich, das zu tun, was ich tue, weil ich es will, weil ich es kann.
Der Selbstwiderspruch zwischen kirchlichem Handeln und der Botschaft, die ihr aufgegeben ist, macht den Kern der Krise aus.
Dieses System hat nicht nur Gelegenheitsfenster für die Täter geschaffen, sondern auch Aufklärung behindert und verhindert, dass den Opfern Gerechtigkeit widerfährt. Irland, Australien, USA, Österreich, Deutschland, Polen, jetzt Frankreich – in der katholischen Welt wird in Schockwellen offenbar, dass die Täter, diese klerikalen Machtmißbraucher, geschützt worden sind von einigen ihrer Mit-Brüder in verantwortlichen Positionen und mitunter auch von den nicht sehen wollenden Gemeinden, in denen sie verankert waren. Man kann es nicht oft genug sagen: Der Selbstwiderspruch zwischen kirchlichem Handeln und der Botschaft, die ihr aufgegeben ist, macht den Kern der Krise aus. Es ist das System selbst und deswegen kann in dieser Hinsicht kein Stein auf dem anderen bleiben. Wer dies einen Missbrauch des Missbrauchs nennt, als Instrumentalisierung für eine innerkirchliche politische Agenda diskreditiert, hat die Zeichen der Zeit nicht nur nicht verstanden, er stellt sich auch selbst in den Verdacht, aus partikularen Interessen eine überkommene Struktur zu verteidigen und tatsächlich nicht theologisch, sondern ideologisch zu sprechen.
Die 2. Synodalversammlung stand mit sehr deutlicher, für einige mit überraschend großer Mehrheit dafür ein, diese überkommene Struktur zugunsten weitreichender Reformen zu überwinden. Die in erster Lesung abgestimmten Texte weisen in die Richtung einer grundlegenden Transformation. Ist die Umsetzung in die Praxis bei den gegebenen Machtverhältnissen realistisch, werden auch die zögernden Bischöfe sich dem Druck eines eindeutigen Votums nicht entziehen und im Wege der Selbstbindung in ihren Diözesen diese Transformation ins Werk setzen? Und wird es dort, wo es der – im weiteren Verlauf des Synodalen Wegs noch zu formulierenden – Voten an den universalkirchlichen Gesetzgeber bedarf, das geltende Kirchenrecht zu ändern, insbesondere beim Zugang zum Priesteramt, auch zu dem notwendigen Nachdruck kommen, diese Voten in Rom zu begründen und voranzutreiben?
Der Statut des Synodalen Wegs spiegelt bei der Entscheidungsgestaltung die traditionellen innerkirchlichen Machtverhältnisse.
Die Skeptiker des Synodalen Wegs werfen den Laien unter seinen Protagonisten vor, nicht die wahren Machtverhältnisse zu sehen, die dafür sorgen, dass die Selbstbindung im Rahmen des bestehenden Kirchenrechts nicht funktionieren kann, geschweige denn dass es zu einer expliziten Änderung des Kirchenrechts in die gewünschte Richtung kommen wird. So wie der Synodale Weg von seinem Statut her aufgesetzt worden ist, spiegelt er in der Tat bei der Entscheidungsgestaltung die traditionellen innerkirchlichen Machtverhältnisse. Aber wenn man den Blick ausschließlich auf den Codex wie auch auf das Statut des Synodalen Wegs fixiert, dann sieht man keine Wege der Umkehr, die aus der Sackgasse, in der sich die Kirche befindet, herausführen können. Es kommt auf eine politische Analyse der Veränderungspotentiale und auch der Bedingungen an, die den Status Quo stützen. Was passiert, wenn einige Bischöfe ihr Vetorecht ausspielen und Veränderungen verhindern würden? Dann setzte diese Minderheit die Verweigerung der Realität fort, vom Hören auf den gemeinschaftlich geäußerten Glaubenssinn des Volkes Gottes zu schweigen. Diese Chance, die der Synodalen Weg bietet, nicht zu ergreifen und das Momentum verstreichen zu lassen, hieße die Realität nicht wahrzunehmen.
Die Bischöfe müssen verstehen, dass wer die Macht hat, zwar das Recht hat, aber nicht automatisch recht hat – trotz eines gepflegten Selbstverständnisses, aus heiliger Vollmacht heraus nicht nur potestas sondern auch auctoritas innezuhaben. Wenn aber das Ansehen im Kirchenvolk schwindet, dann erodiert auch der Legitimitätsglaube, auf den jeder Inhaber von Herrschaftspositionen angewiesen ist. Sollten die Bischöfe und der Papst als innerkirchliche Gesetzgeber die kirchliche Verfasstheit und das vorherrschende Amtsverständnis nicht ändern, dann werden die Gläubigen in wachsender Zahl ihre Wege zum Heil außerhalb der überkommenen Amtskirche suchen (extra praesentem ecclesiam, salus possibilis est). Dann leeren sich die Kirchenbänke weiter, Engagierte für die Pfarrgemeinderäte und die Arbeit in den Gemeinden fehlen, Steuereinnahmen sinken und es schwindet insgesamt auch die öffentliche Bedeutung der Amtskirche.
Erkenntnis ist eben auch durch Interesse geprägt.
Diese Strategie des Exits ist nach dem Sozialwissenschaftler Albert O. Hirschman die eine Option, die Mitglieder wählen, wenn die Loyalität zu einer Organisation schwindet. Die andere Strategie lautet Voice. Bei Voice geht es um mehr als die argumentative Begründung von Mißständen und Veränderungsnotwendigkeiten, es geht auch um den politischen Nachdruck in Form von Protest, was Maria 2.0 genau verstanden hat. Die guten Argumente, die beharrlich und engagiert, mit Engelszungen und mit Liebe, vorgetragen werden, sind das eine. Dies ist unverzichtbar, denn daraus speist sich die wichtigste Ressource für eine Transformation – innere Überzeugung aus eigener Einsicht und es verrät im Übrigen Unkenntnis über politische Veränderungsprozesse, Gesprächsformate als naiv zu kritisieren.
Aber zu der Qualität der Argumente muß auch Nachdruck hinzukommen. Denn natürlich braucht man eine Antwort auf die Frage, was zu tun ist, wenn die Argumente nicht gehört werden, weil die Einsichtsbereitschaft fehlt, da Erkenntnis eben auch durch Interesse geprägt ist und die Interessenlage auf Erhalt des Status Quo gerichtet sein kann. Dann gilt es darüber nachzudenken, wie man den guten Argumenten im Diskurs auch Konfliktfähigkeit verleihen kann. Gläubige sind auch Bürgerinnen und Bürger. Derzeit knüpft der Staat das Kirchensteuersystem, den Körperschaftsstatus, die Staatsleistungen, die Ausnahmen im Arbeitsrecht – alle diese gerade für die katholische Kirche ausnehmend wichtigen Privilegien nicht an das Vorliegen einer bestimmten inneren Verfasstheit, denn diese gilt als innere Angelegenheit, die vor staatlichen Eingriffen durch das Selbstbestimmungsrecht von Religionsgemeinschaften geschützt ist.
Wie lange kann sich der demokratische Verfassungsstaat das noch leisten: keine Einmischung in die „inneren Angelegenheiten“?
Gewiß: der Staat kann einer Religionsgemeinschaft nicht mit den Mitteln des Rechtszwangs vorschreiben, wie sie sich intern zu organisieren hat. Aber muß der demokratische Verfassungsstaat eine religionsgemeinschaftliche Struktur mit staatlichen Privilegienbündeln unterstützen, die von demokratischen und rechtsstaatlichen Prinzipien denkbarweit entfernt ist und die offensichtlich in besonderer Weise sexualisierte Gewalt und die Vertuschung dieser Straftaten ermöglicht hat? Ein weiteres kommt hinzu: Das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften soll einen Schutz davor bieten, dass der säkulare Staat auf religiöse Lehren Einfluß nimmt und diese sanktioniert. Die religiöse Lehre ist aber in der katholischen Kirche derzeit prekär. Ein vertikales Schisma besteht nicht nur mit Blick auf die lehramtliche Sexualmoral, die von den Kirchenmitgliedern nicht für sich selbst als handlungsleitend akzeptiert und zudem als theologisch fehlbegründet angesehen wird.
Der Dissens bezieht sich auch auf die Ekklesiologie einer monokratischen und zentralistischen Klerikerkirche. Als ‚innere Angelegenheit‘ kann so vielleicht der Streit darüber geschützt werden. Aber mit der Fortdauer des Kirchensteuersystems und weiteren Privilegien werden dann tatsächlich durch den demokratischen Verfassungsstaat noch diejenigen prämiert, die in der Kirche die Macht haben, ihre machtvolle Stellung in der gegenwärtigen Ordnung aufrecht zu erhalten. Dies alles spricht dafür, dass die Gläubigen in ihrer Eigenschaft als Bürgerinnen und Bürger darüber nachdenken sollten, wie es mit dem gegenwärtigen Staatskirchenrecht weitergeht, um den theologisch gut begründeten Argumenten im Sinne der Voice-Strategie den notwendigen Nachdruck zu verleihen.
[1] Rosenstock-Huessy, Eugen: Die europäischen Revolutionen und der Charakter der Nationen, Stuttgart/Köln 1951 (erstm. 1931), S. 144
—
Prof. Dr. Tine Stein lehrt Politische Theorie und Ideengeschichte an der Georg-August-Universität Göttingen. Sie ist Mitglied im Synodalforum „Macht und Gewaltenteilung“.
Bild: Synodaler Weg/Maximilian von Lachner