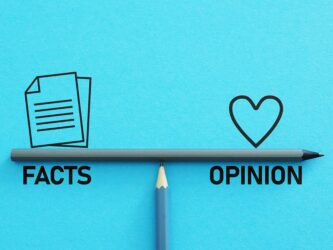Vor genau fünfzig Jahren fieberte man in Deutschland gerade den Olympischen Spielen von München entgegen. Deren Architektur und Design haben ein utopisches Potenzial, das noch immer zu faszinieren vermag – das findet zumindest Christian Bauer. Er hat eine Ausstellung in der Münchner Pinakothek der Moderne besucht und entführt anlässlich des hundersten Geburtstags von Otl Aicher auf eine Zeitreise in den erwartungsfrohen, zugleich aber auch krisenträchtigen Sommer 1972.
Mit den Münchner Spielen von 1972 verbindet mich einiges. Meine früheste persönliche Erinnerung ist das offizielle Olympiaplakat im Jugendzimmer meines Vaters, das inzwischen leider irgendwo verschollen ist. Namen wie Ulrike Meyfahrt, Heide Rosendahl oder Mark Spitz sind mir noch immer geläufig. Kurz nach der Olympiade wurde meine Mutter mit mir schwanger. Generell war der Sommer 1972 noch eine Zeit der zukunftsfrohen Erwartung – wenn auch nicht ohne Brechung.
Ich wurde also in einer Latenzphase der späten Moderne ausgetragen, die noch immer voll progressiver „Zukunftslust“[1] nach vorne blickte: „Wir schaffen das moderne Deutschland“ (SPD-Wahlslogan 1969). Willy Brandt war damals Kanzler in Deutschland, Bruno Kreisky in Österreich – und in der römisch-katholischen Kirche herrschte unter Papst Paul VI. noch ein konziliarer Geist des Aufbruchs.
Zeltlandschaft aus Plexiglas, Stahlseilen und grenzenlosem Optimismus
München 1972 – das war die Utopie eines besseren, da locker-lässigen, demokratischen und weltoffenen Deutschlands. Ohne Uniformen, dafür aber mit Minirock und Schlaghose. Sinnenfällig greifbar wurde dieser schwebend-filigrane und zugleich poppig-bunte Zukunftstraum der Münchner Spiele von 1972 in dem von Günter Behnisch federführend konzipierten Olympiagelände und in dem von Otl Aicher kongenial entworfenen Gesamtdesign. Ich bin ein Fan von beidem.


„Das, was man mit dem etwas unscharfen Begriff Fortschritt bezeichnete, bedeutete nicht mehr nur die Strahlkraft des Neuen und technische Machbarkeit, sondern Demokratisierung, Teilhabe und Gemeinwohl, Emanzipation, Wohlstand und ein besseres Leben für alle. Zu den Olympischen Spielen 1972 zeigte sich Deutschland in München mit dem filigranen Dach des neuen Stadions als moderne, leichte, offene Demokratie – an einem Ort für die Massen, der trotz seiner Größe nicht erschlagend wirkt und das Gegenteil des Nazi-Theaterdonners war, der in Berlin 1936 zu Olympia aufgefahren wurde.“[7]
Zeichen eines neuen Deutschlands
Dem architektural-designerischen Gesamtkunstwerk der Olympischen Spiele von 1972 widmet sich gerade eine großartige Ausstellung in der Münchner Pinakothek der Moderne (7. Juli 2022 – 8. Januar 2023). Dort kann man unter anderem das berühmte, mit Hilfe von Streichhölzern, Stecknadeln und einer Feinstrumpfhose erstellte Erstmodell der Münchner Zeltlandschaft bestaunen.




Design für eine bessere Welt
Die Münchner Olympiaausstellung lässt ihre Besucher:innen in ein Fest der Farben eintauchen, das sie auf eine faszinierende Zeitreise in die bunten Gefilde der 1970er Jahre schickt: „In deutschen Küchen kleben Prilblumen, das Fernsehen wird farbig und der Rest der Welt auch“[14]. Die berühmte Farbpalette Aichers vereint Hellblau, Hellgrün, Gelb, Dunkelblau, Dunkelgrün und Orange – und verzichtet auf klassische Farben der Macht wie Rot und Gold, die zur „propagandistischen Selbstinszenierung“[15] des Nationalsozialismus 1936 gehörten. Stattdessen dominieren der blaue Himmel, die weißen Berge und die grünen Wiesen des Voralpenlandes – ein bayrisches Auenland, popkulturell erschlossen.
Otl Aichers Design steht für „spielerische spiele“[16] voller „leichtigkeit, frische, heiterkeit“[17], deren menschliches Maß „etwas Süddeutsches“[18] haben sollte. Seine Farben zielen auf postheroische „Regenbogenspiele“[19], welche die Jugend der Welt in zukunftsfroher Vielfalt versammeln sollten. Und zugleich setzte Aicher durch die genial einfachen, von seinem Mitarbeiter Gerhard Joksch aus schwarz bemalten Apothekenstäbchen entwickelten Piktogramme dauerhaft ästhetische Standards.
Der eigensinnig-kreative „kritische Linkskatholik“[20], der mit Inge Aicher-Scholl – einer Schwester von Sophie und Hans Scholl – verheiratet war, zog 1972 ins oberschwäbische Allgäu, um dort die ‚Autonome Republik Rotis’ (die gleichnamige Schrifttype ist meine Lieblingsschrift!) auszurufen. Das Ziel seiner dortigen Werkstatt war ein emanzipatorisches Design für eine bessere Welt[21]: „Entwerfen ist der Ausgang des Menschen aus seiner Unterworfenheit. […] Jeder Designer kann entscheiden, ob er entwerfend oder unterwerfend tätig ist“[22]
Kritische Archäologie der Zuversicht
Architektur und Design von München 1972 sind exemplarisch für den Geist der Zeit. In seinem Beitrag Von 1972 lernen skizziert der FAZ-Feuilletonist Niklas Maak eine „kritische Archäologie der Zuversicht“[23], die dieses Jahr als einen „Höhepunkt der Moderne“ erweist. Selten seien „so viele Versprechen der Moderne eingelöst“ worden wie damals, es entstanden „zahlreiche Werke, die etwas fundamental Neues erproben und die Grundlage für Entwicklungen bilden, die bis heute zu spüren sind“.


Kipppunkt der westlichen Moderne
Aber 1972 war aber nicht nur das Jahr, in dem ein „kollektiver Optimismus, eine zuversichtliche Moderne ihren Höhepunkt erreichte“. Mit dem ersten Bericht des Club of Rome rücken allmählich auch die Grenzen des Wachstums und mit ihnen die Dialektik des Forschritts in den Blick. Das Jahr markiert somit einen Kipppunkt der westlichen Moderne. Und zugleich wurde der so fröhlich und unbeschwert daherkommende Sommer der Münchner Spiele von 1972 jäh vom Terror unterbrochen. Auch dieser leuchtende „Sommer der konkreten Utopie“[24] konnte nicht ohne Eintrübungen bleiben: „Winter is coming.“[25]
Prof. Dr. Christian Bauer ist Professor für Pastoralthelogie und Homiletik an der Universität Innsbruck und Mitglied der Redaktion von Feinschwarz.net.
Bilder: Pixabay, Christian Bauer
[1] Eva Moser: Otl Aicher, Gestalter, Ostfildern 2012, 188.
[2] Moser: Otl Aicher, 197.
[3] Zit. nach Kay Schiller/Christopher Young: München 1972. Olympische Spiele im Zeichen des modernen Deutschland, Göttingen 2012, 155.
[4] Moser: Otl Aicher, 197.
[5] Irene Meissner/Andres Lepik (Hg.): Die Olympiastadt München – Rückblick und Ausblick, München 2022, 75
[6] Gerhard Matzig: Vom Mut, München leuchten zu lassen, in: Süddeutsche Zeitung (9./10. April 2022) 41.
[7] Niklas Maak: Von 1972 lernen. Über den Höhepunkt der Moderne, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (2. Januar 2022), zit. nach https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/von-1972-lernen-ueber-den-hoehepunkt-der-moderne-17709043.html.
[8] Willi Daume, zit. nach Irene Meissner: Die Zeltdächer für die Olympischen Spiele 1972 und Frei Otto: Leichtbau als Symbol der Demokratie, in Dies./ Lepik: Die Olympiastadt München, 188-197, 195.
[9] Meissner: Die Zeltdächer für die Olympischen Spiele 1972 und Frei Otto, 189.
[10] Dietrich Erben: Der Münchner Olympiapark als ‚offene Form’, in: Meissner/Lepik: Die Olympiastadt München, 179-187, 186.
[11] Meissner/Lepik: Die Olympiastadt München, 93 [Ausstellungstexte].
[12] Erben: Der Münchner Olympiapark als ‚offene Form’, 186.
[13] Erben: Der Münchner Olympiapark als ‚offene Form’, 186.
[14] Jens Balzer: Das entfesselte Jahrzehnt. Sound und Geist der 70er, Berlin 2019, 170.
[15] Linus Rapp: Munich 1972. Posters for a modern Germany, in: Die Neue Sammlung – The Design Museum (Hg.): Design für Olympia, Köln 2022, 26-35
[16] Otl Aicher, zit. nach Moser: Otl Aicher, 189
[17] Otl Aicher, zit. nach Rapp: Munich 1972, 25.
[18] Günther Behnisch, zit. nach Moser: Otl Aicher, 191.
[19] Moser: Otl Aicher, 192.
[20] Moser: Otl Aicher, 188.
[21] Dazu Christian Bauer: Architekturen der Pastoral. Skizzen einer theologischen Theorie des Entwerfens, in: Katharina Karl/Stephan Winter (Hg.): Gott im Raum. Theologie und der spatial turn: Aktuelle Perspektiven, Münster 2020, 313-342. Siehe auch Friedrich von Borries, Weltentwerfen. Eine politische Designtheorie, Berlin 2016.
[22] Borries: Weltentwerfen, 15; 122.
[23] Dieses und alle nachfolgenden Zitate: Niklas Maak: Von 1972 lernen.
[24] Moser: Otl Aicher, 198.
[25] Vgl. Christian Bauer: Winter is coming? Politisch-theologische Erkundungen in der Populärkultur, in: Sonja Beckmayer/Christian Mulia (Hg.): Volkskirche in postsäkulärer Zeit. Erkundungsgänge und theologische Perspektiven [FS Kristian Fechtner], Stuttgart 2021, 143-160.