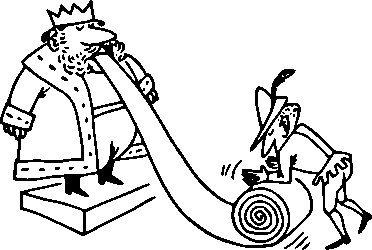Es ist passiert – die Bundestagswahlen stellen die etablierten Kräfteverhältnisse offenbar auf den Kopf. Die politischen Eliten verkaufen uns noch am Wahlabend ihre Erzählung der Ereignisse. Das Ethos der Demokratie aber muss anders verteidigt werden. Daniel Bogner mit einer ersten Wahlnachlese.
Die deutsche Demokratie hat eine Spezialität, und das sieht man gerade vom Ausland her besonders deutlich: Sie ist eine Parteiendemokratie. Fest wie kaum anderswo sind die Parteien in der Verfassung verankert und in den demokratischen Verfahren etabliert. Und so wundert es nicht: Die Deutungsmacht zur Interpretation des Wahlausgangs haben Parteienvertreter – sie sind es, die sich den ganzen Wahlabend hindurch in der Rollenprosa ihrer Profession damit befassen, das Ergebnis einzuordnen.
Eine paradoxale Situation – Parteien kommentieren sich selbst
Eines wird schnell deutlich: Aufgrund ihrer speziellen Interessenlage haben die Parteienvertreter eine ganz bestimmte, beengte Optik. Sie interessieren sich vorrangig dafür, welche Auswirkungen die Arithmetik des Wahlausgangs für die Handlungsoptionen ihrer Formation enthält, oder, aber darüber wird vor allem intern gesprochen, welche personellen Konsequenzen zu ziehen sind. Systemnahe Kommentatoren orchestrieren das und, so etwa Hans-Ulrich Jörges vom Stern, prophezeien einen „Umbruch in der Parteienlandschaft von größtem Ausmaß“…
Das Ethos der Demokratie – das darf man nicht den Parteien überlassen!
Was auch immer man unter Umbruch verstehen mag. Tatsache ist, dass eben diese Deutungsmacht einer Parteiendemokratie, die sich selbst auslegt, Teil des Problems ist, das man im Wahlergebnis erkennen mag. Mit anderen Worten: Die Rettung des Ethos der Demokratie darf man nicht den Parteien überlassen – auch wenn das Wahlergebnis im Parteiensystem gewisse Selbstreinigungskräfte befördert, wie man am Beispiel der SPD sehen kann – die aus Demokratieverantwortung von vornherein in die Opposition will und den Kollateralnutzen der Eigenstabilisierung dabei dankend in Kauf nehmen wird…
Anmerkungen zur neuen Lage
- Gerade vom europäischen Ausland her wird man das Wahlergebnis mit einer gewissen Nüchternheit entgegennehmen: Nun hat auch Deutschland „seine“ Rechtspopulisten. Warum sollten die Deutschen um die Herausforderung herumkommen, sich zu überlegen, was sie dem Populismus in Politik und Gesellschaft wirkungsvoll entgegen stellen können? Wieso sollten die Deutschen das Privileg haben, weiterhin unter dem Schutzschirm einer nur historisch erklärbaren mentalen Großwetterlage zu leben, in der eine anderswo längst marginalisierte Christdemokratie den rechten Rand mit abdeckt und lange Zeit keine radikale Schmuddelpartei aufkommen ließ? Nein, dieses Privileg existiert nicht länger. Die Deutschen müssen sich Gedanken machen, wie man sich aktiv mit der Bedrohung der freiheitlichen Demokratie auseinandersetzt und selbst für demokratisches Bewusstsein in der Bevölkerung sorgt.
- Angela Merkel taugt nicht zum Hassobjekt. Es hilft gar nichts darauf herumzureiten, „ohne sie“ gäbe es die AfD nicht etc. Und wenn es so wäre – dann würde ja wohl die CDU/CSU noch eine Politik machen, die wesentliche Modernisierungsschübe (Atomausstieg, Abschaffung der Wehrpflicht, Öffnung der Ehe etc.) nicht mitvollzogen hätte. Stünde die Partei wirklich besser da? Wie wären ihre Zukunftsaussichten, hätte sie nicht mit Merkel in den vergangenen Jahren zahlreiche Positionen der politischen Mitte besetzt?
- Das AfD-Ergebnis zeigt: Es gibt einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung, der sich im etablierten politischen Diskurs, der ja Wahlmöglichkeiten zwischen politisch gegensätzlichen Programmen zuließ, nicht wiederfindet. Es ist wohl mehr ein kulturelles Sich-nicht-Wiederfinden als die Klage über wirtschaftliche Marginalisierung. Und es ist das Problem von SPD und Linkspartei, diese Tatsache überhaupt nicht verstanden zu haben. Die politische Linke holt sich die Quittung dafür, kein gehaltvolles Verständnis von „Heimat“ entwickelt und kommuniziert zu haben – jenseits von Ortsverein, Milieu oder nostalgischer Projektion. Man muss sehen: Der Protest wird immerhin (immerhin!) in der Sprache des demokratischen Systems artikuliert – über demokratische Wahlen.
- Ventilierung eines bislang nicht repräsentierten Bevölkerungswillens nicht durch Gewalt, sondern durch den Gang zur Wahlurne, auch wenn das gewählte Programm Anlass zu Sorge bereitet – Krise der Demokratie oder Reife der Demokratie? Hierzu hörte man von den – natürlich – gekränkten Parteienvertretern am Wahlabend kaum etwas. Im politischen Umgang mit den Rechtspopulisten stößt man auf die Dialektik von Angebot und Nachfrage. Die These der etablierten Parteien scheint zu lauten: Es gibt irgendwelche kruden Nazi-Funktionäre (ja, es gibt sie wirklich!), und die schaffen sich durch ihre Parolen überhaupt erst Gefolgschaft und dann eine Wählerbasis, die sie in die Parlamente trägt. Ist das so, genügt es, die schlimmen Funktionäre zu bekämpfen und wenn die dann geschlagen sind, hat man das Phänomen erledigt. Keiner kommt auf die Idee, dass es eine politisch-kulturelle Unzufriedenheit gibt, die offenbar im toten Winkel der professionellen politischen Wahrnehmung liegt und die Formierung eines solchen Phänomens wie die AfD überhaupt erst erlaubt. Dass dieser Überbau dann ein autoreferenzielles Eigenleben führt, ist evident. Das Problem ist: Die reine Ausgrenzung des Protestsymbols macht den Protestgrund nicht hinfällig – auch wenn es natürlich der Debatte bedarf, was im demokratischen Gemeinwesen ein „guter Grund“ ist.
- Im politischen Diskurs einer Gesellschaft mit Sechs-Parteien-Parlament wird es anders zugehen müssen als bisher. Da werden bisherige Erbhöfe in Frage gestellt – politische Felder, die von den Großen, unter gelegentlicher Berücksichtigung von gelb und grün, schiedlich-friedlich bestellt wurden. Wo jeder um die Reichweite und Ressourcen des anderen wusste und sich parlamentarische Demokratie unterm Strich doch wieder als kabinettspolitisches Kammerspiel ausnahm, in dem „keiner keinem etwas nimmt“. Jetzt ist die Situation offener: So sehr „links“ und „rechts“, „konservativ“ und „progressiv“ an Prägnanz verloren haben, so sehr geraten die politischen Sachfragen neu in den Fokus einer echten Verhandlung, in der die beteiligten Akteure mit offenem Visier um Allianzen und Kooperationen werben müssen. So die Hoffnung.
- Und schließlich: Die Kirchen (vor allem für die katholische gilt das) sollten überlegen, ob sie sich länger ihre bisherige Haltung der AfD gegenüber leisten wollen – eine Partei, die immerhin mit fast 100 frei gewählten Abgeordneten im deutschen Parlament sitzt. Das gilt nicht fürs Inhaltliche. Thematisch ist – vielleicht noch mehr als bisher – entschiedener Widerspruch erforderlich, wo die rechte Programmatik den politischen Grundintuitionen der biblischen Botschaft zuwider läuft. Aber bitte, möchte man den Kirchen zurufen, tut dies nicht mehr in der Haltung des beleidigten Kindes, das nicht mitspielen will und den anderen die Schaufel hinwirft! Oft hatte man diesen Eindruck, wenn von kirchlicher Seite der neue politische Akteur aus der Position der überlegenen moralischen Instanz abgestraft wurde. Tut es lieber mit der souveränen Geste des besseren Arguments: Sagt ihnen und den ihren, wo sie irren, sagt es deutlich und mit euren guten Argumenten. Denn so wahrt ihr die Chance, dass die Wählerinnen und Wähler dieser Partei Euch zuhören und vielleicht merken, wem sie besser folgen sollten.
—
Daniel Bogner ist Mitglied der Redaktion von Feinschwarz. Er lehrt an der Universität Fribourg / Schweiz und befasst sich mit Themen der politischen Ethik.
Bild: Dieter Schütz / pixelio.de