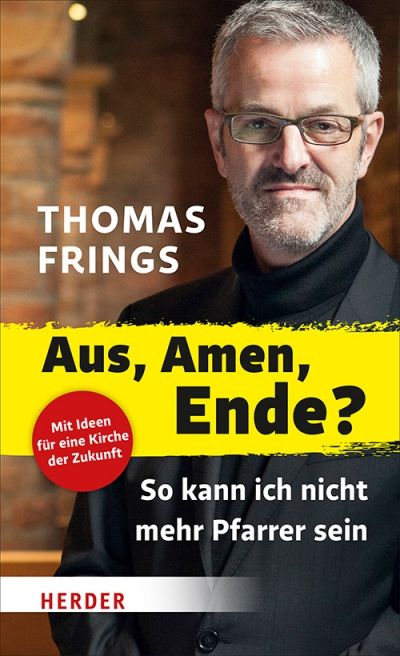Stark beachtet wurde die „Kurskorrektur“ von Pfarrer Thomas Frings aus Münster. Nach einem guten Jahr legt er nun ein Buch mit vertieften Beobachtungen und Überlegungen vor. Jan Loffeld stellt die Grundzüge vor und beginnt eine kritische Weiterführung.
Erkenntnisse und Diskursanzeigen
Als die feinschwarz.net-Redaktion eine Besprechung des neuen Buches von Thomas Frings anfragte, weckte dies spontan Erinnerungen an die Reaktionen auf seine „Kurskorrektur“ aus dem Frühjahr 2016. Etwa an die Kommentare einiger seiner pastoralen Kolleg*innen, die von „Der spricht mir aus dem Herzen“ bis „Da hatte wohl jemand die falschen Erwartungen“ reichten. In jedem Fall kann die überregionale innerkirchliche und theologische Aufmerksamkeit im Frühjahr 2016 als Indiz dafür gelten, dass Frings mit seinem Amtsverzicht und insbesondere mit dessen Begründung einen pastoralen Nerv getroffen hat.
„Der spricht mir aus dem Herzen“ und „Da hatte wohl jemand die falschen Erwartungen“
Ein Jahr danach legt er nun vertiefte Gedanken in Form von verschiedenen Rückblicken auf seine mittlerweile 30 Jahre in der Seelsorge vor und ergänzt diese gegen Ende durch einen eigenen Gemeindeentwurf. Damit steht Erfahrungsperspektive vor Metadiskurs – das macht`s pastoraltheologisch interessant.
Schon der Titel provoziert: „Aus. Amen. Ende?“ Wohltuend ist, dass Frings im Untertitel seine Gedanken gleich vorab als seine persönliche Perspektive deklariert: „So kann ich nicht mehr Pfarrer sein“. Der Stil ist anschaulich-erzählend, sehr ehrlich und häufig fragend. Auch das hält Perspektiven offen. Matrix bleiben die Themen seiner „Kurskorrektur“: Gläubigenschwund, religiöse Indifferenzen, geringe institutionelle Wirksamkeit in der Verkündigung, schließlich: pastorale Vergeblichkeit.
„Aus. Amen. Ende? So kann ich nicht mehr Pfarrer sein“
Frings verdeutlicht an unterschiedlichen pastoralen Erwartungen und Prämissen, wie sich diese im Laufe seiner seelsorglichen Tätigkeit als Illusionen herausgestellt haben: dass irgendwann alles besser würde (Visionen in den 1980ern), wie wenig wissenschaftliche Expertisen, pastorale Planungen („wohlklingende Etiketten“; 41) oder Struktur- und Partizipationsveränderungen das Grundproblem wirklich lösen konnten: denn es warten offenbar nicht alle Menschen darauf, in lebendigen, ausstrahlenden Gemeinden ihren christlichen Glauben leben zu können.
Nein, die Wirklichkeit ist als mehrdeutiger und ungleichzeitiger zu bewerten: seien es beharrungskräftige Ansprüche innerhalb des kirchlichen Engagements, traditionelle, beinahe volkskirchliche Erwartungen in der Sakramentenpastoral, die von alles anderem als Entschiedenheit im Glauben sprechen, sei es das unverzüglich schwindende Bedürfnis nach der sonntäglichen Eucharistie, wenn diese nicht mehr zur angestammten Wunschzeit stattfinden kann. Menschen nehmen das Angebot nicht so an, wie es gemeint ist. Viele kommen sogar mit einer eigenen Anspruchshaltung, die früher oder später fast jeden pastoralen Idealismus untergräbt.
Eigene Anspruchshaltungen der Menschen und pastorale Ansprüche
Frings betont bereits im Vorwort, dass er sehr gerne Priester und dies auch in dieser Kirche ist. Freilich kann man an der Kirche manches aussetzen und auch der Zölibat ist nicht wirklich zu plausibilisieren, wenn evangelische Pfarrer mit Familie konvertieren und ein katholischer Priester zeitgleich wegen seiner Heirat aus dem Amt scheiden muss. Aber um solche Fragen geht es Frings nicht im Kern. Ebenso differenziert er das allfällige Vorurteil, dass kirchliche Arbeit immer nur schlecht oder das `Bodenpersonal´ häufig unerträglich sei, denn auch dagegen steht die Erfahrung: wer sich pastoral noch so viel Mühe gibt, auf ein sichtbares Ergebnis wartet jede*r im Sinne „einer Folgenlosigkeit der Sakramentenspendung“ (77) in den meisten Fällen vergebens. Dies macht Frings anhand verschiedener Beispiele aus der Tauf- und Ehepastoral, sowie aus den Katechesen zu Erstkommunion, Buße und Firmung anschaulich und verdeutlicht damit: innerhalb der Transformationsprozesse von Glaube und Kirche herrscht eine große Ratlosigkeit, wenn nicht gar Ohnmacht. „Sind wir also Zeugen einer doppelten Pastoral der Vergeblichkeit?“, schreibt er resümierend, „Vergeblich in den unglaublichen Bemühungen der Haupt- und Ehrenamtlichen bei der Verkündigung in der Gesellschaft unserer Tage und vergeblich in den Bemühungen bei uns selbst, Neuland unter den Pflug zu nehmen?“ (138f.)
„Sind wir also Zeugen einer doppelten Pastoral der Vergeblichkeit?“
Zugleich scheint neben Kritik ein wenig Verständnis durch: „Anspruch und Zuspruch, Kunde und Teilhaber, von allem ist auch etwas in mir.“ (119) Und er verweist darauf, dass selbst die Botschaft des Evangeliums mehrdeutiger ist, als man es bisweilen gerne hätte, gesteht aber ehrlich: „Eine eindeutige Klarheit wäre mir manchmal zwar lieber und in jedem Fall wäre es dann etwas leichter“ (129).
Schließlich möchte er den Anspruch vom Anfang einlösen: „An der Krise der Gemeinde können wir etwas tun. Müssen wir etwas tun.“ (29) Denn: „Haben wir ein Modell für eine veränderte Welt und Kirche, in der immer weniger Menschen Gemeindechristen sind und sein wollen?“ (148) Es müsste eine territorial weitgehend entkoppelte „Entscheidungsgemeinde“ (145-170) sein, die nach dem Prinzip der Sehnsucht geformt werde.
„Arche-Gemeinden“
Frings nennt sie „Arche-Gemeinden“. Sie sollte gestufte Formen der Beteiligung zulassen und plurale Angebote machen, die nicht für jede*n passen können und wollen, da sie sich auszeichnet durch Ungleichzeitigkeit und Individualität. Zugleich würde Schluss gemacht mit „einem Sakramentenautomatismus, der viel zu selten Entscheidungen und Gewissheiten folgt, sondern Geburtsjahrgängen und Stichtagen“ (155). Kriterium ist die Entschiedenheit, nicht „Indifferenz, sondern Differenz“. (158) Einerseits zeichnet sich eine solche neue Gemeindeform durch eine hohe Offenheit aus, zugleich werden die Sakramente, insbesondere die Taufe, an eine bewusste Entscheidung aus Glauben und Zugehörigkeitswillen getroffen. Eine solch neu zu gründende Gemeinde ist daher bewusst nicht mehr Volkskirche, sondern „Kirche im Volk“ (166).
Nicht mehr Volkskirche, sondern „Kirche im Volk“
Thomas Frings hat gerade mit dem letzten Teil den Ball in das Feld einer reflexiv arbeitenden Pastoraltheologie gespielt. Aus dieser Sicht sind seine differenzierenden Gedanken angesichts der pastoralen Praxis innovativ, weil sie postmoderne Realitäten konzeptionell ernstnehmen. Das Modell erinnert an katechumenale Stufungen, die in vielen Situationen auch heute gelebten (Un-)Glaubensrealitäten entsprechen könnten und für deren Realisierung sich gerade innerhalb der Sakramentenpastoral ein weites künftiges Diskurs- und Experimentierfeld eröffnet.
Ein zentrales Scharnier dieser Konzeption besteht darin, Taufe bzw. Sakramentenempfang und Kirchenzugehörigkeit auseinandertreten zu lassen – ähnlich den Katechumenen, die ja im Fall des frühen Märtyrertodes in der Urkirche als Getaufte galten. Dies wiederum könnte eine wichtige Referenz in der inklusiv angelegten Volk-Gottes-Theologie der Kirchenkonstitution des II. Vatikanums finden.
Taufe und Kirchenzugehörigkeit auseinandertreten lassen
Die entscheidende Frage ist nur, ob ein solches Stufenmodell praktikabel ist. Denn viele wissen immer noch sehr gut – und darin sind interessanterweise volkskirchliche Strukturen weiterhin sehr lebendig – dass sie etwa die Taufe und damit das `Beste´ für ihr Kind wollen (und wer könnte ihnen dies verdenken?). Hier kommt die Kategorie der Entschiedenheit ins Spiel. Lässt sich wirklich ein objektivierter Kriterienkatalog ermitteln und nach außen verständlich machen, was eine „gelebte Form der Sakramente“ (149) genau meint? Gerade, wenn Grundeinsichten nicht mehr geteilt oder verstanden werden? Auch hier kann vielleicht das Konzil weiterhelfen. Das Volk Gottes existiert aufgrund der alleinigen Entscheidung Gottes für seine Schöpfung und diese ist zunächst bedingungslos.
Das Volk Gottes existiert aufgrund der alleinigen Entscheidung Gottes für seine Schöpfung. Diese Entscheidung ist bedingungslos.
Das erste Kriterium für die Zugehörigkeit ist somit die Berufung jedes Menschen durch Gott. Wäre nicht im Zweifel dieser unbedingte Heilswille Gottes, wie das Konzil es tut, gerade in seiner Grenzenlosigkeit höher einzustufen als von außen niemals gänzlich vermessbare Entscheidungsintensitäten? Die Taufe wäre so bejahendes – oder klassischer formuliert – gnadenvolles und unverdienbares Geschenk, Entschiedenheit hingegen eine freigelassene, idealerweise zu begleitende Konsequenz daraus. So würde auch deutlich, dass keine Gemeinde, keine Kirche und kein Priester die Sakramente besitzt, sondern die Kirche dazu da ist, einer gelingenden Begegnung zwischen Mensch und Gott zu dienen, nicht sie zu beurteilen. Innerhalb einer weithin diversifizierten Kultur, in der die meisten Menschen gemeindlichen oder kirchlichen Idealen nicht entsprechen (wer tut das schon immer?), könnten diese Perspektiven womöglich hilfreich sein.
Die Kategorie der Entschiedenheit muss daher spätestens heute mit einer hohen Freiheits- und Ambiguitätsfähigkeit einhergehen, damit sie nicht am Ende doch alte Rigorismen dupliziert bzw. pastorales Handeln von außen dahingehend missverstanden wird. Denn: unsere Zeit ist alles andere als immer nur eindeutig, das Evangelium allerdings – wie Frings ja schreibt – ebenfalls.
Die Kirche ist dazu da, einer gelingenden Begegnung zwischen Mensch und Gott zu dienen, nicht die Beziehung zu beurteilen.
Das führt zu einem zentralen Subtext, der im Band immer wieder durchscheint: Auch die faktische Religiosität vieler Zeitgenoss*innen rangiert zunehmend in einem eher uneindeutigen „Dazwischen“ (Stichworte: Engel- oder Hybridreligion) bis hin zu deutlichen Indifferenzen, was insbesondere in der Kasual- und Sakramentenpastoral zu jenen Fremdheiten führt, die Frings beschreibt. Auch hier den Freiheitsgedanken wertungsabstinent durchzuhalten und in ihn hinein die Lebensangebote des Evangeliums glaubwürdig anzubieten, oder besser: gemeinsam zu entdecken, ist vermutlich eine der wesentlichen pastoralen Herausforderungen der Gegenwart.
Dabei entlastet auch die Erfahrung: Die wenigsten Kasualchrist*innen sind auf böswillige Weise religiös unmusikalisch. Manche*r Seelsorger*in ist sogar dankbar für eine Taufe, Trauung, Trauerfeier oder einen Firmkurs, weil sich darin ungeplant etwas ereignen kann, was im routinierteren Gemeindetrott nicht zwangsläufig vorkommt: Kontakte zu Menschen, die ganz anders ticken, unvermittelt großes Vertrauen aufbringen, oder völlig unbefangen von ihren Zweifeln oder Erfahrungen mit Gott reden.
Grautöne ressourcenorientiert wahrnehmen
So kann auch der Zwischenbereich, wo er gleichzeitig ungeschönt-realistisch und ressourcenorientiert wahrgenommen wird, Überraschungen bereithalten und zu einem zukunftsträchtigen pastoralen Lernort werden, gerade bei der Suche nach einer katechumenal orientierten Pastoral. Zugleich wird man wahrscheinlich damit leben müssen, dass innerhalb einer heterogen-diversifizierten Kultur immer Fremdheiten und Unvermittelbarkeiten bleiben können. Dies alles zeigt an, dass es nicht mehr die eine Lösung oder das einzig wirksame Konzept für jede pastorale Situation geben kann und darf – genau diese Realität versucht Frings ja in sein Gemeindekonzept hineinzudenken. Insgesamt könnte daher in der Pastoral vielmehr die Perspektive der/des Einzelnen und ihrer bzw. seiner Geschichte mit Gott vor aller kirchlichen Norm oder gemeindlichen Erwartung an Bedeutung gewinnen.
Kirche als Begleiterin, nicht als Richterin
Interessanterweise wird dies für die Ehe- und Familienpastoral derzeit infolge von Amoris laetitia zu denken begonnen. Zweifelsohne wäre es der anspruchsvollere und aufwändigere Weg; aber auch hier versteht sich die Kirche in erster Linie als Begleiterin, nicht als Richterin.
Diese wenigen Gedanken zeigen: Das neue Buch von Thomas Frings reizt zum Weiterdenken. Es kann auf anschauliche Weise belegen, wo der Schuh derzeit für viele drückt, wo Aporien bestehen und wo Diskurse angegangen werden müssen. Vor allem aber zeigt es, wie häufig die Wirklichkeit über der Idee steht (vgl. EG 231-233).
—
Jan Loffeld ist Habilitand in Pastoraltheologie und Priester der Diözese Münster.
Buch: Thomas Frings: Aus, Amen, Ende? So kann ich nicht mehr Pfarrer sein, Freiburg i.Br. 2017.
Bilder: Buchcover