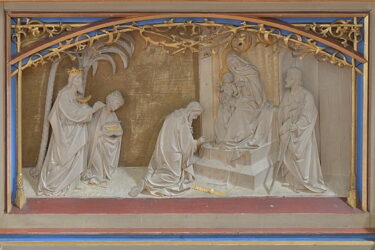Wer Engel beschreiben will, dem entziehen sie sich. Das ist ein Paradox religiösen Redens, können Menschen von Transzendentem doch nur im Raum bedeutungsoffener Bilder sprechen. Eben dorthin führen den Dichter und Theologen Christian Lehnert die Engel. Christoph Gellner über das neue Buch des «gegenwärtig bedeutendsten christlichen Autors Deutschlands» (MDR).
«Engel sind Gesten in der Bewegung», streicht Christian Lehnert (*1969) in seinem neuen Prosabuch «Ins Innere hinaus. Von den Engeln und Mächten» heraus, «sie verweisen auf etwas anderes, als sie sind. Gerichtet auf ein Hinaus aus der Welt und auf ein Hinüber haben sie einen Zeichencharakter […] Nur, wer kann sie entschlüsseln?»[1] Nach Essays über Paulus‘ «Korinthische Brocken» (2013) und «Der Gott in einer Nuß. Über Kult und Gebet» (2017) erschien 2018 Lehnerts siebter Gedichtband «Cherubinischer Staub», der schon im Titel auf den Mystiker Angelus Silesius anspielt. Die paarweise gereimten Sinnsprüche des «Cherubinischen Wandersmann» haben Lehnert auch formal inspiriert.
«Das große Thema der Religion, die ‘andere Seite’»
«’Gehe hinüber’», lässt Kafka in seiner Prosaminiatur «Von den Gleichnissen», die Lehnert aufruft und ausdeutet, einen Weisen sehr unbestimmt sagen: «Die Pragmatiker, die darauf schauen, ‘womit wir uns jeden Tag abmühen’, die Diesseitsmenschen, bleiben auf der Stelle. Sie halten das ‘Drüben’ für generell nutzlos, ohne es zu kennen. Aber die religiösen Ideologen verharren ebenso, weil sie dogmatisch das ‘Drüben’ bereits ‘hierher’ geholt zu haben meinen in ihre ‘religiösen Wahrheiten’. Nein, was der Weise anzubieten hat, ist nur eine Zeigegeste: ‘Dahin!’, über die Grenze, über den Horizont […] Ohne zu wissen, wohin, aber gehen: Das ist eine uralte spirituelle Erfahrung […] ‘Dahin!’, die Wortgeste, ‘Gehe hinüber’ – so hören sich die unaussprechlichen Namen von Engeln an.»[2]
‘Dahin!’, über die Grenze, über den Horizont
Dieser für Engel charakteristische Bewegungscharakter kennzeichnet auch das Gebet. Im Verweis auf die Gebetspraxis griechischer Athosmönche betont Lehnert im Nachwort seiner Anthologie «Gebete der Menschheit» (2019): «Jeder Gedanke an irgend etwas wird zurückgebunden an den einfachen Puls des Lassens und Empfangens. Vor der Sprache liegt der Atem. Von ‘hier’, aus dem Innersten, weist die Geste nach ‘dort’.» Beten hat daher einen poetischen Zug: «Wie das Gedicht ist das Gebet an der Grenze der vertrauten Sprache unterwegs und erkundet Räume, wo die Worte noch fehlen.»[3]
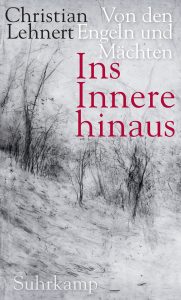
Wir sind hier im Zentrum von Lehnerts Denken und Schreiben[4]: «Das Gedicht findet zu sich selbst in einem suchenden Sprechen. Ein Leser führt diesen Impuls fort, wenn die Bilder und die Klänge der Wörter in ihm unmittelbar wirklich werden, und er staunt über ‘das schöpferische Vermögen des redenden Seins’ (Gaston Bachlard). Das Gedicht führt ihn in seine eigene Fremde, und, wenn es gut geht, ins Offene der Welt. Ähnlich ist es mit dem Gebet, sobald es in einem sprachlichen Gewand auftritt. Ein betender Mensch spürt immer die Unzulänglichkeit seiner Ausdrucksformen. Jedes Wort zeigt so viel, wie es verbirgt. ‘Gott’ wird für den Betenden wirklich in Sprachbildern und im Seelentaumel der Meditation, und zugleich verschwindet ‘ER’ darin, und der Betende erlebt Gottesnähe und Einsamkeit in einem Atemzug, als ein Suchen und Sehnen.»[5]
«Lauschen ins Offene, das mit dem Wort ‘Gott’ aufbricht»
Warum heute über höhere Mächte nachdenken? «Ich lebe in einer entzauberten Welt, aber sie faßt und hält mich nicht ganz», schreibt Lehnert. «Ich muß keine Angst haben vor dem Unerklärlichen und habe doch Angst – vor den allgegenwärtigen Erklärungen, die mich absichernd in sich einschließen. Es ist dieser merkwürdige Schwebezustand, der mich nach numina fragen lässt. (Während doch um mich her die professionellen Mittler der Transzendenz, die Kirchen und ihre Theologie, sich ihrer Begriffe meist viel zu gewiß sind und ich mich mühen muß, mit ihnen zu glauben. Ich meine damit: lauschen ins Offene, das mit dem Wort ‘Gott’ aufbricht, lauschen und hoffen.)»[6]
„Ich lebe in einer entzauberten Welt“
«Engel schirmten einst die Gottheit ab – Antiköper, ein schwärmender Wall. Wächterengel sogen auf, was allzu Menschliches in die Gottesvorstellungen eindrang. Sie hielten die Transzendenz rein, fegten sie aus». Gut nachfühlbar, dass Lehnert diese «Schutzgeister der Gottesfurcht» heute vermisst:
«Sie könnten den Gott unbelästigt halten von den vielen Überfällen einer geborgenheitsheischenden Wohlstandsfrömmigkeit. Allen übergriffigen Sprachschmutz könnten sie aufzehren als rege Abwehrzellen, welche die Keime diesseitiger Erwartungen von Glück und höherer Selbstbestätigung abbildend zersetzten. Wir entbehren ihre reinigenden Zuarbeiten, die in Spiegelungen geschahen, in der Gestalt von dienstbaren, wohlmeinenden Schutzengeln und freundlichen Lebensbegleitern, die allen, die es bedurften, jederzeit und überall zuflüsterten: ‘Du bist geliebt und gut, so wie du bist!’ Sie konnten Gott davor schützen, daß ihm solche Worte in den Mund gelegt wurden.»
Schutzengel und freundliche Lebensbegleiter
Lehnerts Fazit? «Die Engel, Bewohner der Grenzen, die Resonanzgestalten, die einst im unsicheren Zwischenreich von Mensch und Gott pulsierten, sind verflogen. Es ist winterlich still geworden in der geistigen Welt. Zurück ließen sie die leblosen Spuren ihrer selbst, den Engelsramsch und die rasant wachsenden Populationen der niedlichen esoterischen Dienstleister, die für Wohlbehagen sorgen». Diese Zeitkritik ist wenig originell, doch liegt ihr eine ganz eigensinnige Diagnose zugrunde: «Nicht die Engel verfielen, sondern die Sinne der Menschen, wenn sie nach innen gerichtet waren.»[7]
«Ein Engel ist eine Chiffre für die Erscheinungsweise der Transzendenz als Überschreitung.»
Eindringlich verdeutlicht Lehnert die titelgebende Grundgeste des Buchs an der Gottesvision des Propheten Ezechiel («auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch», Ez 1). Demnach käme «die erschütterndste Offenbarung aus dem Inneren des Menschen, dorther, wo er nichts von sich weiß, ‘innerer als mein Innerstes’, interior intimo meo (Augustinus) […] die Gottheit, die sich mir zeigt, ein Tiefenselbst als unendlicher Raum.»[8]
Gerade in den biblischen Erzählungen – das zeigt Lehnert in erhellenden Exegesen von Jesus in Gethsemane über Hagar und Jakob bis zu Elija – werden Engel «als bestimmende fremde Kräfte im Innern erlebt. Engel tragen […] in sich selbst den Riß zwischen dem antwortenden Verstehen, das sie als etwas erfasst, und dem Einstich des Unbekannten […] Sie sind sagbar, indem sie auf das Unsagbare zeigen – und darin verschwinden. Ein Engel ist eine Chiffre für die Erscheinungsweise der Transzendenz als Überschreitung.»[9]
Engel sind sagbar, indem sie auf das Unsagbare zeigen.
Die Crux allen Nachsinnens über eine Körperlichkeit der Engel, die als «Zwischenwesen» neben Gott und Mensch «sträflich verharmlost» würden, so Lehnert? Sie «fallen als Kreaturen entweder schwerfällig zurück auf die Seite der Menschen, oder sie schweben haltlos davon ins unvorstellbare All-Nichts der Gottheit […] Besteigen wir ein anderes Vehikel: Engel sind Bewegungsformen, keine umschriebenen Körper. Sie ziehen unentwegt ‘hinüber’, treiben in die Transzendenz oder vor ihr her, ohne jemals anzukommen.» Aphoristisch zugespitzt: «Engel sind Kurzschlüsse, blitzartig gezündet zwischen unvereinbaren Polen, als Wunder, Unvorhersehbares, als Verwandlungskräfte. Sie durchschlagen schockartig die gewohnten Verläufe.»[10]
«Jeder Glaubende dichtet und bildet sich seinen Gott. Poesie ist dem Glauben zu eigen wie der Atem dem Leben.»
Luther beschrieb den Menschen als «ein Tier mit Vernunft und einem Herzen, das dichtet, das Bilder findet und ‘fingiert’», zitiert Lehnert in einem weiteren der 52 Textabschnitte den sprachsensiblen Reformator. «In dieser dissonanten Formulierung senkt Luther den Menschen ganz ins Tierhafte ein und findet ihn zugleich in einer anderen Sphäre, sieht ihn mit den Engeln, den Boten aus dem Zwischenreich des Möglichen und Verborgenen, flanieren ins noch Ungewordene.»
Die theopoetische Pointe dieser «Lutherischen Einbildungen»? «Der Mensch ist nicht nur ein Lebewesen mit Vernunft […] er ist zugleich nicht ganz in der Gegenwart der Fakten, in den Analysen und im Machbaren zu Hause; seine Fühler streckt er ins Imaginäre, in ein Dichten und Bilden und Schauen des noch nie Gesehenen, des Undenkbaren. Das betrifft bei Luther auch den Kern der religiösen Existenz: ‘Fides creatrix divinitatis’, sagt er, der Glaube ist der Schöpfer der Gottheit. Jeder Glaubende dichtet und bildet sich seinen Gott, seine Gottesvorstellung. Poesie ist dem Glauben zu eigen wie der Atem dem Leben. ‘Gott’, das ist eine riesige Galerie von Bildern, fiktiv und schön, die soviel sichtbar macht, wie sie verbirgt.»[11]
Poesie ist dem Glauben zu eigen wie der Atem dem Leben.
«Das Gebet bringt sein ‘Du’, seinen Gott hervor – als eine Art Wegweiser», verdeutlicht Lehnerts Anthologie. «In dem ‘Gott’ eingeschlossen ist der, der ihn zu ‘Gott’ macht, indem er ihn anbetet. ‘Gott ist nicht an sich ‘Gott’, sondern er wird es durch die Betenden. Das heißt nun nicht, daß Beten ein rein selbstreflexiver Vorgang wäre. Der Gang ‘hinüber’ – so bezeugen es zumindest Gläubige – führt nicht in einen Kreis, sondern ist erfaßt von einem Sog, einem Ruf, aber wo es hingeht, weiß der Betende noch nicht zu sagen. Er formt eine Vorstellung davon, den ‘Gott’, eine Wegmarke – und dazu braucht er Sprache und Bilder, Musik und Riten. Übung und Zweifel bilden das Schrittmaß.»[12]
«Eine Urresonanz leitet die Stimmen der Engel: Niemand ist für sich, doppelchörig ist alles Leben.»
Vom poetischen Prinzip der hebräischen Psalmen, dem parallelismus membrorum, kommt Lehnert im Abschnitt «Musica» zur Doppelchörigkeit von Engel und Menschen, die «eine Grundtatsache aller Existenz» in eine Szene übersetze: «Niemand wird allein geboren. Alles, was ist und sich seiner bewußt wird, hat einen Umraum, ein Gegenüber, eine Begleitung […] Engel, als Erstlinge der Schöpfung, verbleiben im ursprünglichen Dual aller Existenz […] Ein religiöser Grundton, eine Urresonanz leitet die Stimmen der Engel: Niemand ist für sich, wie auch ein Engel nicht für sich ist, sondern gespiegelt in einem anderen, der oder das mit ihm erscheint und dem er sich in seinem Erscheinen verdankt. Ein Ton wird nur wirklich, wenn er irgendwo schwingt – wenn sich also ein Gehör findet. Und der Hörende weiß von sich als Hörendem nur durch fremden Gesang. Doppelchörig ist alles Leben, gesungen von einem zum anderen.»[13]
___
Christoph Gellner, Dr. theol., ist Leiter des Theologisch-pastoralen Bildungsinstituts der deutschschweizerischen Bistümer in Zürich und Experte für Literatur und (Welt-) Religion(en).
Beitragsbild: Odin Aerni /unsplash.com (Messe Basel, Gebäude von Herzog & De Meuron)
[1] Christian Lehnert: Ins Innere hinaus. Von den Engeln und Mächten, Suhrkamp: Berlin 2020, 21f.
[2] Ebd., 24f.
[3] Gebete der Menschheit. Ausgewählt, erläutert und mit einem Nachwort von Christian Lehnert, Berlin 2019, 127-129.
[4] Vgl. das Lehnertporträt in: Christoph Gellner: Die Bibel ins Heute schreiben. Erkundungen in der Gegenwartsliteratur, Stuttgart 2019, 204-218.
[5] Gebete der Menschheit, 129.
[6] Ins Innere hinaus, 21.
[7] Ebd., 139 u. 65.
[8] Ebd., 69.
[9] Ebd., 23.
[10] Ebd., 13f.
[11] Ebd., 142.
[12] Gebete der Menschheit, 128.
[13] Ins Innere hinaus, 92f.
Von Christoph Gellner auf feinschwarz.net zuletzt erschienen:
«An den Ursprung der Wörter zurück»: Durs Grünbein liest die Bibel