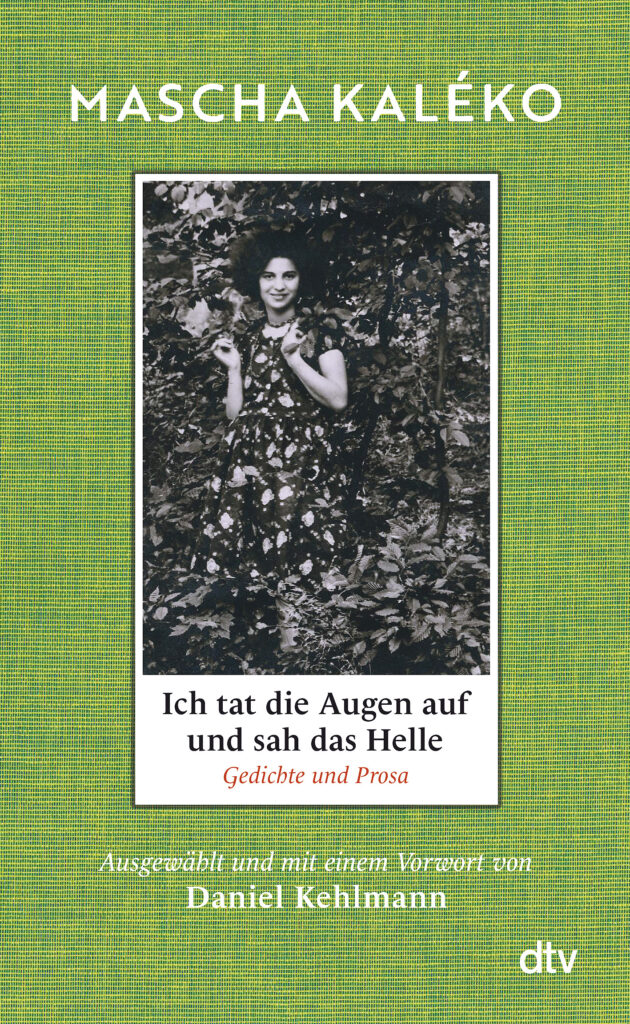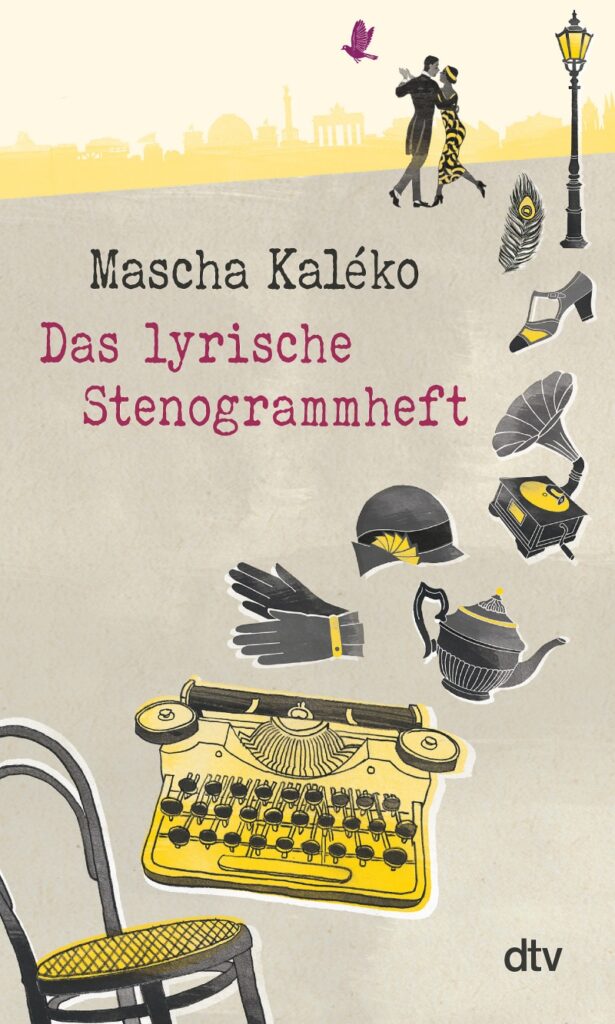Mit Mascha Kaléko geht Uwe Michler einer häufig übersehenen, faszinierenden Dichterin des 20. Jahrhunderts nach. Ihr wurden in den letzten Jahren literarische und musikalische Denkmale gesetzt.
Vor wenigen Jahrzehnten war Mascha Kaléko im Literaturbetrieb fast vergessen. Bis in die 1990er Jahre hinein hatte die deutschsprachige Schriftstellerin jüdischen Glaubens weder in Kindlers Literaturlexikon noch in anderen einschlägigen Lexika einen Eintrag. Doch in den letzten Jahren erlebt sie eine Renaissance. Und zu ihren 50. Todestag in der vergangenen Woche, am 21. Januar 2025, sprach die Süddeutsche Zeitung von ihr als der „beste[n] deutschen Exillyrikerin“.
Nirgendwo wirklich zuhause.
Das Schauspiel Frankfurt/M. hat gerade ein Stück über ihr Leben und Werk auf die Bühne gebracht: „Mascha K. (Tourist Status)“, das schon im Titel zu erkennen gibt, dass sie nirgendwo wirklich zuhause ist. Und die Liedermacherin Dota Kehr hat auf zwei Alben (2020 „Mascha Káleko“ und 2023 „In der fernsten der Fernen – Mascha Káleko 2“) viele ihrer Gedichte vertont und mit dazu beigetragen, dass sie auch wieder einem breiteren Publikum wurde. Darüber hinaus hat der Schriftsteller und unermüdliche Literaturvermittler Daniel Kehlmann gerade ein Buch mit Gedichten und Prosa von ihr herausgegeben und sie in einem Vorwort einfühlsam gewürdigt.[1]
Geboren wurde Mascha Káleko 1907 als älteste Tochter eines russischen Vaters und einer österreichischen Mutter in der galizischen Kleinstadt Chrzanów, keine 20 Kilometer von Auschwitz entfernt.
Im Gedicht „Interview mit mir selbst“ schreibt sie:
Ich bin als Emigrantenkind geboren
In einer kleinen, klatschbeflißnen Stadt,
Die eine Kirche, zwei bis drei Doktoren
Und eine große Irrenanstalt hat.
Mein meistgesprochnes Wort als Kind war »Nein«.
Ich war kein einwandfreies Mutterglück.
Und denke ich an jene Zeit zurück –
Ich möchte nicht mein Kind gewesen sein.[2]
Als Mascha sieben Jahre alt ist, verliert sie ihre vertraute Umgebung. Viele osteuropäische Juden verlassen damals aus Angst vor Armut oder Pogromen ihre Heimat. Die Familie emigriert 1914 nach Deutschland – zunächst nach Frankfurt, dann 1916 nach Marburg und 1918 schließlich nach Berlin. Das Gefühl von Heimatlosigkeit wird sie noch ein Leben lang begleiten – und ist eines der zentralen Themen in ihren Gedichten.
Wohin ich immer reise,
Ich fahr nach Nirgendland.
Die Koffer voll von Sehnsucht,
Die Hände voll von Tand.
So einsam wie der Wüstenwind.
So heimatlos wie Sand:
Wohin ich immer reise,
Ich komm nach Nirgendland.[3]
In Berlin geht Mascha aufs Gymnasium, verlässt es aber 3 Jahre vor dem Abitur und wird Büroangestellte, eine Arbeit, die sie nicht ausfüllt. Nebenbei schreibt sie Gedichte, die das alltägliche Lebensgefühl im Berlin der ausgehenden 1920er und beginnenden 1930er Jahre spiegeln.
Ab 1929 veröffentlicht sie ihre Gedichte in verschiedenen Berliner Zeitungen. Anfangs werden die Verse der Dichterin noch von manchen Kritiker*innen als naive „Gebrauchslyrik“ und zu schlicht und verständlich abgestempelt. In dem Gedicht „Kein Neutöner“ kokettiert sie selbstbewusst mit ihrem Stil:
Ich singe, wie der Vogel singt
Beziehungsweise sänge,
Lebt er wie ich, vom Lärm umringt,
Ein Fremder in der Menge.
Gehöre keiner Schule an
Und keiner neuen Richtung,
Bin nur ein armer Großstadtspatz
Im Wald der deutschen Dichtung.
Weiß Gott, ich bin ganz unmodern,
Ich schäme mich zuschanden:
Zwar liest man meine Verse gern,
Doch werden sie – verstanden!
Aber insgesamt genießt sie schon von Anfang an hohes Ansehen als Lyrikerin, wird beispielsweise von Thomas Mann und Herrmann Hesse gelobt und bewundert und gilt manchen als „weiblicher“ Heinrich Heine, Erich Kästner oder Kurt Tucholsky.
Die Liebe als
eigentliche Heimat
Sie erobert sich rasch ein großes Publikum in Berlin und wird ein literarischer „Star“ mit ihren leicht zugänglichen und unbeschwerten Gedichten, die manchmal auch ironisch gebrochen und melancholisch sind – aber niemals oberflächlich.
Und sie schreibt auch ergreifende Liebesgedichte – die Liebe ist für sie die eigentliche Heimat. Manche dieser Gedichte sind wunderschön von Dota Kehr vertont – z.B. das Gedicht „Für Einen“:
Die Andern sind das weite Meer.
Du aber bist der Hafen.
So glaube mir: kannst ruhig schlafen,
Ich steure immer wieder her.
Denn all die Stürme, die mich trafen,
Sie ließen meine Segel leer.
Die Andern sind das bunte Meer,
Du aber bist der Hafen.
Du bist der Leuchtturm. Letztes Ziel.
Kannst Liebster, ruhig schlafen.
Die Andern … das ist Wellenspiel,
Du aber bist der Hafen.[4]
Und sie nimmt auch die ungeheure Armut und soziale Ungerechtigkeit im Berlin der Goldenen 1920er Jahre und der Wirtschaftskrise danach literarisch auf, wenn sie über die „Kinder reicher Leute“ schreibt (1930/33):
Sie wissen nichts von Schmutz und Wohnungsnot,
Von Stempelngehn und Armeleuteküchen.
Sie ahnen nichts von Hinterhausgerüchen,
Von Hungerslöhnen und von Trockenbrot. […]
Sie kommen meist mit Abitur zur Welt.
-Zumindest aber schon mit Referenzen –
Und ziehn daraus die letzten Konsequenzen:
Wir sind die Herrn, denn unser ist das Geld.
Mit Vierzehn finden sie, der Armen Los
Sei zwar nicht gut. Doch werde übertrieben – -.
Mit vierzehn schon! – Wenn sie noch vierzehn blieben.
Jedoch die Kinder werden einmal groß…[5]
1933 erscheint ihr erster Gedichtband „Das lyrische Stenogrammheft“ und 1934 ihr „Kleines Lesebuch für Große“, aber danach kann sie in Nazideutschland nicht mehr publizieren. Nachdem sie sich von ihrem ersten Mann, dem Journalisten Saul Kaléko, trennt, lebt sie seit 1935 mit Chemjo Vinaver zusammen, einem Musikwissenschaftler, der vor allem in der traditionellen jüdischen (Synagogal-)Musik zuhause ist. Erst spät entschließen sie sich mit dem gemeinsamen Sohn Steven, der 1936 geboren wurde, im September 1938 zur Flucht nach New York.
In der Emigration
Sie leben unter finanziellen Schwierigkeiten in einer kleinen Wohnung in New York und Kaléko hat jetzt keinen Verleger mehr. In den USA bleibt sie eine Unbekannte, die weiter auf Deutsch ihre Verse schreibt. Im Gedicht „New York“ heißt es lakonisch:
Mich trieb von Berlin nach Amerika
Ein Abschnitt der jüngsten Geschichte
Nun sitz ich im fernen New York, U.S.A.,
Und schreibe dort – deutsche Gedichte[6]
Sie ist in den USA eine Lyrikerin, die in der Emigration für Emigranten schreibt und sich mit dem Verfassen von Werbetexten über Wasser hält.
Aber sie schreibt in den 1940er Jahren auch einige Gedichte, in denen sie sich mit „amerikanischen Problemen“ wie dem Rassismus und dem Materialismus befasste.
In der Zeit des Nationalsozialismus und der Shoah verdüstern sich ihre Gedichte zunehmend. Und im Sommer 1945 schreibt sie das Gedicht „Kaddisch“ – angelehnt an das gleichlautende jüdische Totengebet:
Rot schreit der Mohn auf Polens grünen Feldern,
in Polens schwarzen Wäldern lauert Tod.
Verwest die gelben Garben.
Die sie gesät, sie starben.
Die bleichen Mütter darben.
Die Kinder weinen: Brot. […]
Wer wird in diesem Jahr den Schofar blasen
Den stummen Betern unterm fahlen Rasen,
Den Hunderttausend, die kein Grabstein nennt,
Und die nur Gott allein bei Namen kennt.
Saß er doch wahrlich strenge zu Gericht,
Sie alle aus dem Lebensbuch zu streichen.
Herr, mög‘ der Bäume Beten dich erreichen.
Wir zünden heute unser letztes Licht.[7]
1958 erschien ihr Gedichtband Verse für Zeitgenossen, eine Sammlung von Gedichten aus den ersten Exiljahren der Lyrikerin. Darin stellt Kaléko Erinnerungen aus Berlin und Bilder und Erfahrungen aus New York gegenüber.
Nach Deutschland reist sie auch seit Mitte der 1950er Jahre immer wieder, hält Lesungen und erfährt viel Zuspruch vom Publikum.
Sie lehnt den Fontane-Preis ab
1959 soll sie mit dem Fontane-Preis der Berliner Akademie der Künste ausgezeichnet werden. Sie lehnt ab, weil deren Direktor und Jury-Mitglied Hans Egon Holthusen der SS angehörte. Die Akademieleitung allerdings zeigte dafür kein Verständnis – ihr Generalsekretär Herbert von Buttlar entgegnete ihr laut ihrer Biografin Jutta Rosenkranz in geradezu perfider Weise: „Wenn es den Emigranten nicht gefällt, wie wir die Dinge hier handhaben, dann sollen sie doch fortbleiben. […] Ich bin kein Jude und habe mindestens so viel durchgemacht wie die Juden.“ Danach hat sie nie wieder einen deutschen Literaturpreis bekommen.
1960 zieht Mascha Kaléko mit ihrem Mann nach Jerusalem, der sich dort bessere berufliche Chancen erhoffte. 15 Jahre zuvor ist hier Else Lasker-Schüler gestorben, die ebenfalls ihre letzten Lebensjahre im Exil in Jerusalem verbrachte – und beide wurden sie dort nicht heimisch und konnten nicht an ihre alten Erfolge anknüpfen. Und wie Lasker-Schüler die einzige bekannte deutsche Stimme des Expressionismus war, so war Mascha Kaléko die einzige Frau unter den Autoren der Gegenbewegung der „Neuen Sachlichkeit“, sozusagen ihre „weibliche Ikone“ im Bereich der Literatur.
Gerade ist anlässlich des 100. Geburtstags der Kunstrichtung „Neue Sachlichkeit“ in Mannheim eine großartige Ausstellung zu sehen. Der Autor und Journalist Florian Illies schreibt dazu: „Die Ausstellung ist also vor allem auch eine eindrückliche Deutschstunde. Denn das neue Menschenbild, das die Künstler in der Weimarer Republik entwarfen, war von klirrender Nüchternheit, bewusstlos gegenüber menschlichen und transzendentalen Dingen“ (Gefährlich cool, DZ, 12.12.2024).
Auf die Dichterin Mascha Kaléko trifft weder der eine noch der andere Einwand zu.
Ihren Glauben an einen Gott – manchmal kindlich-naiv, aber oft auch tastend, suchend, fragend und klagend –, hat sie niemals verloren.
1968 stirbt ihr geliebter Sohn Steven Vinajer in den USA völlig überraschend mit erst 31 Jahren. Ende 1973 stirbt auch ihr Mann Chemjo Vinaver in Tel Aviv. Wie eine Vorahnung dazu erscheint ihr Gedicht „Memento“ Ende der 1950er Jahre:
Vor meinem eignen Tod ist mir nicht bang,
Nur vor dem Tode derer, die mir nah sind.
Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind?
Allein im Nebel tast ich todentlang
Und laß mich willig in das Dunkel treiben.
Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben.
Der weiß es wohl, dem gleiches widerfuhr;
– Und die es trugen, mögen mir vergeben.
Bedenkt: den eignen Tod, den stirbt man nur,
Doch mit dem Tod der andern muß man leben.[8]
Im Juli 1974 bricht sie zu ihrer letzten Europareise auf, gibt Interviews und hält Lesungen. Zurück nach Jerusalem schafft sie es nicht mehr, sondern stirbt im „Transit“ am 21. Januar 1975 in einem Züricher Krankenhaus.
___

Uwe Michler ist katholischer Theologe und Priester. Er arbeitet als Seelsorger in Frankfurt am Main.
Titelbild: Jonny James / unsplash.com
[1] Mascha Kaléko, Ich tat die Augen auf und sah das Helle. Gedichte und Prosa, ausgewählt von Daniel Kehlmann, dtv München, 2. Auflage 2025.
[2] Mascha Kaléko, Das lyrische Stenogrammheft, Rowohlt Verlag 2007, S. 13. In einer frühen Fassung, die auch hier zugrunde liegt, heißt es in der ersten Zeile allerdings noch „Ich bin vor nicht zu langer Zeit geboren“, die Autorin liest dann später selbst in einer Rundfunkaufnahme aus dem Jahr 1963 die obige Textzeile: „Ich bin als Emigrantenkind geboren“, die auch die bekanntere Version ist.
[3] Kaléko, Wir haben keine andre Zeit als diese, a.a.O., S. 37
[4] Mascha Kaléko, Ich tat die Augen auf und sah das Helle, S. 29
[5] ebd., S. 57.
[6] Mascha Kaléko, Wir haben keine andre Zeit als diese, dtv München 2021, S. 38
[7] Mascha Kaléko, Ich tat die Augen auf und sah das Helle, S. 141f.
[8] Kaléko, Ich tat die Augen auf und sah das Helle, a.a.O., S. 242