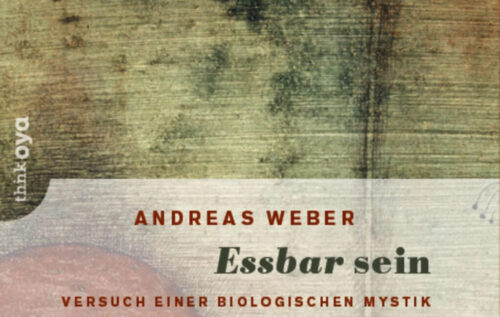Der Philosoph Andreas Weber entwirft einen „ökologischen Imperativ“: Um die planetare Krise zu überwinden, müssen wir essbar werden, so Weber. Die überraschend konservativen Seiten dieses Vorschlags beleuchtet Simone Horstmann in ihrer Rezension.
Im vergangenen Jahr musste ich miterleben, wie meine Hündin im Garten eine junge Taube auffraß, die ihr nicht schnell genug entkommen konnte. Fast hätte ich es noch geschafft, sie davon abzuhalten, aber auch ich war nicht schnell genug. Und weil sie wusste, dass ich ihr auf den Fersen war, verschlang meine Hündin die Taube hastig und beinahe in einem Stück. Fast drei Tage lag die Taube ihr samt Beinen, Krallen und Federn schwer im Magen. Die Ausbuchtung in ihrem Verdauungstrakt war überdeutlich zu erkennen. Man konnte sehen und fühlen, wie der tote Körper der Taube durch den Körper meiner Hündin wanderte – und doch nicht so recht dorthin zu gehören schien.
Weber erhebt das Essen und Fressen … zum quasi-religiösen, nämlich erklärtermaßen „mystischen“ Heilsversprechen.
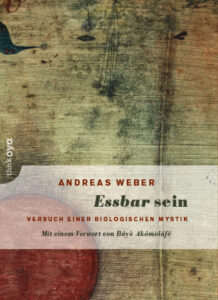
Eine poetisch-inspirierte Biophilosophie.
Das Ergebnis präsentiert sich als eine poetisch-inspirierte Biophilosophie, die nicht-reduktionistisch und nicht bloß funktional über Natur nachdenken will. Wildlebende Tiere, aber auch Berge, Bäume und Flüsse sind Gegenstand von Webers profunder Aufmerksamkeit, die er immer wieder zu ausdrucksstarken Vignetten ausarbeitet. So schreibt er etwa über Heuschrecken und Gottesanbeterinnen, dass deren Augen so gebaut seien, „dass man genau sieht, wenn sie einen fixieren. Auch wenn sie keine Pupille haben wie wir, erzeugt der Lichteinfall an der Stelle, mit der sie sehen, einen schwarzen Fleck. Der Effekt ist der gleiche. Wir wurden angeblickt – und blickten zurück. Wir fanden, und wurden gefunden. Wir suchten, und wurden gesucht.“ (91)
Anleihen bei dualistischen wie bei monistischen philosophischen Ansätzen.
In Webers angenehme Sprache und in seine klugen Beobachtungen kann man eintauchen wie in ein warmes Schaumbad. Sein Stil ist häufig von literarischer Qualität und hat einen hohen Wiedererkennungswert. Die Kosten für dieses Erlebnis sind gleichwohl immens. So ist es bereits schwer auszumachen, auf welche philosophische Position Weber sich eigentlich kapriziert – wahlweise macht er Anleihen bei dualistischen wie bei monistischen Ansätzen, verquickt und trennt diese nach eigenem Gutdünken. Er verabscheut und verwendet Dualismen gleichermaßen, wenn er etwa die westliche „Zivilisation der Trennung“ und deren „kognitive[s] Imperium“ (24) gegen das vermeintlich natürlich-allverbundene, animistische Weltbild indigener Kulturen ausspielt, wenn er von Innen- und Außenseiten spricht, und zugleich monistische Narrative aus dem Dunstkreis des New Materialism nutzt, nur um ihnen kurz darauf direkt zu widersprechen. „Die Wirklichkeit besteht aus Stoff, der sich zu Körpern zusammenballt, die sich eine gewisse Zeit in ihrer Individualität durch Raum und Zeit bewegen, bis sie auf Andere treffen, an ihnen zerplatzen, von ihnen verschlungen werden oder sich diese einverleiben“ (22), heißt es dann. Kurz darauf relativiert er: Es sei zwar wichtig, diesen Stoff zu betrachten – aber nur „um zu sehen, wie dieser Stoff in eine Innerlichkeit umschlägt“. (47) Und nochmals gut fünfzig Seiten später wird dann eine vollkommen gegenteilige Aussage getätigt: „Was ein Lebewesen ausmacht, ist eigentlich nicht die Materie, aus der es zwar besteht, die aber zu keinem Zeitpunkt die gleiche bleibt, sondern das Begehren nach Einheit und Individualität.“ (109)
Immer wieder fand ich mich beim Lesen unfreiwillig an jene Aufsteller erinnert, die man in den frühen 2000ern auf vielen Schreibtischen sah: Es waren „Sprüche-Kombinatoren“, die es über eine Ringbuch-Heftung ermöglichten, verschiedene Phrasen zu mal mehr, mal weniger sinnvollen Aussagen zu verbinden. „Das Leben ist…“ stand dann auf der einen Seite, und die andere, zufällig aufgeblätterte Seite ergänzte wahlweise „eine lange Reise“ oder vielleicht auch „ein schlechter Witz“. Im besten Fall ergab sich eine halbwegs rätselhafte Gleichung, die den Büroalltag etwas auflockerte. Auch Webers Text gehorcht auffällig häufig diesem Formprinzip: Das Leben ist „eine Wand, die eine Pforte ist“ (45), liest man etwa, „Metamorphose ist Gegenseitigkeit“ (92), „Blüte ist Hingabe“ (27). Und: „Ich selbst bin der Bach.“ (14)
Einem Band, der sich um eine poetische Sprache bemüht, ist die Tendenz zur überbordenden Metaphorisierung sicher nicht als solche vorzuwerfen. Es geht um etwas anderes: Webers gut geölte Metaphernmaschine lebt von der zentralen Ineinssetzung nahezu aller begrifflichen Diastasen wie Innen und Außen, Freiheit und Unfreiheit, Körper und Geist, 1 und 0, Leben und Tod. Diese werden allerdings nicht dialektisch verschränkt, vielmehr gilt bei Weber, dass „in Wahrheit […] alles eins“ ist (21) – es gäbe eine „umfassendere[…] Wahrheit“, die neben vielen anderen Gleichsetzungen so auch als Garant dafür einstehen soll, dass „alles Psyche [ist], weil alles Körper ist“ (79).
Sind die Begriffe erst einmal durch diesen gnadenlosen Homogenisator gelaufen, können impertinente Nachfragen von Seiten der (für Weber ohnehin heillos imperialen westlichen) Wissenschaft sofort mit dem Hinweis auf die paradoxe Struktur einer sich am Animismus berauschenden Poesie ausgehebelt werden, die begriffliche Differenzierungen in ein ungefähres Geraune aufhebt.
Und während Weber für sich beansprucht, dass dieser Verzicht auf begriffliche Präzision dem Anliegen einer nicht-reduktionistischen Weltsicht entgegenkommt, fällt oft genug eher das Gegenteil auf. Webers „mystische“ Sprache und sein Verweis auf die „heilige Natur“ (95) fügen sich bruchlos zu einem naturalistischen Biologismus und einer Lebensphilosophie mit biopolitischem Einschlag.
Dies gilt bereits für seine Referenz zur Mystik als vermeintlich religiösem Pendant zur undifferenzierten Alleinheit. So werden im Vorwort von Báyò Akómoláfé die Einsetzungsworte der Eucharistie zitiert, die kurz darauf naturalistisch umgedeutet und damit recht spektakulär in ihrer theologischen Pointe verkannt werden.
Eine naturalistische Schlagseite
Die naturalistische Schlagseite zeigt sich aber vor allem an einem anderen Punkt. Bei allen Mahnungen, die eigene Essbarkeit um der Ökologie willen anzuerkennen, geht es doch stets um eine Essbarkeit, die sich von der Essbarkeit anderer Tiere grundlegend unterscheidet. Die Essbarkeit von Menschen zielt lediglich auf den nachtodlichen Verzehr des Körpers durch Maden, Würmer, Mikroorganismen usf. – keine allzu große Konzession, wie man zugestehen muss.
Für andere Tiere hingegen bedeutet es, dass ihre Tötung als Akt der ökologischen „Metamorphose“ zu akzeptieren sei, vor allem dann, wenn die Art der Tötung möglichst natürlich wirkt – zumindest legen dies viele Äußerungen zur vermeintlichen Natürlichkeit insbesondere der Jagd (wie auch gewaltaffine Darstellungen in Webers vorherigen Texten[1]) nahe.
Webers Essbarkeits-Metapher kollabiert an dieser niemals explizit gemachten Doppelbödigkeit. Nur manchmal schleicht sich ein Bewusstsein für ihre Abgründigkeit in den Text ein: Alle „Mitspielenden“, so heißt es in einer Gewalt zur Freiwilligkeit umdeutenden Formulierung, müssten sich „am früher oder später“ eintretenden Lebensende an die „Fruchtbarkeit des Ganzen hingeben.“ (31)
Konservatismus im Gewand einer biologistischen Mystik
In den Theologien, denen sich eine solche Opferrhetorik offensiv andient, wird ein derartiger Konservatismus im Gewand einer „biologis(tis)chen Mystik“ sicher einige Zustimmung finden. Schließlich reproduziert er mit bemerkenswerter Präzision die Logik der vormodernen scala naturae, die in der Sache auch heute noch in den „grünen Religionen“ verteidigt wird.
Weil das metaphysische Gerüst einer derart überhöhten Nahrungskette heute allerdings nur noch schwer kommunizierbar ist, kann man bei Weber biologistische Surrogate finden, die bisweilen selbst auf naturrechtliche Semantiken rekurrieren. „Die Gesellschaft des Seins ist nicht grausam, sondern streng geregelt“ (164), heißt es etwa ganz so, als wäre dies ein realer Gegensatz. Normative Aspekte und insbesondere die ethische Frage, wer wen nun tatsächlich töten und essen darf, behandelt Weber hingegen mit auffälliger, beinahe viktorianischer Prüderie. Dort, wo sie sich dennoch zu erkennen geben, decken sich seine normativen Einschätzungen dann nahezu 1:1 mit den aktuellen Konventionen: Auch Weber reproduziert beispielsweise die mehr bürgerliche denn biologische Unterscheidung von Wild-, Nutz- und Haustieren.
Die Aussöhnung mit der Essbarkeit soll vermutlich Trost spenden – und doch stellt sich dieser Effekt nicht ein. Auch für die Taube ist damit wenig gewonnen. Ansätze wie die von Weber riskieren nicht nur, ein Töten zu normalisieren, von dem wir längst wissen, dass es keinerlei reale Notwendigkeit hat. Sie widersprechen auch jeglicher Trauer – in der Alleinheitsideologie ist das Verlustgefühl angesichts des Todes eines anderen Subjekts letztlich nur eine künstlich-moralische Projektion. Subjekte zählen, so die alles andere als mystische Einsicht, letztlich nur als anonyme Behälter für ökologische Größen wie das Leben und den Tod.
[1] In seinem Buch „Mehr Matsch“ schildert Weber etwa, wie ein Rind erschossen und anschließend zerlegt wird; Weber ermutigt seinen Sohn Max sogar, daran teilzunehmen: „Max wollte mitschlachten. Er war am richtigen Ort. […] Nachdem der Metzger den Kopf vom Rumpf getrennt hatte, versuchte Max selbst, den gebogenen Stirnvorsprung zu lösen. Er rüttelte am Kuhschädel, dessen geöffnete Augen mich noch vor einer Viertelstunde lebendig angeschaut hatten. Mein Sohn benahm sich ganz so, als hätte er selbst das Tier gejagt.“ Andreas Weber: Mehr Matsch. Kinder brauchen Natur, 2. Aufl., Berlin: Ullstein 2012, 112.)

Beitragsbild: Buchcover