Wer wird uns einst retten: Unser Glaube, unsere Werke oder doch Gott selbst? Zum Reformationstag am Beginn des Lutherjahres zeigt Ottmar Fuchs, wie die allen zugesagte Rechtfertigung aus Gnade den Einsatz für eine solidarische Welt nicht entwertet, sondern ermöglicht und verschärft.
Während meines Theologiestudiums ist mir zur Vorbereitung einer Seminargestaltung in Gedanken und im Herzen aufgegangen, welche Bekehrung Martin Luther erlebt haben muss, als ihm intensiv klar wurde, dass er nichts dafür tun muss, um von Gott geliebt zu werden, dass er als Sünder, noch bevor er etwas geleistet haben könnte, von Gott „gerechtfertigt“ ist. Dies hat bei mir selbst die Bekehrung ausgelöst, Seelsorge, Verkündigung und Lebenshilfe und auch die praktische Theologie immer mehr in einer ganz zentralen Weise aus der Perspektive der Rechtfertigungstheologie und damit einer radikalen Gnadentheologie zu begreifen. Als in dieser Hinsicht „lutherischer Katholik“ bin ich immer wieder dabei, meine katholische Identität auf ihre rechtfertigungstheologischen Möglichkeiten hin durchzubuchstabieren.
Ohne Luther ginge es nicht über Luther hinaus.
Weil Luthers Entdeckung für meinen Glauben und für meine Theologie so entscheidend geworden ist, glaube ich, auch das benennen zu dürfen, wo ich 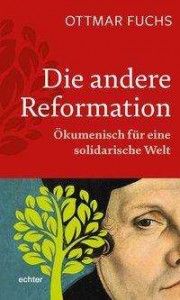
Der evangelische Kirchenhistoriker Volker Leppin (Tübingen) hat dies so formuliert: „Es geht … um die Rechtfertigungslehre, es geht um eine theologische Grundbotschaft für den Menschen im 21. Jahrhundert – das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, dass man immer stärker die ökumenische Frage in den Vordergrund gestellt hat ..: Die großen Kirchen in Deutschland wollen in diesem Reformationsjubiläum Akzente der Gemeinsamkeit setzen. Das halte ich für eine ganz große außerordentliche Entwicklung.“
Geht etwas verloren, wenn die guten Werke nicht mehr über das ewige Heil entscheiden?
Indem Martin Luther lehrte, so der evangelische Diakoniewissenschaftler und Sozialtheologe Ralf Dziewas (Elstal), „dass allein die gläubige Annahme der durch Leiden und Sterben Jesu geschaffenen Rechtfertigung über das ewige Heil entschied, zerschlug er die theologische Begründungsbasis für diese Form der Armenversorgung.“ Für jene Form, in der die guten Werke auch über das ewige Heil entschieden. Denn: „Warum sollte man noch Almosen geben, wenn davon letztlich nichts Entscheidendes mehr abhing?“ Zwar waren für Luther die Werke als freiwillige Gaben der Gläubigen Früchte des Glaubens und notwendige Konsequenz des geschenkten Heils, doch kam es durch die gerade darin weggenommene Spannung „zu einer Verschlechterung der Lage der Armen. Da nun nicht mehr alle evangelisch Gewordenen aus Dankbarkeit weiterhin das spendeten, was sie zuvor, zwischen Druck und Entlastung, für ihr Seelenheil gegeben hatten, führte die Heilsgewissheit der Glaubenden zur Unheilsgewissheit der Armen und Bedürftigen, denn ihre zuvor theologisch abgesicherte Versorgung durch Almosen und Spenden blieb nun weitgehend aus.“
Die getanen oder verweigerten Taten der Barmherzigkeit sind nicht belanglos.
Deshalb gilt mit Dziewas: In den Armen und Bedrängten „weiterhin Stellvertreter Christi zu sehen mutet vorreformatorisch an, bleibt aber auch im evangelischen Kontext wichtig. Auch wenn die guten Werke nicht mehr heilsentscheidend sind, lässt sich doch die Botschaft aus Jesu Gleichnis vom Weltgericht nicht ausblenden, dass darüber, ob ein Mensch sein Leben nach dem Willen Gottes gestaltet, am Ende die getanen oder verweigerten Taten der Barmherzigkeit entscheiden.“ Genau diesen Aspekt, in den Leidenden Christus selbst wahrzunehmen und damit sich in den Horizont einer ganz bestimmten Dringlichkeit und Unausweichbarkeit zu stellen, realisiert die vorreformatorische Wartburger Reformatorin Elisabeth von Thüringen, die Luther selbst sehr schätzte.
Es bleibt die Frage, über was die Werke entscheiden.
Es bleibt die Frage, über was die Werke entscheiden. Das Dilemma kann nur dadurch geklärt werden, dass die Werke eine Bedeutung im allem vorgängigen Heilsgeschenk haben, insofern sie nicht die Macht haben, dass die Menschen das Heil verlieren, wohl aber die Macht, dass sie das Heil unterschiedlich erfahren. Als Bedingung für die Gottesliebe haben die Werke jedenfalls keine Bedeutung. Gleichwohl haben sie eine, dann andere Bedeutung in dieser Liebe. Und zwar keine geringfügige, wofür Texte wie die Weltgerichtsrede Mt 25 stehen (ich war krank, und du hast mich besucht). Denn gerade weil die Liebe Gottes universal allen Menschen gilt, gewinnen darin die guten bzw. schlechten Werke ihr geradezu maßloses Gewicht, weil sie im Horizont der unerschöpflichen Liebe Gottes eine über alle Maßen gegensätzliche Bedeutung gewinnen.
Rechtfertigungsgnade heißt: verurteilt und gerettet zugleich.
Vom Jüngsten Gericht her formuliert: Weil die Täter*innen zerstörerischer Werke sich mit der dann unblockiert erfahrenen Liebe Gottes gerettet und zugleich konfrontiert sehen, erfahren sie einen Schmerz, der bis in die Ewigkeit der göttlichen Liebe hineinreicht. Dies ist eine Rechtfertigungsgnade, die nicht Böses ungeahndet rechtfertigt, sondern die den Gegensatz zwischen Gut und Böse unendlich vertieft, was sich in den gegensätzlichen Reaktionsweisen zwischen Schmerz und Freude (auch abwechselnd in einer Person) auf diese Gnade widerspiegelt. So gilt: verurteilt und gerettet zugleich, mit den entsprechenden Auswirkungen bei den Menschen. Diese Auswirkungen sind keine Bedingungen für das erfahrene Heil der unendlichen Liebe Gottes, sondern die Folgen aus dieser beseligenden Erfahrung der „visio Dei“. Eschatologisch gesehen sind die Werke also von programmatischer theologischer Bedeutung, weil sie in der Gnade und durch sie den Gegensatz zwischen Leiderfahrung und Leidzufügung in der unendlichen Tiefe des gekreuzigten Gottes selbst verankern und offenlegen.
Weder Kirche noch persönlicher Glaube sind Ausgrenzungsräume des Erlösungsgeschehens.
Die Grundlage dafür liegt in einer Gnadentheologie, in der die Rechtfertigung des sündigen und gottlosen Menschen die Unendlichkeitsqualität Gottes annimmt und für alle Menschen gilt. Weder Kirche (die katholische Versuchung) noch Glaube (die evangelische Versuchung) sind Bedingung und damit Ausgrenzungsräume des Erlösungsgeschehens. Wird die Rechtfertigung der „Gottlosen“ aber radikal verstanden, dann gilt sie auch dann, wenn Menschen gottlos bleiben. Dafür gibt es kein Wenn-Dann, auch kein religiöses. Dass jemand geboren wird, ist allein schon der Tatsache zu verdanken, dass Gott ihn oder sie aus Liebe ins Dasein gerufen hat, dass sie erwünscht und ersehnt sind. Damit verbindet sich die Hoffnung: Im Jüngsten Gericht werden alle Menschen der unverstellten Liebe Gottes ansichtig sein.
Die diesseitige Erfahrbarkeit von Gottes Liebe ist heute bitter nötig.
Gottes Liebe ist und bleibt gratis. Durch Werke kann und muss sie nicht verdient werden. Gerade deshalb gilt: Um der Menschen Willen ist die diesseitige Erfahrbarkeit dieser Liebe, wie sie Menschen in all ihrer Gebrochenheit zu geben vermögen, bitter nötig. Genau das betont Jesus, wenn er ausdrücklich dazu sagt, dass das Gebot der Menschenliebe dem Gebot der Gottesliebe „gleich“ ist (vgl. Mt 22, 39) und wenn er dieses Wort substantiell in seiner Selbstidentifikation mit von Not und Leid betroffenen Menschen verwurzelt. Diese Überzeugung haben in den Kirchen durch die Jahrhunderte hindurch viele Menschen in ihrer Solidarität mit bedürftigen und gefährdeten Menschen gelebt.
Basis künftiger Ökumene: Glaube als von Gott geschenkte Kraftquelle für verzichtfähige Nächstenliebe
Dies ist die Basis künftiger Ökumene: den Glauben als von Gott geschenkte unerschöpfliche Kraftquelle für verzichtfähige Nächstenliebe zu erleben und sich von daher für einen antifundamentalistischen Glauben zu öffnen, der sich, indem er alle Menschen bedingungslos in der unbegrenzten Liebe Gottes weiß, für alle Menschen solidarisch auswirkt und zur Zivilcourage befähigt. Viele gingen und gehen diesen Weg schon lange, wie der „Weltgebetstag der Frauen“. Die christlichen Kirchen haben das Zeug für eine solche etwas andere Reformation: aus einem solchen Glauben heraus ökumenisch für eine solidarische Welt und einen solidarischen Gott einzustehen, relativ ungeachtet dessen, was für ihre Kirchen dabei herausspringt.
„Glaube daran, dass du von Gott geliebt bist, was immer du glaubst und tust!“
Dies führt zu Auseinandersetzungen innerhalb des Christentums selbst, wo weltweit insbesondere dessen fundamentalistische Anteile zahlenmäßig explodieren, die mit verschärften Ausgrenzungen operieren und die Ungläubigen, um sie vor der Hölle zu bewahren, mit psychischem Terror zu gewinnen versuchen. Es ist zu verführerisch, eine immer komplexere und pluralere Welt wenigstens religiös derart in ein Schwarz-weiß-Korsett zu bringen und diese auch noch mit einem dafür zurechtgestutzten ungöttlichen Gott, also einem Götzen zu begründen. In der Heckscheibe eines Autos las ich: „Christus ist unser Retter. Glaube an ihn, damit du nicht in die Hölle kommst!“ Hätte es nicht, gut reformatorisch, heißen dürfen: „Glaube daran, dass du von Gott geliebt bist, was immer du glaubst und tust!“?
Dazu Näheres mit entsprechenden Litarturangaben: Ottmar Fuchs, Die andere Reformation. Ökumenisch für eine solidarische Welt, Würzburg 2016.
Ottmar Fuchs ist emeritierter Professor für Praktische Theologie an der Universität Tübingen.
Bild: Dieter Schütz / pixelio.de




