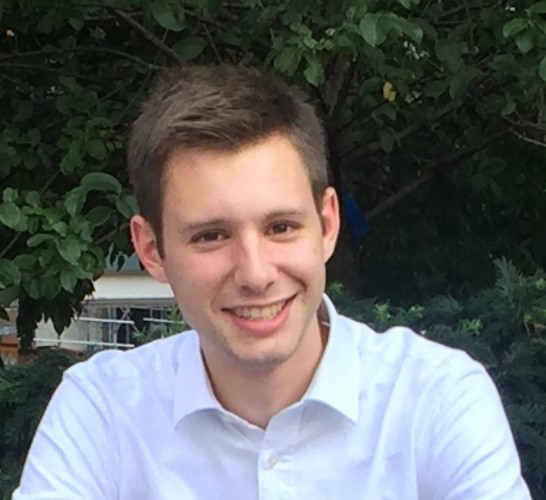Sine ira et studio die anderen Argumente des anderen wahrnehmen und sich darauf einlassen? Diesen Versuch unternehmen die beiden Antipoden Helmut Hoping und Magnus Striet. Johannes Ludwig diskutiert diesen Versuch.
Ein von Stefan Orth konzipiertes Buchprojekt inszeniert einen solchen Dialog und folgt in klassisch-theologischer Manier den vier theologischen Traktaten. Bereits beim Blick in das Inhaltsverzeichnis zeichnet sich ab, dass es weniger um den vertieften Diskurs zu Einzelthemen, sondern vielmehr um eine theologische tour de table geht, im Rahmen derer Konfliktlinien, aber auch Verbindendes zum Vorschein kommen können.
Sinnvoll erscheint die Auswahl der Diskutanden schon allein deshalb, weil in ihren Äußerungen wie im Brennglas Positionen aufeinanderprallen, die in Teilen repräsentativ für die unterschiedlichen Positionierungen sind, die in aktuellen theologischen und kirchenpolitischen Debatten vertreten werden. So ist das Gespräch der beiden Professoren keineswegs dazu verurteilt, eine hochtrabende Diskussion im Elfenbeinturm zu bleiben, sondern entfaltet seine Bedeutung gerade dadurch, dass die behandelten Themenfelder kontroverse Streitfragen berühren, in denen man in binnenkirchlichen Diskursen den Dialog bisweilen schon lange abgeschrieben hat. Unabhängig von den inhaltlichen Ausführungen transportiert bereits das bloße Format des Buches eine entscheidende Botschaft: Diskurs auf Augenhöhe ist bei aller inhaltlichen Differenz, Polarisierung und bisweilen gar Polemisierung möglich, wenn nicht gar unabdingbar.
Selbstverständlich bedeutet dies noch nicht, dass Magnus Striet und Helmut Hoping in zentralen Kernfragen zu einer Einigung kämen. Der Ertrag des Büchleins liegt vielmehr darin, dass beide ihre Grundpositionen in der Auseinandersetzung mit dem Gegenüber darlegen, schärfen und bisweilen auch präzisieren.
Unterschiedliche wissenschaftstheoretische Grundannahmen
Dass Striet und Hoping in ihren theologischen Konzeptionen auseinander liegen wie Tag und Nacht, zeigt sich schon im ersten – bereits vorab veröffentlichten Kapitel – zum Gottes- bzw. Offenbarungsbegriff. Striet konstatiert, dass das, was weitläufig als Offenbarung bezeichnet werde, menschlicher Konstruktion anheim zu fallen drohe und es insofern „keine sich unmittelbar auf Offenbarung beziehende Theologie“ (13) mehr geben könne. Hoping widerspricht, dass bereits in der Auseinandersetzung mit der Offenbarung „der Sprung in den Glauben“ (17) vollzogen werden müsse. Beide sind sich einig, dass die Gottesbeweise fehlgeschlagen sind, monieren gleichzeitig aber eine naturalistisches bzw. szientistisches Weltbild.
Wie aber lässt sich dann sinnvollerweise noch von einem Gott, geschweige denn von einer göttlichen Offenbarung sprechen? Die negative Theologie kann für Magnus Striet jedenfalls keine zufriedenstellende Antwort sein. Vielmehr plädiert er für das Autonomieprinzip des Menschen als Ausgangspunkt jeglicher Theologie. Demgegenüber beharrt Helmut Hoping darauf, dass man „ausgehend von einer geschichtlich ergangenen Offenbarung und ihrer Voraussetzung in der Schöpfung“ (28) argumentieren müsse.
Hier prallen Welten aufeinander. Im Streitgespräch wirkt es manchmal beinahe so, als nehme Magnus Striet die Rolle eines theologisch informierten Philosophen, Helmut Hoping aber die eines philosophisch informierten Theologen ein. Schon an diesem Punkt eröffnet sich ein wissenschaftstheoretischer Graben, der auch in der folgenden Diskussion immer wieder aufscheint, aber nur unzureichend ins Wort gefasst wird.
Nicht nur die theologische Methode, sondern auch das zugrunde liegende Wissenschaftsverständnis beider stehen sich diametral gegenüber. Während für den einen Theologie stets unter dem Vorbehalt geschichtlicher Konstruktion steht und damit letztlich hypothetisch bleiben muss, ist für den anderen die „geschichtlich ergangene, im Glauben angenommene und überlieferte Offenbarung“ (29) unverbrüchlich und Grundaxiom christlicher Theologie. Dass sich diese Differenz auf grundlegender Ebene auch durch die in der Folge behandelten theologischen Fragestellungen zieht, ist insofern wenig überraschend. Einig sind beide Diskutanden sich jedenfalls darin, dass man nicht hypothetisch Glauben könne.
Kirche und Synodaler Weg
Wenn sowohl Helmut Hoping als auch Magnus Striet ihren theologischen Ansatz ausgehend von ihrem jeweiligen Gottes- und Offenbarungsbegriff konsequent weiterdenken – und dies muss man beiden zugestehen – so ist nicht verwunderlich, dass sie auch in Bezug auf kirchliche Fragestellungen zu verschiedenen Schlüssen kommen.
Für Hoping resultiert aus der autonomiebegründeten Theologie, dass die Agenda des Synodalen Wegs als „Dekonstruktionspolitik von unten, die sich gegen die Lehre der Kirche richte[t]“ (35), zu bezeichnen sei. Zwar betont Hoping, dass es „angesichts des sexuellen Missbrauchs durch Priester und Bischöfe und seiner systematischen Vertuschung durch kirchliche Verantwortungsträger zunehmend schwerfalle“ (39), der Kirche zu glauben. Wenn aber die einzige Antwort darauf die schulterzuckend-lapidare Feststellung ist, dass „zu glauben [nicht bedeute], dass es keine Fragen mehr gibt“, dann ist das allemal zu wenig und wirkt beinahe zynisch.
Überhaupt wird das Gesprächsklima, wenn es um die Ausrichtung des Synodalen Wegs und die künftige Gestalt der katholischen Kirche geht, deutlich rauer. Beiden Gesprächspartnern ist anzumerken, dass die Diskussion bisweilen so emotional behaftet ist, dass die theologischen Positionen ob der Unterstellungen von Polemik, Selbstreferentialität und mangelnder Wissenschaftlichkeit mitunter zunächst freigelegt werden müssen. Wenn die Diskutanden im Streitgespräch vereinzelt ad personam argumentieren, so mag man das bedauern; andererseits zeigt es, dass die zur Debatte stehenden Themen beide tatsächlich existenziell berühren. Mit anderen Worten: Es geht ums Ganze.
Was ist Offenbarung?
Deutlich zutage treten die fundamentalen Unterschiede auch in der Fragestellung, was nun im Sein bzw. Handeln Jesu Christi unverbrüchlichen Offenbarungscharakter habe.
Während Magnus Striet – seinen Ausführungen zur historischen Bedingtheit des Offenbarungshandelns treu bleibend – konstatiert, dass Jesus „zeitgeistbedingt gedacht und gehandelt“ habe, will Helmut Hoping allenfalls „vom religiös-kulturellen Kontext seiner Verkündigung“ (58) sprechen. Dies mag auf den ersten Blick spitzfindige Petitesse sein, im Streitgespräch wird aber sehr deutlich, zu welch‘ unterschiedlichen Schlussfolgerungen beide kommen. Für Hoping hat etwa das Mann-Sein Jesu Offenbarungscharakter und er wehrt sich dagegen, dass „Jesus eine Projektionsfläche nicht nur heutiger Gerechtigkeitsvorstellungen, sondern zunehmend auch für die aktuellen Identitätsdiskurse darstell[e]“ (59).
Offenbarungscharakter des Lebens Jesu, Schlagabtausch zur Transsubstantiationslehre, die Entwicklung von Dogmen: In vielen Streitpunkten wird deutlich, dass Hoping und Striet Gefahr laufen, aneinander vorbeizureden. Während Hoping stets darum bemüht scheint, Unstimmigkeiten und Widersprüche in der kirchlichen Lehre durch einen hermeneutischen Spagat zu überbrücken (und dabei bisweilen zu weit zu gehen droht), ist Striet in kritisch-dekonstruktiver Manier um das Aufzeigen prinzipieller Missstände und Fehlinterpretationen bemüht.
Es ist nicht zu verkennen, dass beide durchaus Gefallen an der Diskussion haben und mit ihren Positionen bisweilen auch kokettieren (Hoping: „Es geht beim Dogma […] auch um die Kirchenverfassung, die göttlichen Rechts ist.“ Striet: „Echt?“ (80)).
Plädoyer für eine neue Streitkultur
Was aber ist nun aus der Lektüre des Streitgesprächs mitzunehmen? Eine Möglichkeit und auch Gefahr liegt sicherlich darin, sich vorschnell mit der einen oder anderen Argumentationslinie zu identifizieren und die von der jeweiligen Gegenseite vorgebrachten Argumente als gegenstandslos, unterkomplex oder gar naiv abzutun. Tatsächlich fordert das Streitgespräch die Leser*innenschaft immer wieder dazu heraus, sich selbst zu positionieren und insofern ist die Lektüre in jedem Falle meinungsbildend.
Vielleicht liegt der eigentliche Wert des Buches aber darin, aufzuzeigen, dass trotz aller Differenzen und emotional aufgeladener und polarisierter Diskurse ein wertschätzendes Gespräch auf Augenhöhe möglich ist. Was Magnus Striet und Helmut Hoping im Brennglas ausprobieren, könnte so zum Modell einer dringend notwendigen kirchlichen Streitkultur werden.
Grundvoraussetzung dafür ist – und das kann keinem der Gesprächspartner abgesprochen werden – die intellektuelle Redlichkeit und die Bereitschaft, anzuerkennen, dass der Gegenseite prinzipiell am Guten gelegen ist.
Eine gute Streitkultur impliziert allerdings – und auch das zeigt das Gespräch überdeutlich – noch nicht, dass jedes theologische Argument gleichermaßen rechtfertigbar wäre, zumal die jüngere Kirchengeschichte auf drastischste Weise deutlich macht, mit wie viel Leid und Unrecht die Übersetzung theologischer Positionen in institutionelle Gefüge verbunden sein kann.
Es gilt insofern, hart in der Sache, aber fair im Umgang zu sein, denn weitreichende Veränderungen der Kirche sind – sei es nun Fluch oder Segen – vorerst wohl nur dann zu erreichen, wenn es gelingt, Polarisierungen zu überwinden und überzeugend für die eigenen Positionen zu werben.
—