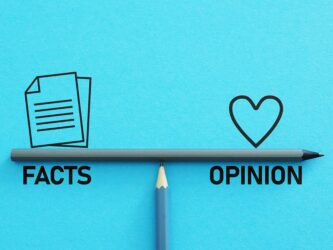Die Bedingungen für Muslime sich zu integrieren und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben sind in Europa sehr unterschiedlich – sie sind abhängig von politischem und kulturellem Kontext sowie von der Historie der Einwanderung. Hansjörg Schmid skizziert die Situation in der Schweiz.
Die Muslime in Europa stehen derzeit unter erhöhter Beobachtung. Aufgrund internationaler Konflikte und terroristischer Anschläge, die eine religiöse Motivation für sich beanspruchen, entsteht eine Art Generalverdacht gegenüber Muslimen. Unterschiedliche staatliche, religiöse und zivilgesellschaftliche Akteuren setzen sich damit auseinander. Auch wenn die Islamdebatten in unterschiedlichen europäischen Ländern viele gemeinsame Züge aufweisen, sind sie stark durch die jeweiligen rechtlichen und politischen Konstellationen geprägt. Wie gelingt es, wirksame Gegennarrative zu platzieren? Wie verhalten sich Integrationsmassnahmen, soziale Aktivitäten und Ausgrenzungsrhetorik zueinander?
Die Muslime in Europa stehen derzeit unter erhöhter Beobachtung.
Gerade die Westschweiz orientiert sich traditionell stark an Frankreich. So ist hier ähnlich wie in Frankreich eine Zurückhaltung gegenüber jeglicher Art gruppenbezogener Integration zu beobachten, da diese unter dem Verdacht steht, Parallelgesellschaften zu erzeugen. In der Deutschschweiz richtet sich der Blick dagegen eher auf Deutschland und Österreich, wo die Integration des Islams für viele Beobachter schon weiter vorangeschritten ist als in der Schweiz. Es ist jedoch erforderlich, eigene schweizerische Lösungen zu finden, da sich die Rahmenbedingen erheblich von den Nachbarländern unterscheiden.
Systembedingt keine Symbolpolitik
Der kleinteilige Föderalismus und der zurückhaltende Staat in der Schweiz haben zur Folge, dass zumindest auf nationaler Ebene wenig positive Symbolpolitik im Blick auf die rund eine halbe Million Muslime betrieben wird. Hochrangige Politiker, die sich wie der deutsche Bundesinnenminister Thomas de Maizière oder der österreichische Aussen- und Integrationsminister Sebastian Kurz mit muslimischen Repräsentanten vor die Kameras stellen, gibt es in der Schweiz systembedingt nicht. Dadurch ist umgekehrt die Debatte in der Schweiz vielleicht weniger autoritär und direkter; sie bringt wirklich die Stimmung der Bevölkerung zum Ausdruck.
2010/2011 fand auf Bundesebene ein Muslim-Dialog statt, an dem die wichtigsten Bundesämter und ein breites Spektrum an muslimischen Vertretern beteiligt waren. Von der Jugendarbeit bis hin zur Imamausbildung wurden Handlungsfelder erarbeitet, die aber im System der Schweiz weitgehend dezentraler Massnahmen bedürfen. Zwar wurden in den letzten Monaten Rufe nach einer Wiederaufnahme dieses Dialogs laut, jedoch beharren Kantone und Gemeinden auf ihren Zuständigkeiten in Sachen Religion und Integration.
Förderung durch den Staat – wie und wo?
Verglichen mit Deutschland, wo inzwischen in mehreren Bundesländern islamischer Religionsunterricht erteilt und über den Aufbau muslimischer Wohlfahrtsverbände mit staatlichen Förderungsmöglichkeiten nachgedacht wird, sind die öffentlichen (Mit-) Gestaltungsmöglichkeiten für Religionen in der Schweiz weitaus begrenzter. So geht die Tendenz klar weg von einem bekenntnisorientierten hin zu einem religionskundlichen Unterricht in den Schulen. Die staatliche Förderung im Bereich der Wohlfahrt fällt geringer aus, ist lokal differenziert und stark kompetitiv ausgestaltet. So geht auch die Bereitschaft zurück, überhaupt Jugendarbeit religiöser Träger zu fördern. Während in Deutschland der Aufbau islamisch-theologischer Studien an fünf Universitäten breite Akzeptanz gefunden hat, steht ein entsprechendes Projekt an der Universität Freiburg i. Üe. noch in den Anfängen. Die weit fortgeschrittene Säkularisierung der öffentlichen Sphäre in der Schweiz hat auch zur Folge, dass die Kirchen, die sich vielfach im interreligiösen Dialog engagieren, nur begrenzt als öffentliche Vermittler in kontroversen Debatten positionieren können.
Die Möglichkeit zu öffentlicher Mitgestaltung ist für Religionsgemeinschaften in der Schweiz begrenzter als in Deutschland.
Sicherheitspolitische Fragen haben der Debatte um Religion auch in der Schweiz wieder einen gewissen Antrieb gegeben. So beschäftigt sich derzeit eine Arbeitsgruppe des Bundes mit „Terrorist travellors“ – insbesondere denjenigen, die nach Syrien und in den Irak reisen – sowie mit Vorschlägen für entsprechende Präventionsmassnahmen. Die Weiterbildung von muslimischen Betreuungspersonen und die Stärkung muslimischer Organisationen kommen dadurch neu in den Blick. Inwiefern daraus eine gezielte staatliche Förderung resultieren kann, ist ungewiss, da diese immer unter dem Verdacht der Privilegierung einer bestimmten Bevölkerungsgruppe steht.
Direktdemokratie als Integrationsbremse
Die muslimischen Organisationen in der Schweiz warten wie in Deutschland noch auf ihre staatliche Anerkennung, die ihnen bessere Finanzierungsmöglichkeiten eröffnen würde. Eine solche obliegt den Kantonen und erfordert langwierige Prozeduren. Die Anerkennung wird oft mit der Einbürgerung verglichen: Es geht weder um einen rein formalen Akt noch um Integrationsförderung mit einem Vertrauensvorschuss des Staates, sondern um eine staatliche Besiegelung von bereits erbrachten Integrationsleistungen und einer breit akzeptierten Zugehörigkeit. Dem können jederzeit Volksinitiativen in die Quere kommen, die im System der direkten Demokratie der Schweiz ein wichtiges politisches Instrument sind. In den letzten Jahren ist die Tendenz zu beobachten, dass diese verstärkt zur Artikulierung des Wunsches nach einer restriktiven Ausländerpolitik und im Sinne islamophober Polemik genutzt werden. Wo immer ein Moscheebau oder die Einrichtung eines muslimischen Grabfeldes ansteht, ist Gegenwind zu befürchten. Die realitätsferne Diskussion um ein schweizweites Burkaverbot – über das Tessin hinaus, wo eine entsprechende Initiative bereits angenommen wurde – zeigt, dass es hier mehr um Stimmungsmache als um eine konstruktive Gestaltung des Zusammenlebens geht. Auch wenn es etwa in Schulen immer wieder zu Konflikten in Bezug auf religiöse Symbole kommt, tragen die gute wirtschaftliche Lage und die vergleichsweise hohe Durchmischung der Schweizer Gesellschaft in Schulen und Wohnquartieren zur Stabilität bei.
Weniger Einfluss vom muslimischen Ausland
Die Selbstorganisation der Muslime in der Schweiz ist ähnlich vielfältig wie in anderen europäischen Ländern. Verglichen mit Deutschland sind jedoch der Organisationsgrad schwächer und die Ressourcen geringer; die Professionalisierung gerade der überregionalen Verbände ist weniger weit fortgeschritten. Der Einfluss des türkischen Staates fällt ebenfalls geringer aus als in Deutschland, was auch damit zusammenhängt, dass Muslime aus den Balkanländern die zahlenmässig grösste Gruppe ausmachen. In der Schweiz sind die innermuslimischen Diskussionen weniger stark von Akteuren aus dem Ausland gesteuert und auch weniger kontrovers, als es in Deutschland immer wieder der Fall ist.
Auch wenn es formell noch einen zweiten Verband mit schweizweitem Anspruch gibt, vertritt die „Föderation islamischer Dachorganisationen Schweiz“ (FIDS) die breite Mehrheit der organisierten Muslime. Während die lokalen Moscheevereine meist monoethnisch orientiert sind, sind die FIDS ebenso wie kantonale Dachverbände als Antworten auf das Bedürfnis nach Ansprechpartnern seitens der Schweizer Behörden und als Interessensvertreter der Muslime entstanden.
Die meisten Muslime in der Schweiz stammen nicht aus der Türkei oder Nordafrika, sondern aus den Balkanstaaten.
Die FIDS widmet sich derzeit der eigenen Organisationsentwicklung und positioniert sich auch als Akteur der Extremismusprävention, so dass hier eine Grundlage für partnerschaftliche Projekte mit muslimischer Beteiligung besteht. Sie hat gemeinsam mit 16 kantonalen bzw. ethnischen Dachverbänden die Anschläge von Paris als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ aufs Schärfste verurteilt und sich von „fälschlicherweise im Namen einer Religion“ begangenen terroristischen Taten distanziert. Die Stellung der FIDS in den öffentlichen Debatten ist aber nicht stark genug, um damit bestehende Ängste zu überwinden. Selbsternannte Islamkritiker sind wie in Deutschland medial sehr präsent und verstärken ein Klima des Misstrauens. Muslimische Stimmen aus der Mitte haben es dagegen sehr schwer, in kontrovers angelegten Fernsehformaten wie „Arena“ oder „Infrarouge“ zu punkten, die als eine Art Ritual in der gesellschaftlichen Debatte aufgefasst werden können. Der zahlenmässig sehr kleine, aber medienwirksame „Islamische Zentralrat Schweiz“ (IZRS) tut das Übrige, um mit einer Abgrenzungsrhetorik zu polarisieren.
Hier wird Religion sichtbar: Spital und Gefängnis
Einer der wenigen verbliebenen öffentlichen Räume von Religion in der Schweiz ist die Seelsorge in Einrichtungen wie Gefängnissen oder Krankenhäusern. So hoffen Muslime, Projekte und Ausbildungsmöglichkeiten in diesem Bereich entwickeln zu können, bevor sich hier eine transreligiöse spirituelle Begleitung als Standard durchsetzt. Auch in diesem Fall richtet sich der Blick nach Deutschland, wo es teilweise mit öffentlichen Mitteln geförderte Qualifizierungsmassnahmen für muslimische Seelsorge gibt. Die „Vereinigung der Islamischen Organisationen in Zürich“ (VIOZ) führt derzeit ein Pilotprojekt im Bereich der Notfallseesorge durch, das aus einem konkreten Bedarf heraus entstanden ist. Inwiefern es gelingen wird, das Vorhaben langfristig zu stabilisieren, ist noch offen.
Sicherlich tragen Projekte wie dieses zum Vertrauensaufbau bei und besitzen ein grosses Entwicklungspotential. Langfristig angelegte Engagements und Dialogprozesse können auch in der Schweiz dazu beitragen, dass die Akzeptanz der Muslime von unten her wächst und eine feste Verankerung in der Gesellschaft findet. Ob diese Kräfte der Selbstorganisation ausreichen und ob der Staat sich im Sinne von Prävention und Integrationsförderung nicht doch stärker engagieren sollte, wird Gegenstand weiterer Diskussionen sein.
PD Dr. Hansjörg Schmid ist Leiter des Schweizerischen Zentrums für Islam und Gesellschaft an der Universität Freiburg/Schweiz und Privatdozent für Christliche Sozialethik an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Foto: Katharina Wieland Moser / pixelio.de