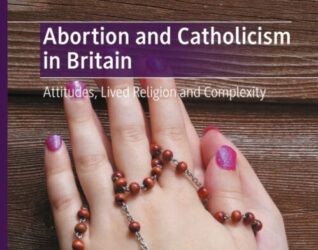Was gilt nun? Werden Gesellschaften umso säkularer, je moderner sie werden, oder erleben wir eine Diffusion des Religiösen, inklusive ultimativer Individualisierung? Ein Einordnungsversuch von Rainer Bucher.
„Religiöse Individualisierung oder Säkularisierung“ – so lautete schon der Titel eines von Karl Gabriel 1996 herausgegebenen Buches. Nach der 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung brach die Diskussion in neuer Variante wieder auf. Für beide Thesen kann man plausibilisierende Beobachtungen finden. Zumal es dann auch noch eine dritte These zur religiösen Lage der Gegenwart gibt, die berühmte „Postsäkularitätsthese“ von Jürgen Habermas, welche – aus dezidiert areligiöser Perspektive – die bleibende (sachliche) Relevanz und Eigenständigkeit des Religiösen konstatiert. Was hat es damit auf sich?
Die Säkulariserungsthese
Die Säkularisierungsthese behauptet, dass Prozesse gesellschaftlicher Modernisierung einen letztlich negativen Einfluss auf Religionen ausüben, und das auf drei Ebenen: sie schwächen die Stabilität und Vitalität von Religionsgemeinschaften, von religiösen Praktiken und auch von individuellen religiösen Überzeugungen. Dafür gibt es einige Belege, vor allem wenn man, etwas enger, unter „Säkularisierung“ das unbestreitbare gesellschaftsstrukturelle Phänomen versteht, dass religiöse Gehalte und Geltungsansprüche in den Privatbereich ausgelagert und im öffentlichen Bereich – zumindest in unseren kulturellen Gegenden – weitgehend neutralisiert werden.
Unter dieser Rücksicht sind westliche Gesellschaften tatsächlich strukturell säkularisiert. Der heiße historische Kern des europäischen Säkularisierungsprozesses dürften dabei die vielen Toten sein, welche die Religionskriege der frühen Neuzeit kosteten, woraufhin nach und nach immer mehr gesellschaftliche Handlungssektoren religionsunabhängige Selbstwahrnehmungs- und Handlungslogiken entwickelten und, wichtiger noch, sie auch gegen die religiösen Institutionen durchsetzen konnten. Diese berühmte „funktionale Differenzierung moderner Gesellschaften“ hatte und hat ohne Zweifel säkularisierende Effekte.
Europäische Gesellschaften sind mit wenigen, freilich signifikanten Ausnahmen aber eher nicht säkularisiert, wenn man unter „Säkularisierung“ die generelle Neutralisierung religiöser Gehalte, ihr grundsätzliches Verschwinden oder ihre generelle Entplausibilisierung in der Bevölkerung auf der Ebene der Einzelpersonen versteht. Die christlichen Kirchen und zunehmend auch andere Religionsgemeinschaften bleiben Quellen individueller Lebensorientierung und Daseinsbewältigung, freilich unter der situativen Vorbedingung der Freiheitslogik der Einzelnen. Oder anders gesagt: Jeder und jede hat die „säkulare Option“ (Hans Joas) und kann sie jederzeit nutzen. Die Konflikte um die Religion vollziehen sich zumeist im kulturellen Bereich der Werte, Normen und sozialen Objektivationen „zwischen“ diesen beiden Ebenen.
Die Individualisierungsthese
Die Individualisierungsthese, spätestens seit der Schweizer Studie „Jede(r) ein Sonderfall“ aus dem Jahre 1993 religionssoziologisch sehr präsent, geht davon aus, dass „nicht ein Verlust von Religion – wie die Entwicklung von den Kirchen gerne wahrgenommen wird – stattfindet“, man vielmehr von einer „Neustrukturierung des Religionssystems und eine(r) Änderung der Äußerungsformen von Religion“[1] ausgehen müsse. Diese Umstrukturierung des Religionssystems vollziehe sich dabei „am Leitfaden des Ichs“. Religion verschwinde also nicht in der späten Moderne, sie transformiere sich, sie werde zum individuellen Projekt, das man je nach Lebenswegstrecke neu wählt und zusammenstellt.
Auch für diese These spricht einiges. Schließlich produzieren die erzwungenen Wahlbiografien der Gegenwart einen hohen Kontingenzbewältigungsbedarf. Wer viel entscheiden kann, muss auch viel entscheiden, riskiert viel und muss sich seine Entscheidungen zurechnen lassen. Zumindest in der Selbstwahrnehmung ist das Leben in westlichen Gesellschaften eine ziemlich absturzgefährdete Risikoexistenz. Wenn die Biografie zunehmend zum letzten Ort wird, an dem die disparaten Teile der Gesellschaft noch verbunden werden können und müssen, dann ist die Individualisierung von Religion eine unmittelbare Konsequenz der gesellschaftlichen Situation.
Postsäkulariät
Bleibt die These von der „Postsäkularität“, prominent formuliert von Jürgen Habermas in seiner Friedenspreisrede 2001.[2] Habermas formuliert hier die spätmoderne Einsicht westlicher, religiös ausdrücklich „unmusikalischer“, intellektueller Eliten, dass die Religion „Ressourcen“ für die individuelle Lebensführung, aber auch für Legitimation und Stabilität des demokratischen Verfassungsstaates bereithält, die ohne Religion nicht so einfach zur Verfügung stehen, oder, anders gesagt, dass religiöse Sprache nicht verlustfrei in nicht-religiöse Sprache übersetzt werden kann.
Zeitgleich werden die westlichen Gesellschaften im aktuellen Übergang zur medialen, ökonomischen und verkehrstechnischen Globalisierung mit dem Phänomen von public religions[3] konfrontiert, also einer neuen und neuartigen Sichtbarkeit des Religiösen im öffentlichen Raum. Moderne westliche Gesellschaften sind ökonomisch, medial und verkehrstechnisch globalisiert, haben das Christentum als gesellschaftliche wie individuelle Herrschaftsreligion entmachtet und vertreten gleichzeitig die aktive Religionsfreiheit: Unter diesen Rahmenbedingungen kann keine Gesellschaft öffentlichen Zeichen und Praktiken der Religionen ausweichen, was einerseits Irritationen bei jenen auslöst, welche sich weiterhin in einer kulturell, freilich nicht unbedingt religiös „christlichen“ Gesellschaft wähnten, und andererseits hohen religionspolitischen Regelungsbedarf hervorruft.
Auf dem Markt: die neue Konstellation
Alle drei genannten Versuche, die Lage der Religion(en) in westlichen Gesellschaften zu fassen, beschreiben ohne Zweifel reale Phänomene. Diese drei Ansätze scheinen auch trotz ihrer diskursiven Kontraststellung durchaus konstellierbar. Denn der zentrale Befund im Feld des Religiösen in westlichen Gesellschaften dürfte sein, dass sich Religionen zunehmend nach jenem Muster vergesellschaften, nach dem in westlichen Gesellschaften in Zeiten eines ebenso globalen wie kulturell hegemonialen Kapitalismus immer mehr Lebensbereiche organisiert werden: nach den Mustern und Regeln des Marktes.
Religion individualisiert sich dann auf der Nachfrageseite – jeder und jede kann sich seine/ihre persönliche Religion selbst zusammenstellen und tut dies auch –, aber auch auf der Anbieterseite: Einige ihrer Merkmale wandern aus in andere kulturelle Handlungsfelder, so zum Beispiel in die Medien, in die kapitalistische(n) Wirtschaftsform(en) oder auch in eine neue (trivial-)ästhetisierende Kunstreligion um Museen und Pop-Events. Hans-Joachim Höhns „Theorie religiöser Dispersion“ zeigt plausibel, inwiefern sich der „postsäkulare Fortbestand des Religiösen als ein mehrfacher Transformationsprozess vollzieht, der die Vermittlungsbedingungen religiöser Traditionen, die Sozialformen und öffentliche Präsenz gelebter Religion sowie die Verwendung ihrer semantischen und ästhetischen Ausdrucksformen außerhalb religiöser Kontexte umfasst.“ [4]
Die Säkulariserungsthese hält dann die unbestreitbare Wahrheit fest, dass sich niemand auf spezifische Märkte begeben muss und dass sich tatsächlich viele – in unterschiedlichen Ländern sehr unterschiedlich – gar nicht erst auf den religiösen Markt begeben. Detlef Pollacks und Gergely Rostas international vergleichende Meta-Untersuchung „Religion in der Moderne“[5] zeigt einen statistisch nachweisbaren negativen Zusammenhang zwischen Modernisierungsindikatoren und religiösen Indikatoren: In Gesellschaften mit steigender Bildung, wachsendem Wohlstand und zunehmender sozialer Gleichheit sinkt die religiöse Bindung – so nicht außerreligiöse Interessen sich mit Religion verbinden und aufladen.
Die Säkularisierungsthese formuliert mithin die Freiheit gegenüber dem Markt, die Individualisierungsthese hält dann die Freiheit auf dem Markt fest. Auch wer sich auf den religiösen Markt begibt, behält seine Freiheit, wie es Kunden zusteht. Er behält sie diachron, denn er kann den Anbieter wechseln, und er behält sie synchron, denn er kann manches von verschiedenen Anbietern kombinieren, wie es auch in anderen Marktsektoren möglich ist. Und er behält die Freiheit zu wechselnder Intensität, auch das entspricht normalem Kundenverhalten.
Die These der „Postsäkularität“ hält dann aber fest, dass es diesen Markt überhaupt noch gibt, dass er ein „Produkt“ sui generis anbietet, dass dieser Markt – relativ, nicht absolut – halbwegs stabil zu sein scheint und dass mit ihm weiter zu rechnen ist, wenn auch in Europa in durchaus unterschiedlicher Virulenz bis hin zur gesellschaftlichen Bedeutungslosigkeit.
Und natürlich könnte man auch all diese ziemlich grundstürzenden Vorgänge nicht als Geschichte eines Abstiegs, sondern eines Aufstiegs, einer Machtübernahme lesen und von jener Größe her analysieren, welche die Religionen als menschenleitenden Souverän beerbt hat: der kulturell hegemonial gewordene Kapitalismus.
Wie damit umgehen?
Für die Kirchen bedeutet dieser Befund, dass sie ziemlich anders genutzt werden, als sie sich selbst – traditionell – verstehen. Das ist für jede Institution eine höchst heikle Situation. Die Entbettung des Religiösen aus seiner kulturellen, gesellschaftlichen und biographischen Selbstverständlichkeit dreht schlicht die Herrschaftsverhältnisse zwischen verfasster Religion und Individuum um. Das provoziert intern natürlich höchst spannende diskursive wie praktische Adaptionsvorgänge – oder eben deren demonstrative Verweigerung. Ähnliches zeigt sich übrigens auch im religionssoziologischen Feld selber: der Entbettungsprozess des Religiösen bewirkt spezifische Polarisierungseffekte, die Ränder des religiösen Partizipationsspektrums werden gestärkt.
Wie die Kirchen mit diesem Befund umgehen sollen, ergibt sich natürlich nicht schon aus diesem Befund selbst. Das wäre ein „empiristischer Fehlschluss“. Die Kirchen müssen aus ihrer Tradition heraus Kriterien entwickeln, was diese ziemlich neue Lage für sie bedeutet und wie sie darauf reagieren, um ihrer Aufgabe gerecht zu werden. Sie sollten von ihren intellektuellen Ressourcen her eigentlich dazu in der Lage sein. Nur hat die katholische Kirche halt ein paar Probleme, diese auch für ihren eigenen Fortschritt zu aktivieren. Einem institutionalistischen Kurzschluss erliegen sollte man jedenfalls nicht.
Die (prophetische) Neu-Entdeckung der eigenen Tradition(en) und ihrer normativen Implikationen ist notwendig – aber natürlich umstritten. Man muss diesen Streit führen, man nennt ihn Theologie. Eines ist sicher: Die kirchlichen Zeiten werden spannender, die Konflikte schärfer und die Absturzrisiken größer. Genau das ist ja schon zu beobachten. Man sollte auch keine allzu große Angst davor haben, kirchengeschichtlich ist es der Normalfall. Solche Phasen haben freilich fast immer zu Kirchenspaltungen geführt.
______________________

Rainer Bucher, Bonn, bis September 2022 Professor für Pastoraltheologie an der Universität Graz.
Bild: Ludger Verst
[1] M. Krüggeler/P. Voll, Strukturelle Individualisierung – ein Leitfaden durchs Labyrinth der Empirie, in: A. Dubach/R. J. Campiche (Hrsg.), Jede(r) ein Sonderfall?, Religion in der Schweiz, Zürich/Basel ²1993, 43
[2] Im Oktober 2001, bei der Entgegennahme des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, benutzte Jürgen Habermas den Begriff der „postsäkularen Gesellschaft“ als eine zentrale zeitdiagnostische Kategorie: Ders., Glauben und Wissen. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2001, Frankfurt/M. 2001.
[3] Vgl. J. Casanova, Public Religions in the Modern World, Chicago-London 1994.
[4] H.-J. Höhn, Postsäkular. Gesellschaft im Umbruch – Religion im Wandel, Paderborn, 2007, 10.
[5] D. Pollack/G. Rosta, Religion in der Moderne, Frankfurt/M. 2015
Beitragbild: Rainer Bucher