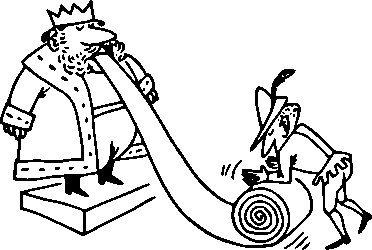Passend zum Reformationsjubiläum ist nun auch eine Revision der Lutherbibel erschienen, an der 5 Jahre lang gearbeitet wurde. Johanna Breidenbach (Luzern) gibt einen Einblick in ihre ersten Eindrücke beim Lesen der neuen Übersetzung.
Ich wusste nicht, dass die Besuche in der Gemeindebibliothek während meiner Kindheit offenbar den Grundstein zu etwas legten, was man vielleicht tatsächlich protestantische Bibelfrömmigkeit nennen könnte. Das fällt mir erst jetzt auf, beim Lesen der neuen Lutherübersetzung. Zur Gemeindebibliothek gehörten zu allererst: der trockene ruhige Geruch der gefüllten Buchregale. Dann die freundliche Frau Keller. Die orangen Polstermöbel ‒ und natürlich: die Bücher. Zur Bibliothek gehörte auch ein Plakat, das auf der Gemeindebürotür klebte. Auf dem war ein herabstürzender Bach zwischen bemoosten Felsen zu sehen und dazu in großer weißer Schrift: „Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir.“ Da ich als Kind glücklicherweise keine Ahnung von graphisch ansprechenden Plakaten hatte, folgte ich der imaginativen Einladung umstandslos. Ein lechzender Hirsch erschien auf dem grauen Linoleumboden des Gemeindehauses, und Mitgefühl mit dem schreienden Menschen regte sich. Auch wenn ich nicht genau wusste, was Lechzen war, ich spürte es trotzdem. Seitdem wohnte dieses Wort zuinnerst in Psalm 42, bei Gott, dem Hirsch und dem Mensch, der solche Sehnsucht hat.
Texttreue und Lutherehre waren die beiden anderen Kriterien.
Jetzt ist das Wort ausgezogen, in der neuen Version des Psalms „schreit“ auch der Hirsch und die Sehnsucht muss ohne das Knistern des sanft reibenden Vergleichs auskommen. Offenbar gehörte Psalm 42 nicht zu den veränderungsresistenten Texten, die die Kommission aus liturgischen Gründen für unantastbar erachtete. So wie Psalm 23. Überhaupt war die Schonung der sich nur langsam gewöhnenden Herzen nur ein Kriterium der neuen Bearbeitung, die als Durchsicht begann und schließlich als veritable Revision herauskam. Texttreue und Lutherehre waren die beiden anderen Kriterien, die zu einer mehr oder weniger signifikanten Änderung von insgesamt 44% aller Verse führten. Nachzulesen ist das alles sehr schön auf der Website der Deutschen Bibelgesellschaft. Sie stellte 2006 die Anfrage, ob nicht eine neue Durchsicht der Ausgabe von 1984 nötig sei, die inzwischen stellenweise als zu ungenau erschien. Damit veranlasste sie den Rat der EKD dazu, nach einer Prüfung des Antrags eine neue Revision in Auftrag zu geben, die pünktlich zum Reformationsjubiläum 2017 fertig sein sollte. Gearbeitet hat eine legendäre Schar von siebzig Weisen zwischen 2010 und 2015, also sehr flugs. Nun ist sie seit der Übergabe an den Rat Ende September öffentlich zugänglich. Und ist die neue von der Kirchenleitung empfohlene Bibel auch für den Gottesdienstgebrauch.
In keiner anderen sprachlichen Operation wird deutlich, wie sehr das Schreiben zugleich Welt schafft und Welt ausschließt.
Der genannte Eingriff in Psalm 42 ist übrigens eine von wenigen wirklichen Wortveränderungen. Häufig ist das nur der Fall in den Apokryphen, aufgrund der inzwischen verbesserten Textgrundlage der Septuaginta. Bei dem, was sich für mich als Auszug anfühlt, handelt es sich außerdem um eine Rückkehr: Dass der Hirsch schreit und nicht lechzt, das war den Lesern der Lutherbibel 400 Jahre lang vertraut, zwischen 1545 und 1964; erst dann wurde geändert. Im hebräischen Original findet sich auch zwei Mal dasselbe Verb, das allerdings eher das Lechzen als das Schreien nahe legen würde (so hat sich denn die Zürcher Bibel für zwei Mal „lechzen“ entschieden).
Der zweite Vers von Psalm 42 gibt damit ein anschauliches Beispiel für die Problematik des Übersetzens überhaupt und dieses Versuchs im Besonderen. In keiner anderen sprachlichen Operation wird deutlich, wie sehr das Schreiben zugleich Welt schafft und Welt ausschließt.
Diese Revision hat die Absicht, zwischen Jerusalem und Wittenberg anzukommen.
Jedes Wort ist eine Entscheidung, häufig genug ein Kompromiss, und wird abgewogen zwischen verschiedenen Gewichten (Urtext, Sprachkraft der Vorgänger, liturgische Gewohnheiten, Sprachvermögen der Gegenwart). Das macht deutlich: Es muss immer wieder Revisionen geben. Und: Wie auch immer man jeweils entscheidet, wird man den einen gerecht, den anderen weniger und niemals wird man alle glücklich machen. [Das bildete sich bereits ab in dem komplizierten Verfahren der Bearbeitungsgruppen, Lenkungsausschüsse und Kommissionen.] Man muss sich entscheiden, welches Haus man am anderen Ufer am ehesten erreichen will, und diese Revision hat die Absicht, zwischen Jerusalem und Wittenberg anzukommen. Tatsächlich ist man ziemlich nah am Burggarten gelandet. Auch wenn das Bild ziemlich hinkt, denn häufig war das gar keine Alternative. (Jakob hinkt übrigens noch, Gen 32,32). Für die Frage, ob man die moderne „Schlangenbrut“ wieder durch das alte „Otterngezücht“ ersetzen soll ‒ wie geschehen ‒, war die Ausrichtung an der Texttreue vielleicht ohnehin nicht von entscheidendem Gewicht.
Ich habe ein altes Zimmer räumen müssen mit meinem Hirsch, aber habe ein neues gewonnen.
Ein weiteres Beispiel aus Jesaja 11 greift eine Veränderung im Sinne des Urtextes heraus, die zugleich ein neues sprachliches Rätsel aufgibt. In „Der Messias und sein Friedensreich“ ‒ [hier blieb die Überschrift gleich, man kann deren Veränderungen aber gut z.B. in Kapitel 10 studieren] ‒ wurden die Tiere, korrekterweise, in den Singular versetzt und aus den „Bären“ wurde die „Bärin“, die zusammen mit der Kuh weidet. In der Ausgabe von 1984 heißt es weiter: „…und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter.“ Neu steht nun: „…und ein kleines Kind wird seine Hand ausstecken zur Höhle der Natter.“ Es steckt sie weder in die Höhle, noch streckt er sie nach der Höhle, sondern er steckt sie aus. Das passt doch nicht, eine Hand in den Raum hinauszustecken, hin zur Natterhöhle, etwa wie man Tulpenzwiebeln in die Erde aussteckt? Oder passt es doch, zumal die Wendung ein besonderes Licht auf das Kind wirft, das sehr sorglos oder sehr selbstbewusst erscheint. Schön! Ich habe ein altes Zimmer räumen müssen mit meinem Hirsch, aber habe ein neues gewonnen.
„Jetzt die Lutherbibel lesen“- App.
Neu ist im Übrigen auch die App. Da kann man „Jetzt die Lutherbibel lesen“ und zwar versgenau und personalisiert. Schriftgröße und Fond sind anpassbar, man kann auch die Farbe der Anstreichungen wählen und sich Notizen machen. Weitere lesepädagogische Hilfen sind die integrierten Bibellesepläne. Seit ich sie abonniert habe, werde ich jeden Tag um 11 Uhr an meine „Leseaufgaben“ erinnert. [Sehr hilfreich ist das allgemeine Stichwortverzeichnis und das Überschriftenverzeichnis. Das bedeutet, dass man wissen muss, in welchem Buch man z.B. nach der «Sintflut» suchen sollte, aber man muss sich nicht erinnern, dass die erste richtige Krise bereits knapp nach dem verheißungsvollen Anfang eintrat.] Leider lässt sich der Bibeltext nirgends runterscrollen. Ob das an meinem Gerät liegt, braucht es vielleicht auch ein Update? Das provoziert medientheologische Reflexionen.
Wir müssen uns das Wort hinterhertragen, es vor uns stellen, uns aufbinden lassen und zwischen die Augen setzen, Wegmarken für es aufstellen.
Denn trotz der Nachvollziehbarkeit der Revision und ihres wünschbaren Erfolgs lässt sich ein kritischer Gedanke nicht ganz abweisen: dass nicht zuletzt der Aufmerksamkeitsschub für die Bibel, den eine neue Ausgabe mit sich bringt, mit ein Grund für die Bearbeitung gewesen sein dürfte. Das Reformationsjubiläum sei ein Anlass, die Bibel als «Kraftquelle des Glaubens» neu zu entdecken, so der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm. Ein medienwirksamer Auftritt für das Medium selbst also, auf dass es werde, was es ist: Wort Gottes. Wir kennen das aus dem Marketing. Man muss sich in Erinnerung bringen und seinem Produkt immer wieder den frischen Hauch des Neuen verpassen, damit man auf dem Markt weiter wahrgenommen wird. „Greifen Sie in der Vorweihnachtszeit nicht nur zum Neuen von Bärfuss, sondern auch zum neuen Luther (der auch noch ein Klassiker ist, Sie tun also etwas für Ihre Bildung!)“. Jürgen Klopp und andere Werbeträger ‒ für fast jedes Milieu hat eine(r) eine Sonderedition gestaltet ‒ machen es uns vor, wie man sein kann, wie alle sein wollen und trotzdem evangelisch. Die Banalisierung, Eventisierung und Kommerzialisierung des Reformationsjubiläums wird inzwischen von vielen Seiten gescholten. In Bezug auf die Bibelübersetzung muss die Kritik jedoch verstummen. Nicht nur wegen der Sorgfalt derer, die jahrelang an der Revision gearbeitet und sich gemüht haben. Sondern aus theologischen Gründen. Denn wenn man die Überfluss-Logik mancher Gleichnisse heranzieht, reicht es, wenn ein Leser anlässlich der neuen Übersetzung in den Text hineinschaut und über einen Vers nachdenklich wird. Wir müssen uns das Wort hinterhertragen, es vor uns stellen, uns aufbinden lassen und zwischen die Augen setzen, Wegmarken für es aufstellen. Und wenn das heute bunter sein muss als früher, dann bitte auch das.
Der Dialektik der Zugänglichkeit, d.h. der Offenbarung, entkommt man damit ohnehin nicht. Was leicht zu haben ist und offen vor jedermanns Ohren und Augen sich abspielt, ist offenbar nur schwer zu sehen. Diese Sachlage konkretisiert sich heute im digitalen Überangebot an Kommunikation und Werbereizen, die ungefragt mitgeliefert werden. Wir gebrauchen ständig Medien, um «etwas» mitzuteilen, und nicht selten erweckt das den Argwohn, die Inhalte verblassten über ihrer Dauervermittlung, nähmen ärmliche Schwundstufen an, bis sie vielleicht eines Tages gar ganz verschwunden seien.
Mensch, nun sieh doch hin! Und hör doch mal zu!
Der Kern dieser Dialektik liegt aber nicht versteckt im Internet. Mensch, nun sieh doch hin! Und hör doch mal zu! Jesus fordert das ein paar Mal (und es wäre eine interessante Übung, sich seine Tonlage dazu vorzustellen). Ab einem bestimmten Punkt verdunkelt die Offensichtlichkeit das vor Augen liegende, denn je näher etwas ist, desto schwieriger wird es, zu unterscheiden. Und dann kann es kippen. Auf einmal rückt das Handhabbare in weite Ferne, das Offensichtliche verschließt sich und das Reizvolle wird total öde. Das heißt: die inflationär verbreitete Bibel als übermedialisiertes Medium würde vor lauter Medialität überhaupt nichts mehr vermitteln. Das ist eben die Sache mit der Offenbarung, die christlich gesehen in der Inkarnation ihren Tiefpunkt hat: Gott sichtbar als Mensch, als einer unter uns – und wir welche von Gott –, wer könnte das ansatzweise verstehen, wer in seinem Nächsten Gottes Kind unterscheiden? Also: Das Wort Gottes ist offenbar, aber auch verborgen und unzugänglich, es kann mir in so vielen Versionen und Updates vorliegen, wie es will. Da hilft wohl nur, wie Luther es an anderer Stelle gesagt hat, immer wieder anzuklopfen an den Türen der Schrift und wenn eine neue Revision dazu Anlass bietet: umso besser.
—
Johanna Breidenbach ist Oberassistentin am Institut für Hermeneutik und Religionsphilosophie der Universität Zürich.
Beitragsbild: https://pixabay.com/de/bibel-buch-altes-buch-papier-alte-1679747/