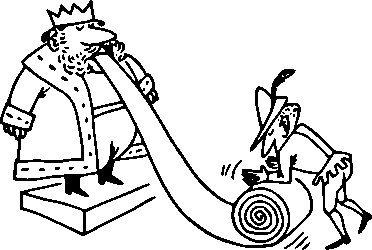Anlässlich des 100. Geburtstags von Paul Celan am 23.11.2020 skizziert Jan-Heiner Tück biographische Momente, ausgehend von einzelnen Gedichten. Viele Gedichte von Paul Celan üben anamnetische Solidarität mit den Toten. Sie wollen den unbestatteten Opfern der Shoah einen Erinnerungsort in der Sprache geben. Tück deutet sie als poetische Kenotaphe.
Am 9. November 1938 reist der junge Paul Antschel von Czernowitz nach Tours, wo er ein Medizinstudium aufnehmen will. Über Polen kommt er zunächst nach Berlin. Dort trifft er am Morgen des 10. Novembers am Anhalter Bahnhof ein. In der Nacht brennen die Synagogen, jüdische Geschäfte werden demoliert, Friedhöfe geschändet. Tausende Juden werden festgenommen. Die Erinnerung an die Reichspogromnacht hat der Dichter Paul Celan später im Gedicht La Contrescarpe festgehalten:
Über Krakau
bist du gekommen, am Anhalter
Bahnhof
floß deinen Blicken ein Rauch zu,
der war schon von morgen. […]
Celan ist staatenlos, besitzlos, arbeitslos, namenlos. Es dauert, bis er sich einen Namen machen kann.
Das Studium in Tours muss Celan schon bald wegen Ausbruch des Kriegs abbrechen. Er erlebt, wie seine Heimatstadt Czernowitz zunächst von der Roten Armee, dann von der Wehrmacht eingenommen wird. Anders als seine Eltern, die von den Nazis deportiert und ermordet werden, kann er selbst überleben. Nach 1945 führt ihn sein Weg über Bukarest und Wien nach Paris. Der Anfang ist schwer. Celan ist staatenlos, besitzlos, arbeitslos, namenlos. Es dauert, bis er sich einen Namen machen kann. Von 1949–1950 absolviert er ein Studium der Sprachwissenschaft. Finanziell hält er sich durch Sprachunterricht und Übersetzungen über Wasser. 1952 heiratet er die Graphikerin Gisèle de Lestrange, die einer katholischen Adelsfamilie entstammt. Celan widmet ihr den Gedichtband Von Schwelle zu Schwelle (1955) – das erste Buch, das ganz in Paris entstanden ist. Ab 1959 ist er als Lektor für Deutsch an der Pariser École normale supérieure tätig. Wie Heine schreibt er als jüdischer Autor im Pariser Exil deutsch. Er bleibt der Sprache seiner Mutter treu, die auch die Sprache der Mörder seines Volkes und seiner Eltern war.
Die Nachkriegsliteraten zeigen wenig Verständnis für einen jüdischen Dichter aus Osteuropa.
Als Celan im Mai 1952 bei der Tagung der Gruppe 47 in Niendorf an der Ostsee debütiert, hegt er Hoffnung, von seinen deutschen Schriftstellerkollegen, die sich auf ihre antifaschistische Gesinnung etwas zugutehalten, mit Verständnis aufgenommen zu werden. Umso mehr befremden ihn die Reaktionen. „Die haben da einfach nur gelacht“, erinnert sich Klaus Wagenbach. Vor allem Celans Art des Vortrags stößt auf Ablehnung. „Gruppenchef Hans Werner Richter sprach von einem merkwürdigen Singsang wie in einer Synagoge“ und verglich seinen Tonfall sogar mit Goebbels. Die Nachkriegsliteraten zeigen wenig Verständnis für einen jüdischen Dichter aus Osteuropa. Die Lesung in Niendorf bringt Celan zwar den erwünschten Durchbruch – er erhält das Angebot, einen Gedichtband bei DVA zu veröffentlichen –, aber das Unverständnis der meisten Kollegen setzt ihm zu. Im Rückblick hat Celan die Gruppe 47 abfällig als „Fußballer“ bezeichnet.
„Das Grab in der Luft – lieber Walter Jens, das ist, in diesem Gedicht, weiß Gott weder Entlehnung noch Metapher.“
Auch die Resonanz der Literaturkritik fällt teils wenig erfreulich aus. Celans frühe Gedichte werden als ästhetische Bewältigung des Grauens (um-)gedeutet. Der Wohlklang der Verse wird gerühmt, die historischen und politischen Momente seiner Lyrik werden geleugnet. Diese Ignoranz entspricht der Verdrängung der Wirtschaftswunderjahre. Die Zwiespältigkeit der Celan-Rezeption kann an der Todesfuge abgelesen werden: Einerseits begründet sie den frühen Ruhm des Dichters und wird in Lesebücher aufgenommen. Andererseits wird sie als rein artifizielles Gebilde eingestuft, das die Schrecken der Vergangenheit hinter sich lasse und „in den Äther der reinen Poesie“ führe. „Als kontrapunktische Exerzitien auf dem Notenpapier“ bezeichnet sie ein renommierter Kritiker. Celan ist empört, es gehe in seinen Gedichten und besonders in der Todesfuge darum, der verstummten Opfer zu gedenken: „Die Todesfuge ist ein Grabmal“, schreibt er an einen Freund. Noch 1961 wiederholt er in einem Brief : „Das Grab in der Luft – lieber Walter Jens, das ist, in diesem Gedicht, weiß Gott weder Entlehnung noch Metapher.“
Schärfer noch als diese Fehldeutungen setzen Celan die Plagiatsvorwürfe der Witwe des Dichters Yvan Golls zu, er habe aus seinen Werken kopiert. Der Plagiatsvorwurf soll Celan, der 1960 den Büchnerpreis erhalten hat, schaden. Ein Gutachten der Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung, das die Diffamierungskampagne Claire Golls als unhaltbar erweisen soll, sowie öffentliche Stellungnahmen von Ingeborg Bachmann, Marie-Luise Kaschnitz und anderen können Celan nicht beruhigen. „Sie kennen die Umtriebe des Neonazismus in der Bundesrepublik“, schreibt er an Alfred Margul-Sperber. „Im deutlichen Zusammenhang mit diesen Umtrieben erfolgt nun auch seit längerem der Versuch, mich und meine Gedichte zu zerstören.“ Celan sieht sich als Opfer einer antisemitischen Literaturkritik und muss sich wiederholt in psychiatrische Behandlung begeben. Misstrauen und Verbitterung wachsen trotz zunehmender öffentlicher Anerkennung.
Celan erhofft sich von Heidegger ein klärendes Wort zur Vergangenheit.
1967 nimmt Celan eine Einladung an die Universität Freiburg zu einer Lesung an. Am 24. Juli 1967 liest er im Auditorium Maximum vor mehr als tausend Hörern, auch Martin Heidegger ist anwesend. Celan hatte sich seit den frühen 1950er Jahren mit Arbeiten des Philosophen befasst. Was aber kann die Begegnung zwischen dem deutschen Seinsdenker, der von 1933 bis 1945 NSDAP-Mitglied war, und dem jüdischen Dichter, der die Shoah überlebt hat, bringen? Celan erhofft sich von Heidegger ein klärendes Wort zur Vergangenheit. An Ingeborg Bachmann schreibt er im August 1959: „Ich bin, Du weissts, sicherlich, der letzte, der über die Freiburger Rektoratsrede und einiges andere hinweggehen kann; aber ich sage mir auch, dass derjenige, der an seinen Verfehlungen würgt, der nicht so tut, als habe er nie gefehlt, der den Makel, der an ihm haftet, nicht kaschiert, besser ist als derjenige, der sich in seiner seinerzeitigen Unbescholtenheit […] auf das bequemste und einträglichste eingerichtet hat […] Ich kann mir sagen, dass Heidegger vielleicht einiges eingesehen hat.“ In Freiburg weigert sich Celan, gemeinsam mit dem Philosophen abgelichtet zu werden. Gleichzeitig nimmt er die Einladung zu einer Wanderung im Schwarzwald an, die wegen Regens abgebrochen werden muss. So kommt es zu einem Besuch in Heideggers Hütte in Todtnauberg, die ihren Niederschlag in einem gleichnamigen Gedicht gefunden hat:
Todtnauberg
Arnika, Augentrost, der
Trunk aus dem Brunnen mit dem
Sternwürfel drauf,
in der
Hütte,
die in das Buch
– wessen Namen nahms auf
vor dem meinen? –,
die in dies Buch
geschriebene Zeile von
einer Hoffnung, heute,
auf eines Denkenden
kommendes
Wort
im Herzen,
Waldwasen, uneingeebnet,
Orchis und Orchis, einzeln,
Krudes, später, im Fahren,
deutlich,
der uns fährt, der Mensch,
der’s mit anhört,
die halb-
beschrittenen Knüppel-
pfade im Hochmoor,
Feuchtes,
viel. (GW II, 255f)
Das Gedicht hat Celan dem Philosophen in einem bibliophilen Sonderdruck zukommen lassen. Dessen Antwort vom 30. Januar 1968 bleibt allerdings vage, das Wort des Dichters sei „Ermunterung und Mahnung zugleich“ und bewahre „das Andenken an einen vielfältig gestimmten Tag im Schwarzwald“ auf. „Seitdem haben wir Vieles einander zugeschwiegen.“ Die Hoffnung Celans auf Wort, das Klärung im Blick auf die Vergangenheit hätte bringen können, läuft ins Leere. Heidegger hatte zwar bereits in seinen Bremer Vorträgen die fabrikmäßige Tötung in den Vernichtungslagern angesprochen. Aber über die Opfer der Shoah, die Schuld der Täter und seine persönliche Verstrickung in die NS-Ideologie hat er geschwiegen. Der postmoderne Philosoph Jean-François Lyotard hat das Schweigen Heideggers über die Judenvernichtung als den eigentlichen Fehl seines Denkens bezeichnet, diese Leerstelle wiege schwerer als die ideologischen Verfehlungen im Dritten Reich. Er schließt sein Buch Heidegger und „die Juden“ mit einem Verweis auf Todtnauberg: „‘Celan‘ ist weder der Anfang noch das Ende Heideggers, er ist dessen Fehl: woran ihm fehlt, was er verfehlt und dessen Fehlen ihm fehlt.“[1] Der judenfeindliche Subtext des Seinsdenkens ist durch die postume Edition der Schwarzen Hefte noch augenfälliger geworden.
Celans Verhältnis zu Deutschland bleibt ambivalent.
Celans Verhältnis zu Deutschland bleibt ambivalent. Im Spätwerk finden sich Spuren eines poetischen Sarkasmus. Noch die letzte Lesung Celans am 22. März 1970 vor der Hölderlin-Gesellschaft in Stuttgart wird zu einem Fiasko. „Geeichte Philologen“ schüttelten den Kopf, als sie die Gedichte „aus dem ersten Teil des damals noch ungedruckten Bandes Lichtzwang“ hörten, erinnert sich der Literaturwissenschaftler Hans Mayer.
Gleichzeitig wächst Celans Solidarität mit Israel. Zwar hat er als Jugendlicher den Zionismus seines Vaters abgelehnt, aber nach 1945 hat er die Gründung des Staates Israels begrüßt. Während des Sechstagekriegs 1967 nimmt er in Paris an einer Studenten-Demonstration für Israel teil und protestiert gegen die araberfreundliche Politik Frankreichs. In seinem Gedicht Denk dir legt er einen poetischen Kommentar zum politischen Zeitgeschehen vor, in dem er durch die Rede vom „Moorsoldaten von Massada“ die Erinnerung an die Lager verschränkt mit dem Sechstagekrieg:
Denk dir
Denk dir:
der Moorsoldat von Massada
bringt sich Heimat bei, aufs
unauslöschlichste,
wider
allen Dorn im Draht.
Denk dir:
die Augenlosen ohne Gestalt
führen dich frei durchs Gewühl, du
erstarkst und
erstarkst.
Denk dir: deine
eigene Hand
hat dies wieder
ins Leben empor-
gelittene
Stück
bewohnbarer Erde
gehalten.
Denk dir:
das kam auf mich zu,
namenwach, handwach,
für immer,
vom Unbestattbaren her.
Im Oktober 1969 reist Celan nach Israel und setzt damit ein öffentliches Zeichen seiner Solidarität. Bei einer Lesung in Jerusalem trägt er eine Auswahl aus seinen bislang erschienen Gedichtbänden vor, als wolle er noch einmal den ganzen Bogen seines Werkes abschreiten. Die Lesung beschließt er mit dem Gedicht Denk dir, seinem Bekenntnis zu Israel. Anschließend gibt es einen Empfang im Haus des Kabbala-Forschers Gershom Scholem, der bereits 1942 geäußert hatte, „so etwas wie den Finger Gottes in dem seltsamen Schicksal Palästinas“ zu spüren.
Die späten Jerusalem-Gedichte lassen biblische Bundesmotive anklingen, spielen die Topographie Jerusalems ein und lassen die erotische Liebe zwischen Mann und Frau aufleuchten.
Bei seinem Israel-Aufenthalt trifft Celan erneut Ilana Shmueli (1924–2011), die er aus Czernowitzer Jugendtagen kennt. Sie ist mit der untergegangenen Kulturwelt der Bukowina vertraut, hat die Brutalität der braunen und der roten Besatzung miterlebt. Celan nennt sie liebevoll „Tochter Zion“, die Begegnung mit ihr, die eindrücklichen Spaziergänge rund um die Heilige Stadt setzen im Nachgang zur Reise eine erstaunliche Produktivität frei. Die späten Jerusalem-Gedichte lassen biblische Bundesmotive anklingen, spielen die Topographie Jerusalems ein und lassen die erotische Liebe zwischen Mann und Frau aufleuchten.
Die Glut
zählt uns zusammen
im Eselsschrei vor
Absaloms Grab, auch hier,
Gethsemane, drüben,
das umgangene, wen
überhäufts?
Am nächsten der Tore tut sich nichts auf,
über dich, Offene, trag ich dich zu mir. (GW III, 97)
Die Briefe, die nach der Reise zwischen Paris und Jerusalem hin- und hergehen, ringen nicht nur mit dem räumlichen Abstand. Aus Paris schreibt Celan am 21. Oktober 1969: „Ich sehe Dich, wie Du Dich entfernst in der Nacht, seh Dich hineingehen in diese Nacht und wünsche, ich wäre dort, am andern Ende, Dich aufzunehmen ins Nicht-zu-Sagende.“ Und: „Jerusalem hat mich aufgerichtet und gestärkt. Paris drückt mich nieder und höhlt mich aus.“ In seinem letzten Brief vom 12. April 1970 schreibt Celan: „In Dankbarkeit für Dein An-mich-Denken, Dein Zu-mir-Fühlen, Dein Zu-mir-Stehn […]. Dein Wort darüber, daß Wahrhaftigkeit Sehnsucht sei, hat mich ganz ergriffen. […] Du weißt, was meine Gedichte sind – lies sie, das spür ich dann.“ Die anfängliche Hoffnung, dass Jerusalem eine Wende, eine Zäsur, einen Neuanfang bringen werde, erfüllt sich nicht. Der Fall, der dann kommt, ist tief und unwiderruflich. Er kündigt sich in vereinzelten Versen bereits an:
Die nachzustotternde Welt,
bei der ich zu Gast
gewesen sein werde, ein Name,
herabgeschwitzt von der Mauer,
an der eine Wunde hochleckt. (GW II, 349)
Paul Celans Dichtung hat Adorno zum Widerruf seines Diktums veranlasst, nach Auschwitz Gedichte zu schreiben sei barbarisch. Am 23. November wäre Celan, der wohl bedeutendste deutschsprachige Lyriker nach 1945, 100 Jahre alt geworden.
—
Zur Vertiefung: Jan-Heiner Tück, Gelobt seist du, Niemand. Paul Celans Dichtung – eine theologische Provokation, Freiburg i. Br.: Herder 2020.
[1] Jean-François Lyotard, Heidegger und „die Juden“, Wien – Böhlau 1988, S. 110.
Autor: Jan-Heiner Tück ist Professur für Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien und Initiator der „Poetikdozentur“
Beitragsbild: